Warum X (Twitter) nicht stirbt
Wiedermal wurde das Ende eines sozialen Netzwerks beschworen, und wieder ist das Ende schnell zu Ende gewesen. Was hält Twitter am Leben?
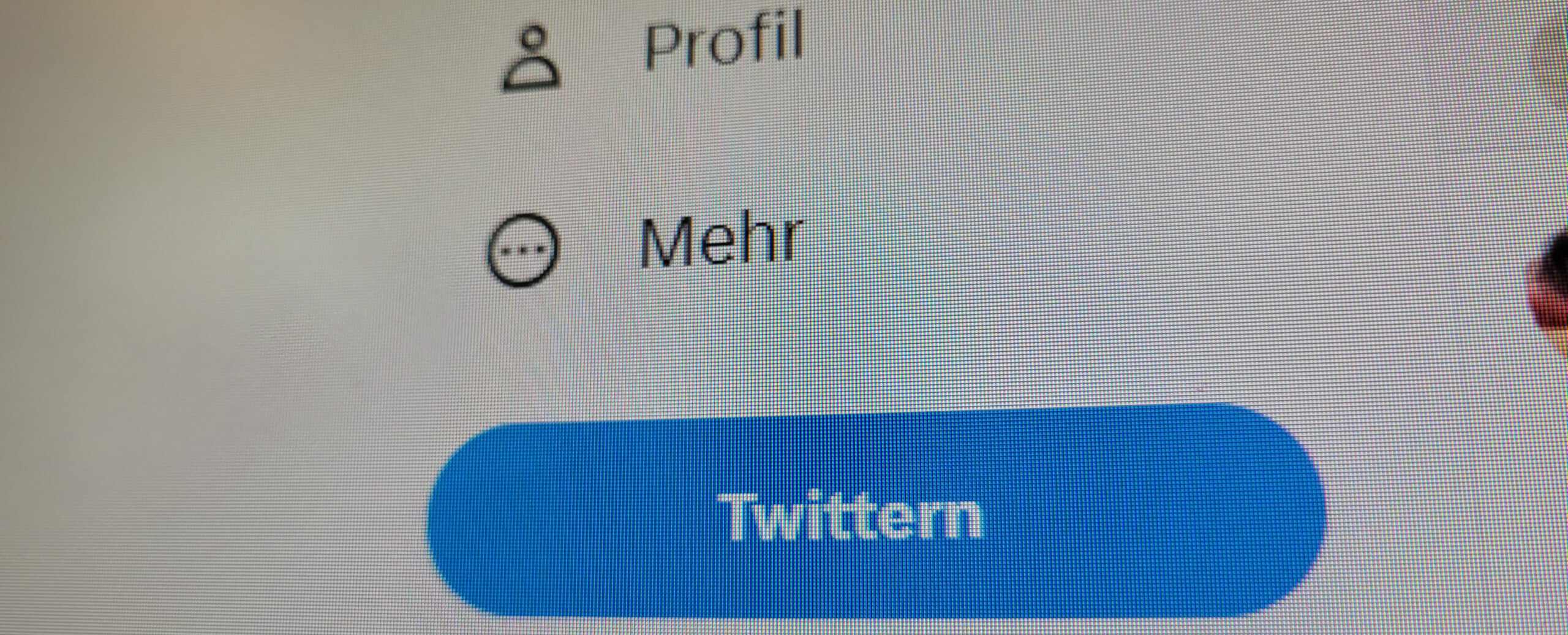
Inzwischen sind sie wohl alle wieder zurückgekehrt, die X – und Twitter-Kritiker, die nach der Übernahme der Plattform durch Elon Musk scharenweise zu Mastodon gewechselt waren. Dort sollte die Ursprungsidee des guten alten Web 2.0 wiederbelebt werden, ein Netz für alle, dezentral, nicht beherrscht und betrieben von einem mächtigen Konzernbesitzer, der im Hintergrund seine eigene kapitalistische Agenda verfolgt.
Die älteren hatten das alles schon mehr als einmal erlebt, damals, als Facebook durch Google Plus abgelöst werden sollte, dann bald darauf, als Ello die konzernbefreite Alternative zu Facebook werden sollte, dann natürlich, als Facebook WhatsApp kaufte und irgendwie alle meinten, jetzt würden alle zu Threema oder Telegram oder Signal wechseln.
Es muss einen Unterschied zu X (Twitter) geben
Es ist interessant, zu beobachten, was wirklich geschehen ist. Facebook hat tatsächlich an Bedeutung verloren, aber nicht durch die Konkurrenz, die eigentlich nichts anderes angeboten hat als die Zuckerberg-Plattform, sondern durch den Kurznachrichtendienst Twitter, der ein anderes Kommunikationsmodell hat. Und auch die WhatsApp-Alternativen konnten dem Original nur insofern ein paar Kunden abspenstig machen, als sie etwas eigenes auf die Beine stellten, was sich vom Original deutlich unterschied.
Diese Innovationskraft fehlte Mastodon von Anfang an, seine Attraktivität sollte sich einzig aus der überlegenen Moral der Betreiber herleiten: nicht der eigennützige Kapitalist, sondern die altruistischen Serverbetreiber mit den Instanzen im Wohnzimmer – das klang irgendwie schön, aber es reichte nicht als Magnet, um die Nutzer wirklich in großer Zahl zum Überlaufen zu bewegen.
Und die große Zahl von Followern oder Freunden, somit die Chance auf Weiterverbreitung der eigenen Botschaft und auf Reaktionen, Zustimmung oder Widerspruch, kurz, die Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu erregen, das ist es, was die Leute auf die Social-Media-Plattformen treibt. Wenn ich auf mein kluges Statement keine Antworten erhalte, wenn niemand den Like-Button klickt und keiner meine Nachricht an seine eigenen Freunde und Follower weitergibt, dann hat das Posten keinen Sinn, dann macht es keinen Spaß, dann verschafft es keine Befriedigung. Nur, wenn ich selbst ein paar hundert oder tausend Abonnenten habe, hab ich die Chance auf ein paar Dutzend Reaktionen, davon wiederum vielleicht von zwei oder drei Leuten mit ein paar Tausend Lesern, die mir dann hin und wieder die ganz große Reichweite verschaffen, eine Welle von Reaktionen, die erst nach Tagen wieder abflacht. Das aber funktioniert nicht auf einer Plattform, auf der nur wenige unterwegs sind. Die müsste dann irgendetwas ganz anderes, neues bieten, was mich so lange bindet, bis die Zahl der Verbindungen zu anderen Leuten so weit gewachsen ist, dass eine gewisse Lebendigkeit zu spüren ist.
Dieses Andere aber hat Mastodon nicht – und deshalb ist passiert, was zu erwarten war: allmählich kehren alle, mehr oder weniger bereitwillig oder zähneknirschend, zu Twitter zurück. Die Betreiber der Mastodon-Instanzen können am Ende froh darüber sein. So bleibt ihnen erspart, was früher oder später auf sie zugekommen wäre: das Löschen von Postings, die gegen Gesetze verstoßen oder bei denen das zumindest angenommen werden kann, das Sperren von Benutzern, die sich nicht an Regeln halten wollen. Wir werden nie erfahren, wie die selbstorganisierenden Server-Admins diese Aufgabe nachhaltig und weitgehend akzeptabel hätten lösen wollen.
Das Labor der Gesellschaft heißt X (Twitter)
Das ist der richtige Moment, darüber nachzudenken, was X (Twitter) eigentlich für eine Rolle im öffentlichen Diskurs spielt oder spielen darf – genauer gesagt, welche Rolle die Plattform einfach dadurch spielt, dass sie da ist und dass sich dort eine gewisse Kommunikation etabliert hat, die in ihrer Wirkung quasi zwangsläufig über die Webseite und die Apps, die dazu gehören, hinausreicht. Klar ist: Es sind nur wenige auf Twitter aktiv, selbst von den Personengruppen, die immer wieder genannt werden – Politiker und Journalisten – ist es am Ende nur eine Minderheit. Aber darauf kommt es nicht an. X-Twitter ist eine Laborsituation, eine Experimentalanordnung der politischen Gesellschaft, und auch die, die nicht dort aktiv sind, schauen hin.
Die entscheidenden Mitspieler bei Twitter sind nicht einmal diejenigen, die sowieso in der Öffentlichkeit stehen, die paar Minister und Bundestagsabgeordneten oder die mehr oder weniger bekannten Journalisten, auch nicht die Wissenschaftler und Experten, die je nach Fach zu Corona, zum Krieg in der Ukraine und zum Klimawandel twittern. Entscheidend ist die anonyme Masse der namenlosen Twitterer, die unter den Tweets der Prominenten ihre Meinung hinterlassen, die liken oder teilen, was da an Statements hinterlassen wird, und die damit wiederum die spontanen Reaktionen derer provozieren, die eigentlich gewohnt und darauf bedacht sind, ihre Worte in der Öffentlichkeit ganz genau abzuwägen. Man meint deshalb oft, Twitter sei ein Medium, das dazu verführt, die Kontrolle über die eigene Kommunikation zu verlieren, und das ist wohl auch richtig, aber es ist kein Nachteil.
X oder Twitter ist der etwas unaufgeräumte Experimentiertisch der Politik, auf dem wie in einem chaotischen Chemielabor die Dinge zusammengewischt werden, die eigentlich streng auseinander gehalten werden sollten, weil es knallt und stinkt, wenn sie gemischt werden. Und es ist gut so, dass das ab und zu passiert, weil man daran auf kleinem Raum sehen kann, wie gefährlich die gesellschaftlichen Säfte sind, die da an verschiedenen Orten entstehen. Und damit ist nicht nur die Stimmung der so genannten einfachen Leute gemeint, sondern auch die Ignoranz der Politik, die Weltfremdheit der Wissenschaft und die Ahnungslosigkeit vieler Medienmacher. In den Weiten der Gesellschaft hält man sich schön auf Distanz, Konventionen und Höflichkeit verhindern den allzu ernsten Zusammenprall und selbst in den Talkshows weiß man sehr genau, wie man die Erregung so dosiert, dass der Knall und das bunte Schäumen zwar spektakulär aussieht, aber doch immer unter Kontrolle bleibt. Das funktioniert bei Twitter nicht – und das ist gut so. Hier knallt jeder dem andern seine unverstellte Meinung an den virtuellen Kopf, und noch die drastische Reaktion des Blockierens kann per Screenshot als Munition genutzt werden.
Es ist die Realität
Man sage nicht, das alles habe ja nichts mit der friedlichen Gesellschaft zu tun. Die, die sich da austoben, dürften durchaus viele Brüder und Schwestern im Geiste auch außerhalb Twitters haben. Alle, die sich das wütende Geschehen bei Twitter angewidert ansehen, sollten deshalb lieber ganz genau hinschauen. Es sind, in kleinen und immer noch überschaubaren Dosen, die Zeichen für die Stimmungen, die es bei den Grillparties in der Nachbarschaft, an die Kneipentischen, in der Frühstückspause im Büro und auf der Baustelle und überhaupt überall da gibt, wo sonst weder Politiker noch Journalisten in der Nähe sind. Es sind weder Bots noch besonders extreme und aggressive Leute, die bei Twitter unterwegs sind. Mag sein, dass die Situation der Anonymität und der direkten und dennoch virtuellen Konfrontation eine besondere Eigendynamik hat, die verborgenes zum Vorschein bringt, aber vorhanden sind die Stimmungen und Meinungen, die sich da zeigen, überall. Deshalb sollte man sie auch als real nehmen und nicht ignorieren. Es ist richtig, wenn die Medien Tweets in die breite Öffentlichkeit tragen, sei es von Ministern oder von anonymen Schreibern. Nirgends sonst agieren die Leute so unverstellt und offen. Wer wissen will, was in den Köpfen vorgeht, schaut auf X oder Twitter.
Zur Person
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
Schreibe einen Kommentar