Die Adventszeit und das Weihnachtsfest zeigen es Jahr für Jahr: Wir leben in einer christlich geprägten Gesellschaft. Seit rund 2.000 Jahren bestimmt die christliche Religion die Traditionen, den Rhythmus der Arbeitswoche, die Feiertage, die Redewendungen. Bedeutende Kunstwerke sind von christlichen Motiven geprägt, die beeindruckende Architektur in den Städten überall in Europa verdankt ihre Entstehung und ihr Aussehen der Anbetung des christlichen Gottes. Unsere moralischen Grundsätze fassen wir, ob wir gläubige Christen sind oder nicht, in Worte, die der Heiligen Schrift dieser Religion entnommen sind.
Heute geht der Einfluss der christlichen Kirchen gerade da stetig zurück, wo sie in den letzten zwei Jahrtausenden besonders prägend waren. Mit dem Gottesglauben, so wie er vom Christentum verstanden wird, können sich immer weniger Menschen identifizieren. Die Naturwissenschaften haben die Vorstellungen von Gott und Jenseits fragwürdig gemacht. Damit sind auch alle moralischen Normen, die das Christentum mit Bezug auf diesen Gottesglauben gesetzt hat und noch immer setzt, fragwürdig geworden. Wenn ich mich moralisch letztendlich vor einem Gott, der als Person verstanden wird, zu verantworten habe, dann wird der Moral mit dem Glauben an diesen Gott letztlich der Boden unter den Füßen weggezogen.
Gegenwärtig ist die Meinung verbreitet, dass mit dem Reputationsverlust der alten Kirchen das Ende der Religionen überhaupt gekommen wäre. Warum haben die Menschen überhaupt immer wieder eine neue Religion und eine neue Kirche aus dem Bestehenden heraus geschaffen, warum haben sie die ganze Idee der religiösen Kulte, die von einer Kirche zelebriert und gepflegt werden, nicht längst lachend beiseite getan? Die Vermutung, dass eben erst wir heute so klug sind, zu erkennen, dass es keinen Gott und kein Jenseits gibt, dass alles erklärbar ist und dass es für Götter keinen Ort und keine Notwendigkeit gibt, greift zu kurz. Auch die alten Griechen hielten die Welt für erkennbar, auch unter ihnen gab es schon Denker, die die Existenz der Götter bestritten und dafür gute Gründe angeben konnten. Wir machen es uns zu leicht, wenn wir sagen, dass die Menschen in früheren Jahrtausenden eben einfach noch dümmer oder unwissender waren als wir, und erst wir heute so viel Wissen angehäuft hätten, um beweisen zu können, dass es Götter nicht gibt oder dass sie wenigstens nicht gebraucht werden.
Glauben, Kult und Autorität
Wenn wir dem Geheimnis der Anziehungskraft der Religionen auf die Spur kommen wollen, ist es sinnvoll, erst einmal die Frage zu stellen, was mit diesem Begriff eigentlich bezeichnet wird. Je nach der Weltgegend und historischer Epoche begegnen uns ganz verschiedene Traditionen und Handlungsweisen, die wir doch ziemlich sicher unter dem Begriff der Religion zusammenfassen. Manche Religionen haben eine ganze Vielzahl von Göttern, die sie anbeten und mit denen sie auf besondere Weise ins Gespräch kommen. Andere haben einen einzigen Gott, wieder andere haben gar keinen Gott, aber dennoch eine Instanz, außerhalb der Alltagserfahrung, mit der sie auf nicht alltägliche Weise in Verbindung kommen. Manche Religionen organisieren sich in einer straff geführten hierarchischen Kirche, während andere nur einzelne religiöse Führer haben. Es gibt verschieden bestimmte heilige Orte, an denen die Angehörigen der Religionsgemeinschaft zu bestimmten Zeiten oder Ereignissen zusammenkommen, um Rituale zu zelebrieren, religiösen Inszenierungen zu folgen oder, wiederum auf ganz verschiedene Weise, gemeinsam zu beten.
Was ist all diesen vielfältigen Traditionen und Handlungen gemeinsam? Es scheint, als ob es bei jedem Phänomen, das wir als Religion bezeichnen, drei Aspekte gibt, die miteinander verschränkt oder dicht verwoben sind, sodass man diese manchmal miteinander gleichsetzt. Da ist zuerst einmal der Aspekt des Glaubens an etwas, das außerhalb des Alltags der Gemeinschaft existiert, und doch für diese Gemeinschaft und für das Leben eines jeden Einzelnen in der Gemeinschaft von ganz grundsätzlicher Bedeutung ist. Der zweite Aspekt ist der des Kults oder des Rituals. Im Ritual, dem gemeinsam und nach gewissen traditionell vorgegebenen Vorschriften inszenierten Kult, wird das, woran die Gemeinschaft glaubt, erfahrbar gemacht. Hier wird die Verbindung zum Alltag gelöst und zum Wesentlichen, dem der Glauben gilt, hergestellt. Schließlich gibt es den Aspekt der Institution, in der sich die Gemeinschaft organisiert und der eine Autorität die Einhaltung des Kults organisiert und sichert. Die Institution Kirche ist, sowohl im praktischen als auch im metaphorischen Sinn, die Stätte, an der die Religionsausübung stattfindet und die die Stabilität der religiösen Erfahrung über lange Zeit und an den verschiedenen Orten, an denen die Religionsgemeinschaft zusammenkommt, sichert.
Der Dreiklang von Glauben, Kult und Autorität ist nicht nur bei kulturellen Phänomenen zu beobachten, die wir im engeren Sinne als Religionen bezeichnen. Politische Parteien und wirtschaftliche Unternehmen haben ihre spezifischen Überzeugungen, die sie als ihre Aufgabe oder ihre Mission ansehen, sie pflegen und inszenieren regelmäßig bestimmte Rituale, um die Angehörigen auf die Gemeinschaft und die gemeinsamen Ziele einzuschwören, und sie haben dafür spezielle Organisationsformen und Versammlungsstätten, die der Pflege der Traditionen und Kulte dienen. Nicht umsonst sprechen wir, wenn der Dreiklang dieser gemeinschaftlichen Traditionspflege besonders stark und emotional ausgeprägt ist, davon, dass die Versammlung der jeweiligen Gemeinschaft religiöse Züge annimmt.
Was unterscheidet diese manchmal religiös anmutende Traditionspflege von Religionen im engeren Sinne? Es ist nicht die Intensität des Glaubens oder die Strenge des Rituals, es ist auch nicht der Organisationsgrad der Gemeinschaft. In einer Religion geht es auf sehr fundamentale Weise immer um den ganzen Menschen und um seine Stellung in der Gemeinschaft, somit geht es auch für die Gemeinschaft in grundsätzlicher Weise um ihren Sinn und den Zweck allen Tuns selbst. Eine politische Partei hat ein politisches Ziel, um dessen Willen das gemeinschaftliche Handeln gestärkt werden soll, so wie ein Unternehmen ein wirtschaftliches Ziel hat und ein Sportverein ein sportliches Ziel. Um diese Ziele zu erreichen, soll das Gemeinschaftsgefühl gestärkt werden, und dazu gilt es, den Glauben an das Ziel und an die Kraft der Gemeinschaft zu stärken, indem Traditionen gepflegt und Rituale gelebt werden, dazu werden Organisationsformen geschaffen und gemeinschaftliche Ereignisse an besonders geeigneten Orten organisiert.
In einer Religion geht es jedoch um den Sinn allen gemeinschaftlichen Tuns und um die Bedeutung des Einzelnen in dieser Gemeinschaft selbst. Es geht darum, wie sich die einzelne Person auf die Gemeinschaft in all ihrem Handeln verpflichtet, es geht um die moralischen Grundsätze der ganzen Gemeinschaft in all ihrem Wirken. Letztlich bildet das Erleben dieser Gemeinschaft die Grundlage für jede Gemeinschaftlichkeit, auch für die politische und wirtschaftliche.
Viele Menschen meinen heute, ohne eine solche verpflichtende Gemeinschaftlichkeit einer Religion, in die sie eingebunden sind, auskommen zu können. Vielleicht heißt das letztlich, dass die Gesellschaft auch ohne ein ganz fundamentales Gemeinschaftsempfinden auskommen kann, dass sich Gemeinschaftlichkeit auch gebunden an konkrete Zwecke auf Zeit ausbilden kann und dass die Menschen ansonsten voneinander unabhängige und einander nicht verpflichtete Individuen sein können. Es spricht aber auch einiges dafür, dass Verantwortung und Pflichtgefühl im einzelnen nur stabil und zuverlässig möglich sind, wenn sie auf einem allgemeinen moralischen Fundament ruhen, das durch eine Gewissheit der Bedeutsamkeit von Gemeinschaft und des eigenen Handelns für eine Gemeinschaft zustande kommt.
Sinn und Bedeutsamkeit
Wenn wir fragen, worin aller religiöser Glauben, sei er mit einem personalen Gott verbunden oder nicht, zusammenkommt, dann darin, dass das, was uns in der Welt begegnet, und unser Handeln in der Welt einen Sinn hat, dass es Bedeutung über das hinaus hat, was uns jeweils zum Weiterleben nötig ist. Mit ihrem Glauben versehen die Menschen ihre Welt mit Bedeutsamkeit. Das gilt für die Position jedes einzelnen Lebens innerhalb der Gemeinschaft als auch für das gemeinschaftliche Wirken in der Welt, für das Verstehen dieser Wirklichkeit, in der die Realität auf die Menschen wirkt, so wie umgekehrt menschliche Praxis auf die Welt wirkt. Wir können diese Verwebung und Einwebung der Menschen in die Gemeinschaft und in die Welt nur verstehen, indem wir sie in ihrer Bedeutung begreifen. Die einzelnen Bedeutungen bringen wir in einen Bedeutungszusammenhang, der Geburt, Leben und Tod, die Regelmäßigkeiten des gemeinschaftlichen Lebens, die Differenzierungen innerhalb unserer gesellschaftlichen Einbindungen und die Wechselfälle und Ereignisse des Lebens einschließt. Religiosität bedeutet, diese Bedeutsamkeit gemeinsam verständlich und erfahrbar zu machen und damit „dem Ganzen“ einen Sinn zu geben, den wir akzeptieren können. Gerade für die Dinge, die uns wichtig und groß erscheinen, ist diese Bedeutsamkeit besonders augenfällig. Das moralische Handeln sowie das Suchen nach Wahrheit und Schönheit sind mit der Gewissheit verbunden, dass sie einen Sinn über den Moment hinaus haben, unabhängig davon, ob sie direkt nützlich und erfolgreich sind, oder nicht.
Glauben ist die Überzeugung, dass es etwas gibt, ohne dass wir uns selbst von seiner Existenz überzeugt hätten, sei es durch direkte Anschauung oder sei es durch logische Schlussfolgerung aus solchen direkten Anschauungen. Streng genommen basiert fast alles, was wir als sicheres Wissen bezeichnen, auf Glauben. Wir glauben, was die Eltern sagen, was die Lehrer und Professoren uns lehren, wir glauben, was in den Lehrbüchern steht und was die Nachrichten uns mitteilen. So ist es auch mit den moralischen Überzeugungen, die wir durch die Befragung des Gewissens gewinnen und festigen und von denen wir wissen, dass wir sie mit anderen teilen.
Manche Menschen verbinden diese ganz grundsätzlichen Gewissheiten mit einem Gott oder mit anderen Wesen, die außerhalb der Alltagserfahrung angesiedelt sind und zu denen sie durch ihr Gewissen in bestimmten Momenten und Situationen in Kontakt kommen, andere haben für das, was hinter diesen Grundsätzen steht, keinen Namen. Auch ohne von einem Gott zu sprechen, sagen wir oft, dass uns diese Dinge „heilig“ sind. Heilig kann uns auch die gewaltige Natur sein, der Sternenhimmel, der Regenbogen, das Wachsen der Lebewesen, die Geburt eines Menschen, die Gemeinschaft, in der wir uns geborgen fühlen. Das sind die Dinge, an deren Bedeutsamkeit wir glauben, unabhängig davon, ob wir sie mit einem Gott verknüpfen oder nicht.
Das Ritual: Die Sprache des Bedeutsamen
Die Sprache, in der sich Bedeutsamkeit zeigt, ist die der Rituale. Zwar können wir die Bedeutungen von Ereignissen und den Sinn vor Erlebnissen auch in Worte fassen, aber sie offenbaren sich im Ritual. Ich kann meinem Freund versichern, dass ich ihn schätze und ihm beistehen werde, aber viel verständlicher wird, was er mir bedeutet, im festen Händedruck. Die Bedeutung des Abschiedsschmerzes spüren wir in der Umarmung am Bahnsteig. Durch die Zeremonie der Zeugnisübergabe wird den Schülern die Bedeutung des Moments für das ganze Leben bewusst. Sie spricht im Ritual, das die Gemeinschaft mit diesem Moment verbindet, und umso selbstverständlicher und stärker das Ritual gelebt wird, desto bedeutsamer ist der Moment. Wir glauben die Bedeutung einer Freundschaft umso sicherer, desto fester und selbstverständlicher der Händedruck und die Umarmung beim Abschied sind.
In den Ritualen feiern die Menschen die Bedeutsamkeit dessen, woran sie im eben beschriebenen Sinne glauben, die Feiertage sind deshalb auch die wichtigen Momente, in denen die Menschen sich ihrer Zugehörigkeit zu einer solchen Gemeinschaft versichern. Es ist nicht überraschend, dass Menschen etwa in Europa dabei an die christlichen Feiertage und Rituale anknüpfen. Wie schon gesagt, wir sind in all unseren Traditionen über zweitausend Jahre christlich geprägt. Das bedeutet nicht nur, dass wir an Feiertage wie etwa Ostern und Weihnachten, oder an bestimmte Rituale im Zusammenhang mit der Geburt eines Menschen, dem Erwachsenwerden, der Hochzeit und dem Tod „gewöhnt“ sind, sondern dass sich die Bedeutsamkeit, der Sinn dieser Feiern mit der Bedeutung, die wir in der Einbindung eines jeden von uns in die Gemeinschaft erleben, aus dieser langen Tradition herleitet. Wir haben bestimmte Vorstellungen von den moralischen Verpflichtungen der Gemeinschaft gegenüber einem Neugeborenen, von den Pflichten, die zwei Menschen durch Heirat füreinander übernehmen. Wir haben auch die Überzeugung, dass wir uns immer wieder auf den Wert der Gemeinschaft, auf unsere Schwächen, auf die Fähigkeit, füreinander einzustehen, besinnen sollten.
In einem ganz ursprünglichen und fundamentalen Sinn ist uns Menschen eine so verstandene Religiosität offenbar wesenseigen. Das bedeutet nicht, wie man manchmal meint, dass Spiritualität oder gar Mystik oder der Wunsch nach schönen Ritualen in einem romantischen Sinn ein Bedürfnis sind, das die Religionen in den Kirchen befriedigen, so wie Rockbands und Fußballmannschaften in Stadien unser Bedürfnis nach gemeinsamen Erlebnissen befriedigen. Religiosität ist vielmehr die Weise, wie die Menschen als Gemeinschaft mit sich und der Welt überhaupt umgehen können, es ist die Methode, mit der wir uns selbst in die Gesellschaft integrieren und das Wirken in dieser Gesellschaft und aus ihr heraus in die Umwelt hinein verstehen und gestalten können.
Eine so verstandene Religiosität wird mit dem wissenschaftlichen Fortschritt und den technischen Errungenschaften nicht überflüssig, denn diese können weder unserer Verbindung mit der Welt, noch der Verflechtung der einzelnen Person mit der Gesellschaft Bedeutung und Sinn geben, sie können uns vielleicht sagen, warum die Dinge so sind, wie wir sie vorfinden, aber nicht, warum wir die Dinge verändern sollen, sie können uns Werkzeuge zum Handeln geben, aber keinen Grund, aus dem heraus wir handeln sollten.
Das macht deutlich, dass Religionen nicht irgendein merkwürdiges Bedürfnis befriedigen, es geht nicht um Unterhaltung oder um Erbauung, nicht darum, sich gemeinsam ein paar schöne Stunden zu machen und dafür einige geeignete Anlässe zu finden. Es geht auch nicht darum, die Grundsätze einer christlich geprägten Moral in das nachchristliche Zeitalter hinüberzuretten, weil wir gemerkt haben, dass es für ein halbwegs gelungenes Zusammenleben der Menschen ganz sinnvoll sein kann, weiterhin an die zehn Gebote und die Bergpredigt zu denken. Wir sollten die Traditionen der nahen und fernen Religionsgemeinschaften gerade nicht wie einen Fundus nützlicher Regeln, einen Steinbruch für Lebens- und Moralbausteine betrachten, die wir geschickt und planvoll in unser modernes, gottfernes Lebensgebäude einbauen können.
Religiosität ist – auch wenn das immer noch befremdlich klingt – das Grundprinzip des menschlichen Weltverstehens, die Basis des sicheren menschlichen Handelns. So, wie sich die Alten Griechen, die im Zentrum ihrer Religion Geschichten einer komplexen Götterwelt hatten, wohl nicht vorstellen konnten, dass zur Religion ein einziger Gott ausreicht, so können sich Christen nicht vorstellen, dass Religiosität auch ganz ohne einen Gottesglauben möglich und sinnvoll sein kann. Aber die vieltausendjährige Geschichte der monotheistischen Religionen hat gezeigt, welche vielfältigen Ausprägungen mit dem Glauben an einen Gott möglich sind. Wie sich die Religiosität der Menschen in Zukunft gestaltet, ist natürlich nicht konkret vorhersagbar. Sicher scheint nur, dass wir am Beginn eines Umbruchs stehen, sicher scheint auch, dass Traditionen, Rituale, Geschichten und Symbole der alten Kirchen in neue Formen von etwas, das man vielleicht eine „weltliche Religiosität“ nennen könnte, eingehen werden. Gleichzeitig können Bräuche aus dem nichtreligiösen Alltag sich, wenn sie die Bedeutsamkeit des Zusammenseins erlebbar machen, in solch eine neue Gemeinschaft eingehen. Eine gewisse Vorstellung davon, wie das aussehen könnte, kann man sich machen, wenn man beobachtet, wie wir schon heute außerhalb der Kirchen unsere Gemeinschaftlichkeit erlebbar machen. Zwei gemeinsame Handlungsformen tauchen dabei immer wieder auf: das gemeinsame Essen und das gemeinsame Singen. Es ist nicht überraschend, dass uns diese auch von den christlichen Kirchen her schon bekannt sind.
In den bisherigen Kirchen wird das gemeinsame Abendmahl auf Gott bezogen, und von ihm her kommt auch die Speise und der Trank. Hier wird Gemeinschaft zwar durch das Teilen des Brots und des Weins erlebt, aber sie wird durch Gott hergestellt. In einer Kirche ohne Gottesbezug kommt die Speise, die geteilt wird, auch von der Gemeinschaft. Wir kennen das bereits: Immer häufiger sagen wir, wenn wir zusammen feiern wollen, dass alle, die teilnehmen, auch etwas mitbringen, Salat, Brot, Würstchen, Wein, ungefähr so viel, wie man selbst essen möchte. Dann wird geteilt, niemand isst das selbst mitgebrachte, sondern alle probieren das, was andere mitgebracht haben. Im gemeinsamen religiösen Fest könnte es so sein, dass alle eine Kleinigkeit, vielleicht ein selbst gebackenes kleines Brot, mitzubringen hätten, welches geteilt und in einen gemeinsamen Korb getan wird, aus dem alle sich, zu einem bestimmten Moment am Ende der Feier, ein Stück nehmen. Es wäre auch denkbar, dass dies die Einleitung zu einem anschließenden gemeinsamen Essen ist, zu dem alle etwas zu Essen und zu Trinken mitgebracht haben.
Den gemeinsamen Gesang als Erlebnis von Gemeinschaft kennen wir ebenfalls sowohl aus den Kirchen als auch aus nichtreligiösen Zusammenhängen. Es ist erstaunlich, wie schwer es uns manchmal fällt, in so einen Chor einzustimmen, während wir in anderen Situationen, etwa, weil jemand aus dem Freundeskreis Geburtstag hat, mehr oder weniger lautstark mitsingen. Wenn es darum geht, weder einen Gott noch einen einzelnen zu preisen, dann kommt es auf den Text vielleicht gar nicht an. In einer Kirche ohne Gottesbezug, in der es um die Feier der Gemeinschaft selbst geht, kann man die Melodien auch mitsummen oder klatschen. Wichtig wäre vor allem, dass die Gemeinschaft selbst es ist, die die Musik macht, und dass sie sich nicht nur etwas vorspielen lässt, so wie wir es heute häufig bei „feierlichen Anlässen“ erleben, bei denen man sich vielleicht gut unterhält oder andächtig lauscht, aber trotz großer Zuhörerzahl kein Gemeinschaftsgefühl aufkommt. Das entsteht erst, wie wir aus Fußballstadien und von Rockkonzerten wissen, wenn die Zuhörer zum großen Chor werden.
Man könnte nun fragen, warum es eine Kirche und vielleicht sogar einen festen Ritus des gemeinsamen Essens und ein Gesangsbuch brauchen soll, um auf diese Weise Gemeinschaft zu erleben. Das Problem ist, dass die Freundeskreise und die Fangemeinden oft ganz lokal beschränkt sind, und sie umfassen immer nur einen ziemlich kleinen Teil der ganzen Gemeinschaft, zu der wir eigentlich gehören und die wir, egal wohin wir kommen, eigentlich erleben könnten. Eine weltliche Kirche könnte der Ort der Gemeinschaft sein, der letztlich überall schon eingerichtet ist, wo wir hinkommen, sie lässt uns eine prinzipiell grenzenlose Gemeinschaft sein, die nicht auf dieses oder jenes Interesse oder auf zufällige Bekanntschaften bezogen ist, sondern auf die Gemeinschaftlichkeit der Menschen und ihre Verantwortung füreinander und für ihre Welt selbst. Wenn es einen Menschen irgendwo hin verschlägt, wo er niemanden kennt, könnte er sich die örtliche Gemeinde suchen, er kennt ihre Rituale, kann an ihren Feiern ganz natürlich teilnehmen, und erlebt, dass es überall Gemeinschaft, überall ein Stück Heimat gibt.
Lesen Sie zum gleichen Thema die Kolumne Guter Gott? Böser Gott? von Jörg Friedrich.
In Jörg Friedrichs letzter Kolumne ging es um Flaschensammeln in Würde.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

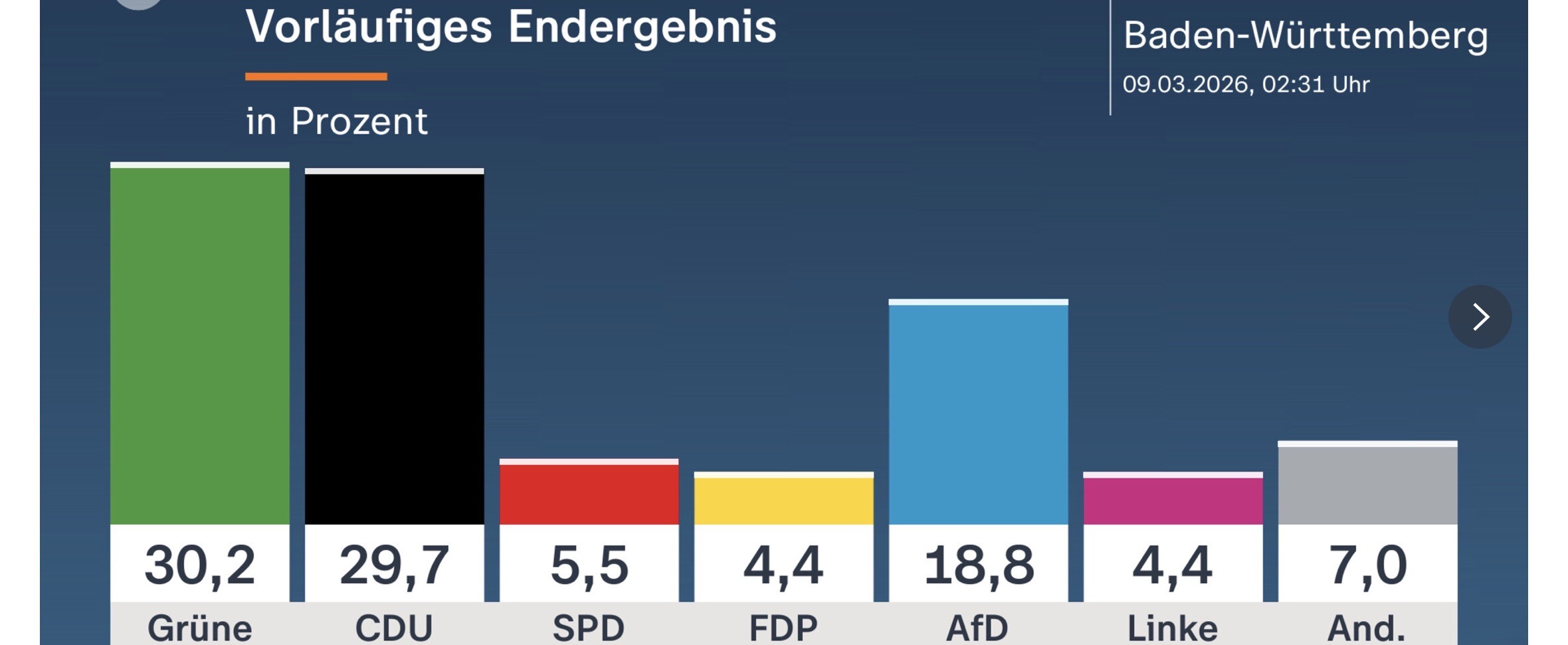


derblondehans
Harald Schmidt in der ‚Weltwoche‘: ‚Ich glaube definitiv an die Auferstehung … Mir hat mal ein Urologe erzählt, auf dem Sterbebett werden alle katholisch. Diese Erfahrung habe ich auch selbst gemacht, denn ich war während des Zivildienstes in einer Pfarrei beschäftigt. Da wurde der Pfarrer von sogenannten Atheisten schreiend ins Krankenhaus geholt, wenn der Tumor im Endstadium war. Ich glaube, ob man Atheist ist, kann man erst auf den letzten Metern sagen.‘
… no comment