Gesoffen hat schon unser Steinzeit-Urgroßvater
Im Wodka-Galopp durch zehntausend Jahre Vollrausch-Historie: Was hat Lidschatten mit Weinbrand zu tun? Kurze-Geschichte-des-Alkohol-Kolumne vom regelmäßigen AA-Besucher Henning Hirsch.
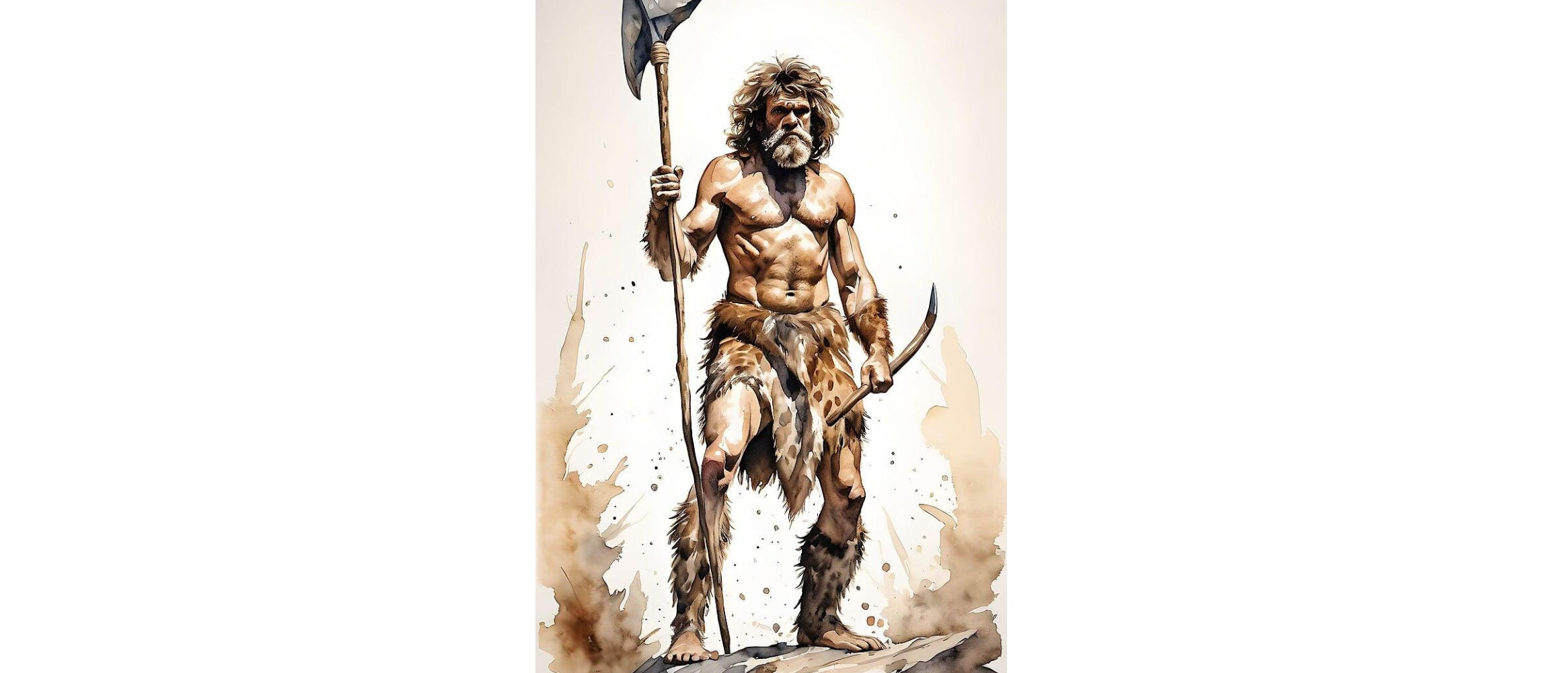
Wir alle wissen, dass sich bereits der Cro-Magnon-Mensch abwechselnd mit vergorenen Früchten und halluzinogenen Pilzen berauschte. Da unsere Steinzeitvorfahren Früchte und Pilze jedoch nicht ganzjährig fanden und einsammelten und der Kühlschrank noch nicht erfunden worden war, stellten absichtlich herbeigeführte ekstatische Bewusstseinszustände in der Mittelsteinzeit die Ausnahme und nicht die Regel dar. Saufen bzw. vergorene Früchte futtern war ein Sommer- bzw. Herbstsaisongeschäft. In der dunklen Jahreszeit sah’s damit eher mau aus.
Das änderte sich schlagartig, als unsere Ururururgroßeltern die Vorzüge der Landwirtschaft für sich entdeckten und ihr ständiges Umherreisen an den Nagel hängten. Die Geschichtswissenschaft bezeichnet diesen Vorgang des allmählichen Sesshaftwerdens unserer Vorfahren als Transformation der Jäger und Sammler, die auf der Suche nach Nahrung 24/7 in Bewegung waren, in Bauern, die mit ihrer Hände Arbeit dem Boden einen ganzjährigen Ertrag abtrotzten, dafür jedoch an ihrer Scholle festkleben mussten. Vorbei war es mit Rumstreunerei und Lagerfeuerromantik. Der Bauer blieb in Sichtweite seines Feldes und wurde zum erbitterten Feind des Nomaden. Dieser weltgeschichtlich superwichtige Vorgang, die sogenannte neolithische Revolution, trug sich vor ca. 12000 Jahren zu.
Unseren Steinzeit-Landwirt-Vorfahren gelang es, eine Urform der Gerste zu kultivieren und anzubauen, bei deren Lagerung sie feststellten, dass das zerkleinerte Getreide zu keimen und zu mälzen begann. Von dort bis zur gewerbsmäßigen Braukunst war es nur noch ein kleiner Schritt, der allerdings ein paar hundert Jahre gedauert haben dürfte. Gebraut wurde alles, was sich in Alkohol verwandeln ließ: Gerste, Emmer, Weizen, Honig, sogar Reis (in China). Hauptsache, der Stoff schmeckte einigermaßen, war nicht toxisch und entfaltete ein angenehmes Säuselgefühl in der Nebenhirnrinde. Die immer noch herumwandernden Nomaden, die keine Gerste kultivierten und in der Konsequenz nichts zusammenbrauen konnten, mussten sich derweil mit vergorener Stutenmilch begnügen.
Von den Sumerern in Mesopotamien – das sind die, denen wir das alkoholgeschwängerte Gilgamesch-Epos, die ersten Schriftzeichen und eine Menge in Tontafeln eingeritzte Kneipenwitze verdanken – gelangte die Braukunst an den Nil, wo die Pharaonen jahrtausendelang das Staatsmonopol der Herstellung für sich beanspruchten. Gerstenbier wurde jeden Tag getrunken, allerdings zu festen Uhrzeiten und in zugeteiltem Quantum. Ob Alkoholismus bereits im frühen Altertum bekannt war, wissen wir aufgrund mangelhafter Quellenlage nicht genau; es steht jedoch zu vermuten, dass sich nicht jeder brave Bürger an die oben genannten festen Uhrzeiten und sein zugeteiltes Quantum hielt. Wie damals entgiftet wurde? Keine Ahnung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit kalt und mit ungewissem Ausgang.
Wein, ein Geschenk der Götter
Kurz auf das erste Bierbesäufnis folgte die Entdeckung des Kelterns: Weintrauben mit den Füßen zerstampfen und die so gewonnene Matschepampe (fachmännisch Maische genannt) ein paar Tage nicht anrühren. Dann erneutem Druck aussetzen, um den Most vom Trester zu trennen. Den süß-klebrigen, dickflüssigen Saft in Fässer bzw. Tonkrüge füllen, diese hermetisch verschließen und das Ganze wiederum ein paar Wochen ziehen lassen, was man als Gärvorgang bezeichnet. Nun schmeckte das Zeug, dem man zwecks Verstärkung vor der Gärung noch Zucker beimischen kann, endlich nach Wein und wirkte auf Sensorik und Artikulationsfähigkeit unserer Vorfahren um einiges heftiger als das eher harmlose Volksgesöff Bier, weshalb man den Wein auch als Geschenk der Götter deklarierte.
Götter hin oder her – konsumiert wurde Wein quer durch alle Gesellschaftsklassen. Bei den zahlreichen Feiern zu Ehren noch zahlreicherer Gottheiten konnte der Konsum schon mal aus dem Ruder laufen, was dann in den berühmt-berüchtigten dionysischen Orgien endete. Die Ägypter kannten beispielsweise das Fest der Trunkenheit, das sie alljährlich zu Ehren der löwenköpfigen Göttin Hathor zelebrierten. Mit dem ausdrücklichen Segen der Priester, sich eine Nacht lang zu betrinken, bis die Lampen in den Tempeln erloschen und die Sinne der entrückten Gläubigen schwanden. Der Tag darauf war von Katzenjammer und zerknirschten Gebeten bestimmt, neun Monate später stieg die Geburtenrate steil an.
Von der häufigen Teilnahme an solchen Feierlichkeiten bis zum Gewohnheitssuff war es nicht weit. Meine These: Im Altertum wimmelte es von Alkis, die jedoch, weil damals Jellinek-Fragebogen und ICD-11-Katalog der WHO noch nicht erfunden worden waren, weder korrekt klassifiziert noch medizinisch sauber therapiert wurden. Im Zweifelsfall starben diese antiken Schluckspechte eben früh. Besonders alt wurde damals ja sowieso niemand. Wie wir unschwer erkennen, stellt die Alkoholherstellung das drittälteste Gewerbe der Welt dar. Die beiden noch älteren kennen Sie; nur so viel: Das älteste ist die Politik. Es gibt sogar Historiker, die steif und fest behaupten, der eigentliche Grund des Sesshaftwerdens der Jäger und Sammler hätte darin bestanden, dass sie als Bauern nun ganzjährig Bölkstoff produzieren und sich hinter die Binde kippen konnten. Die Gier nach Alkohol als Motor der menschlichen Zivilisation.
Vom Lidschatten zum Schnaps
Woher stammt das Wort Alkohol? Im Arabischen bezeichnete man im frühen Mittelalter mit al-kuhl ein feines kosmetisches Pulver, das man zum Einfärben von Augenbrauen, Wimpern und Lidern benutzte. Über die Zwischenstation Spanien, wo man al-kuhl, um es melodischer betonen zu können, in al-kuhúl abwandelte, reiste der Begriff weiter nach Norden, wurde im 16. Jahrhundert vom großen Arzt und Alchemisten Paracelsus, der auch ein großer Trinker war, aufgeschnappt und von ihm als Synonym für das Feine, Subtile in unseren Wortschatz eingeführt. Alcohol vini als das reine, feine Destillat des Weins, der Weinbrand. Was für eine enorme Umformung liegt hinter diesem Begriff: vom Lidschatten zum Schnaps! In diesem Fall jedoch halbwegs plausibel, weil die alten Araber auch die Kunst des Destillierens erfunden hatten. Zwar ursprünglich zu medizinischen Zwecken; aber medizinischen Zwecken dienten anfangs auch Opium, Morphium und LSD. Vom medizinischen Zweck zur süchtig machenden Droge ist es oft nur ein winziger Schritt.
Die Germanen waren chronische Schluckspechte
Trinkalkohol ist eine sogenannte Kulturdroge. Mit diesem Ausdruck bezeichnet man Rauschmittel, die schon die Götter gerne zu sich nahmen. Jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat, weiß, dass an der ewig gedeckten Tafel in Walhalla der Met aus Krügen – und nicht aus kleinen Bechern – gesoffen wurde. Tacitus beschreibt in seinem Büchlein „Germania“ die Trinksitten unserer Urururgroßeltern. Er berichtet von in Bier getauchten Schnullern für die Säuglinge, von Gelagen, die im Komasuff endeten, von Ratsversammlungen, die wiederholt werden mussten, weil sämtliche Teilnehmer im Moment der Beschlussfassung betrunken waren. Für barbarisch hielten Römer und Griechen die germanische Angewohnheit, Wein pur – also nicht mit Wasser gemischt – zu konsumieren.
Im christlichen Mittelalter wird es nicht besser: Die Erfindung der Kunst des Brennens – also Hochprozentiges aus dem Rebensaft herauszufiltern, in süditalienischen klösterlichen Alchemieküchen ausgeheckt – machte es noch schlimmer. Nun war plötzlich aqua vitae, „Wasser des Lebens“, so lautete der beschönigende Ausdruck für Branntwein, in der Welt. Der Adel feierte rauschende Feste, die erst dann als hip galten, wenn am Ende alle Gäste betrunken auf dem Boden lagen. Mönche brauten Starkbier, um in der Fastenzeit nicht verhungern zu müssen. Unzählige Jesuserscheinungen von Nonnen sind auf den übermäßigen Genuss von Kräuterlikör zurückzuführen. Der Alkoholkonsum der unteren Gesellschafsschichten beschränkte sich auf die Fest- und Feiertage: Die waren allerdings häufig und die Besäufnisse heftig.
Deutschland immer weit vorne in der internationalen Alkoholstatistik
Der endgültige Siegeszug des Teufelszeugs Schnaps fällt zeitlich in etwa zusammen mit dem Start der industriellen Revolution. Gewerbefreiheit, stark vermehrte Vergabe von Schanklizenzen im Verein mit der Erfindung, Kartoffeln in Wodka zu verwandeln, ließen die Preise für Hochprozentiges stark fallen. Jeder Bauer, Industriearbeiter und Tagelöhner konnte sich nun in den billigen Rausch flüchten. Die Chronisten berichten ab 1830 von einer neuen Volksseuche, die sie als Branntweinpest und Elendsalkoholismus geißeln und die in erschreckendem Ausmaß und mit großer Geschwindigkeit um sich griff. Ganze Landstriche verarmten und ergaben sich dem Suff.
In der Gründerzeit wird nochmals eine ordentliche Kelle draufgekippt: Der Pro-Kopf-Konsum erreichte zwölf Liter reinen Alkohol pro Jahr. Produktionsbedingte Engpässe kombiniert mit hoher Besteuerung ließen den Verbrauch nach dem ersten Weltkrieg auf fünf – 1923 während der großen Inflation sogar nur drei – Liter absinken. Mit der wirtschaftlichen Gesundung Deutschlands in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts stieg auch das Verlangen nach Bier, Lambrusco, Weinbrand und klebrigen Cocktails schnell wieder an: von 4,0 Litern Reinalkohol (1950) über 9,4 (1960), 14,4 (1970) bis zum vorläufigen Maximum 16,7 (1976). Danach sinken die Werte bis heute ab: 15,0 (1980), 13,4 (1990), 12,0 (2000) auf aktuell 10,7 Liter (Quellen: DHS sowie ältere Ausgaben der „Jahrbücher zur Alkohol- und Tabakfrage“. Zahlenvor 1950 auf alle Einwohner bezogen. Danach eingegrenzt auf die Altersgruppe 15plus).
MERKE
Alkohol ist neben Pilzen die älteste dem Menschen bekannte psychotrope Substanz. Daraus scheint sich in einigen Kulturkreisen ein Gewohnheitsrecht herausgebildet zu haben, ihn in zum Teil gesundheitsschädigender Weise konsumieren zu dürfen, ohne dass der Gesetzgeber regulativ eingreift.

Schreibe einen Kommentar