Vor etwa zehn Jahren war Südamerika im Aufwind. Hohe Weltmarktpreise für Rohstoffe und landwirtschaftliche Erzeugnisse spülten in nie gekanntem Umfang Geld in die chronisch leeren Staatskassen. Und überall – die Ausnahme war Kolumbien – kamen mehr oder weniger linke Regierungen an die Macht, die den Geldsegen nutzten, um Sozialprogramme aufzulegen und ihrer Wählerklientel ein schönes Bündel an Wohltaten zukommen zu lassen. Einige taten dies ohne Sinn und Verstand, das chavistische Venezuela und das von dem Ehepaar Kirchner regierte Kirchner waren hier vorn dabei. Andere, etwa die sozialdemokratischen Regierungen von Brasilien und Uruguay, gingen sinnvoller vor und legten bei ihren Projekten mehr Wert auf Nachhaltigkeit.
Inzwischen sind die Rohstoffpreise soweit in den Keller gegangen, dass alle Staaten des Subkontinents, bis eben auf Kolumbien und das wirtschaftlich breiter aufgestellte Chile, massiv in die Krise geraten sind. Mancherorts hat auch die politische Richtung gewechselt. In Brasilien, Paraguay und Peru regieren inzwischen liberale oder konservative Präsidenten. Bolivien und Ecuador gelten derzeit als extrem polarisiert.
Südamerika an der Wegscheide
In Ecuador, wo kürzlich ein Epigone des Linkspräsidenten Rafael Correa die Stichwahl hauchdünn gegen einen liberalen Unternehmer gewonnen hat, ist die Lage inzwischen ähnlich angespannt wie in der Türkei. Nachdem die Opposition den herrschenden Sozialisten Wahlbetrug vorgeworfen hatte, stimmte der nationale Wahlrat zu, 1,3 Millionen Stimmen am heutigen Dienstag neu auszählen zu lassen. Bringt das Nachzählen keine Klarheit in die eine oder andere Richtung, drohen dem Andenstaat quälende Monate harter politischer Konfrontation.
Auch Bolivien, wo der listenreiche indigene Präsident Evo Morales, lange Zeit weitgehend unangefochten regierte, könnte stürmischeren Zeiten entgegen gehen. Nachdem die Bolivianer ihrem Staatschef im vergangenen Jahr die erneute Verlängerung seiner Amtszeit verweigert hatten, will Morales bald schon einen neuen Anlauf zur Dauerherrschaft nehmen. Die Opposition will das nicht widerspruchslos hinnehmen. Harte Konflikte drohen auch mit Umweltschützern bei einigen großen Infrastruktur- und Entwicklungsprojekten. Zudem ist Morales gesundheitlich angeschlagen. Aktuell hält sich der Linkspolitiker zu einer Stimmband-Operation im kubanischen Havanna auf.
Argentinischer oder venezolanischer Weg?
Die für die Zukunft Südamerikas entscheidenden Entwicklungen finden derzeit aber in Venezuela und Argentinien statt. Über Venezuela haben wir an dieser Stelle ausgiebig geschrieben. Die wirtschaftliche und soziale Lage ist derart desolat, dass selbst einst treue Anhänger der linksnationalistischen Chavistas die Nase voll vom unfähigen Staatschef Nicolas Maduro und seinem planwirtschaftlichen Voodoo haben. Nur mit Gewalt, Unterdrückung und juristischen Tricks kann sich das Regime noch an der Macht halten. Bei freien Wahlen indes müssten die Chavistas mit Ergebnissen unter 10 Prozent rechnen. Maduro & Co. sind aber bereit, ihre Macht mit den Waffen verteidigen zu lassen. Die Führung der Armee und der „Colectivos“ genannten Schlägertrupps umhegt Maduro deshalb mit allerhand Privilegien. Kommt das Regime mit seinem „Putsch von oben“ durch, dann könnten sich andere Regierungen der Region bestärkt darin sehen, ebenfalls auf Autokratie und Militärherrschaft zu setzen. Ein ganzer Kontinent droht dann in die dunklen Zeiten des Schweinezyklus aus Demokratie, Diktatur und zeitweiliger Rückkehr zur Demokratie zurückzukehren.
Das andere Schlüsselland Argentinien geht den umgekehrten Weg. Ausgerechnet dem Mutterland des Populismus hat der seit November 2015 amtierende Präsident Mauricio Macri eine Wurzelbelbehandlung verordnet – und das ohne schonende Narkose. Argentinien war bis in die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts reich, unglaublich reich. Manche nannten es das reichste Land der Welt. Dann kam der schillernde General Juan Domingo Peron an die Macht. Zusammen mit seiner noch schillernderen – und inzwischen noch berühmteren ersten Ehefrau Eva, besser bekannt als „Evita“ – gab er den Engel der Armen.
Peronisten machten sich Land zur Beute
Die Perons lenkten Gelder in Sozialprojekte um, die aber wenig nachhaltig waren, gleichzeitig aber ihre Klientel in Abhängigkeit hielten. Noch dazu plünderten das Paar und ihr Umfeld die Staatskasse für private Extravaganzen. Um die argentinische Wirtschaft gegen die widrigen Winde von Wettbewerb und Markt abzuschotten, wurden die Märkte über die Maßen reguliert und Unternehmen verstaatlicht. Es entstand ein System unproduktiver Betriebe und willfähriger Gewerkschaften, die alle mit Mitgliedern der peronistischen Partei durchdrungen wurden. Der linksnationale Peronismus wurde so de facto zur argentinischen Staatsideologie, die peronistische Partei zum allmächtigen Machtfaktor im Land.
Obwohl Argentinien im Laufe der Jahrzehnte immer ärmer wurde, blieb die Herrschaft der Peronisten unangefochten. Nur wenige Jahre regierten Nichtperonisten, Putschgeneräle ebenso wie demokratische Politiker. Keiner jedoch wagte es, allzu weit vom protektionistischen Wirtschaftsmodell abzuweichen. Geschah dies doch einmal, dann musste der Verantwortliche – wie der unglückliche Fernando de la Rua – schon einmal mit dem Hubschrauber aus dem Präsidentenpalast flüchten. Dabei durfte de la Rua nur die Suppe ausbaden, die ihm sein auf großem Fuß lebender, peronistischer Vorgänger, Carlos Menem, eingebrockt hatte.
Burgfrieden hält nicht mehr
So herrschte weitgehend Skepsis, als Macri, ein früherer Unternehmer und Kommunalpolitiker, versprach, das Land mit marktwirtschaftlichen Reformen wieder flott zu machen. Die Allmacht der peronistischen Partei und den mit ihr verbündeten Gewerkschaften galt als zu stark. Allerdings war ausgerechnet die sprunghafte und chaotische Amtsführung seiner unmittelbaren Vorgängerin Cristina Fernandez de Kirchner Macris beste Starthilfe. Selbst den eingefleischtesten Peronisten muss am Ende der Kirchner-Ära klar gewesen sein, dass ein Kurswechsel unvermeidlich war. International galt Argentinien als nicht mehr kreditwürdig und zuhause lag die Industrie, gefangen im Korsett vom Staat oktroyierter Preise, endgültig am Boden. Die Vernünftigen unter den Peronisten erkannten die Notwendigkeit von Reformen; die Strategen unter ihnen wollten, dass der Saustall zumindest wieder einmal ausgemistet wird, bevor man wie gewohnt weiter machen konnte. Deshalb zwang die peronistische Partei Ihrer Chefin Fernandez de Kirchner mit Daniel Scioli einen relativ gemäßigten Mann als Nachfolgekandidat auf. Der allerdings verlor gegen Macri – und manchem Peronisten erschien es plötzlich sogar kommoder, dass ein Nichtperonist die Aufräumarbeiten durchführt, als sich selbst mit liberalen Reformen unbeliebt zu machen.
Auch deshalb konnte Macri einen Deal mit dem Peronismus machen. Stillhalten im ersten Jahr gegen das Versprechen, dass es bald wieder wirtschaftlich aufwärts gehe. Der neue Staatschef hatte sich Zeit herausverhandelt, allerdings nicht allzu viel davon. Dieser Pakt mit dem Gegner erklärt wohl, dass die Agenda des früheren Bürgermeisters von Buenos Aires noch konsequenter ausfiel, als dies Freunde und Gegner erwartet hatten. Im Eiltempo gab er den Wechselkurs des Peso frei, öffnete das Land wieder für die Weltmärkte und senkte Exportsteuern auf landwirtschaftliche Erzeugnisse. Gleichzeitig einigte sich der Liberale mit den Kapitalgebern, die Fernandez de Kirchner noch als Geier („buitres“) beschimpft hatte. Argentinien war plötzlich wieder kreditfähig.
Mit Schocktherapie aus der Krise
Auf der anderen strich Macri Subventionen für Energiepreise und den Nahverkehr. Und so stiegen die Ausgaben für die Durchschittsargentinier auf breiter Front, während sie nach der Abwertung des Peso faktisch weniger Geld in der Tasche hatten. Die Rechnung des Präsidenten dagegen lautete wie folgt: Je härter die Rosskur, desto schneller sollte der Patient Argentinien genesen. Je attraktiver das Land für ausländische Investoren würde, desto schneller sollte der Konjunkturmotor anspringen. Begleitet hat der Staatschef sein Reformprogramm mit einer Art Roadshow. Internationalen Geldgebern pries er sein neues Argentinien ebenso an, wie den mächtigen Staatschefs in den USA, Europa und China. Zuletzt sprach der Präsident auf einem Weltwirtschaftsforum für Lateinamerika in Buenos Aires, später im Jahr soll Macri die Präsidentschaft über die G20 übernehmen.
Das wahre Leben ist aber kein volkswirtschaftliches Lehrbuch. Zudem sind die strukturellen Probleme Argentiniens zu groß, als dass sie sich mit nur einem Jahr Schocktherapie kurieren lassen. Zumal die Auswirkungen der ersten Reformschritte die soziale Situation im Land, erwartungsgemäß, zunächst noch einmal verschärft haben. Nach der Freigabe der Märkte gingen unproduktive Betriebe pleite; viele Argentinier sind angesichts steigender Preise von noch mehr Armut bedroht. Wenn im Oktober ein Teil des Parlaments neu gewählt wird, könnten Macris Gegner triumphieren. Der Präsident droht dann, eine „lame Duck“ zu werden.
Land muss neu aufgebaut werden
Es muss aber nicht so kommen. Mut macht ausgerechnet ein Generalstreik des peronistischen Gewerkschaftsdachverbandes CGT, der allem Anschein nach den Burgfrieden mit Macri aufgekündigt hat. Obwohl beide Seiten in den rhetorischen Angriffsmodus umgeschaltet haben, blieb der Streik hinter den Erwartungen zurück. Anders als in früheren Zeiten schlossen sich, insbesondere im Privatsektor, nicht alle Betriebe dem Gewerkschaftsaufruf an. Offenbar sind mehr Argentinier als gedacht bereit, ihrem Präsidenten weiter Kredit zu geben.
Das ist im Prinzip auch richtig. Soll das Land wirklich zu ökonomischer Leistungsfähigkeit zurückkehren, dann sind Reformen à la Macri in der Tat „alternativlos“. Vielleicht sind die Argentinier auch bereit, einem zu glauben, der ihnen zunächst nur Schweiß und Tränen verspricht. Mit seinen Vorgängern, die jeweils ein Schlaraffia und allerhand soziale Benefits in Aussicht gestellt hatten, haben sie ja bereits ausreichend Schiffbruch erlitten.
Beinahe 70 Jahre peronistische Dominanz haben nicht nur die wirtschaftliche Basis Argentiniens zerstört, sondern dem Land auch gesellschaftspolitisch und kulturell eine verhängnisvolle Richtung gegeben. Sollen künftige Generationen in Argentinien wieder vernünftige Perspektiven haben, dann muss Macri nichts Geringeres tun, als den Staat komplett neu zu erfinden. Gelingt ihm dies, könnten sich auch andere Regierungen der Region ermutigt fühlen, diesen schwierigen, aber wohl nachhaltigen Weg zu gehen.
Macri kämpft
Dennoch tanzt Macri weiter auf dem politischen Hochseil. Irgendwann endet auch die Geduld seiner treuesten Anhänger, irgendwann ist die Leidensfähigkeit des Mittelstandes zu Ende. Daher braucht Macri schnelle Erfolge – und wenn es nur solche sind, die sich am Horizont abzeichnen. Denn die Argentinier haben nicht nur den Populismus erfunden, sondern auch das, was man inzwischen postfaktisch nennt. Gefühle und Erwartungen zählen bei ihnen schon lange mehr als Fakten.
Und noch etwas hilft dem Reformer vom Rio de la Plata: Die Argentinier sind stolz! Dass Sie einen Präsidenten haben, der Kampfgeist zeigt und sein Programm zur Not auch gegen den mit dem Peronismus sympathisierenden argentinischen Papst verteidigt, das imponiert ihnen. Und während im lange Zeit beneideten Brasilien ein unpopulärer Interimspräsident Michel Temer vor allem durch Intrigen und Skandale auffällt, ist Macri zumindest für die Liberalen des Kontinents eine Art Idol und Hoffnungsträger geworden – und so etwas schmeichelt selbst seinen eher links verorteten Landsleuten.
Argentinier stolzes Volk
Auch im fernen Europa fällt Macris Kurs auf. Während Populisten von links und rechts hier vor der Globalisierung warnen, gegen das CETA-Abkommen mit Kanada agitieren, den Freihandel einschränken wollen und nach noch höheren Steuern und noch mehr Staat rufen, macht Macri ausgerechnet in Argentinien das genaue Gegenteil davon.
Sollte der Mann mit seinem Programm wirklich scheitern, dann kann ihm niemand fehlenden Mut oder fehlende Courage vorwerfen. Auf einer Seite, die den Untertitel „Persönlich, Parteiisch, Provokant“ trägt, sei es dem Autor verziehen, wenn er Macri und seinem Land baldige Erfolge wünscht.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

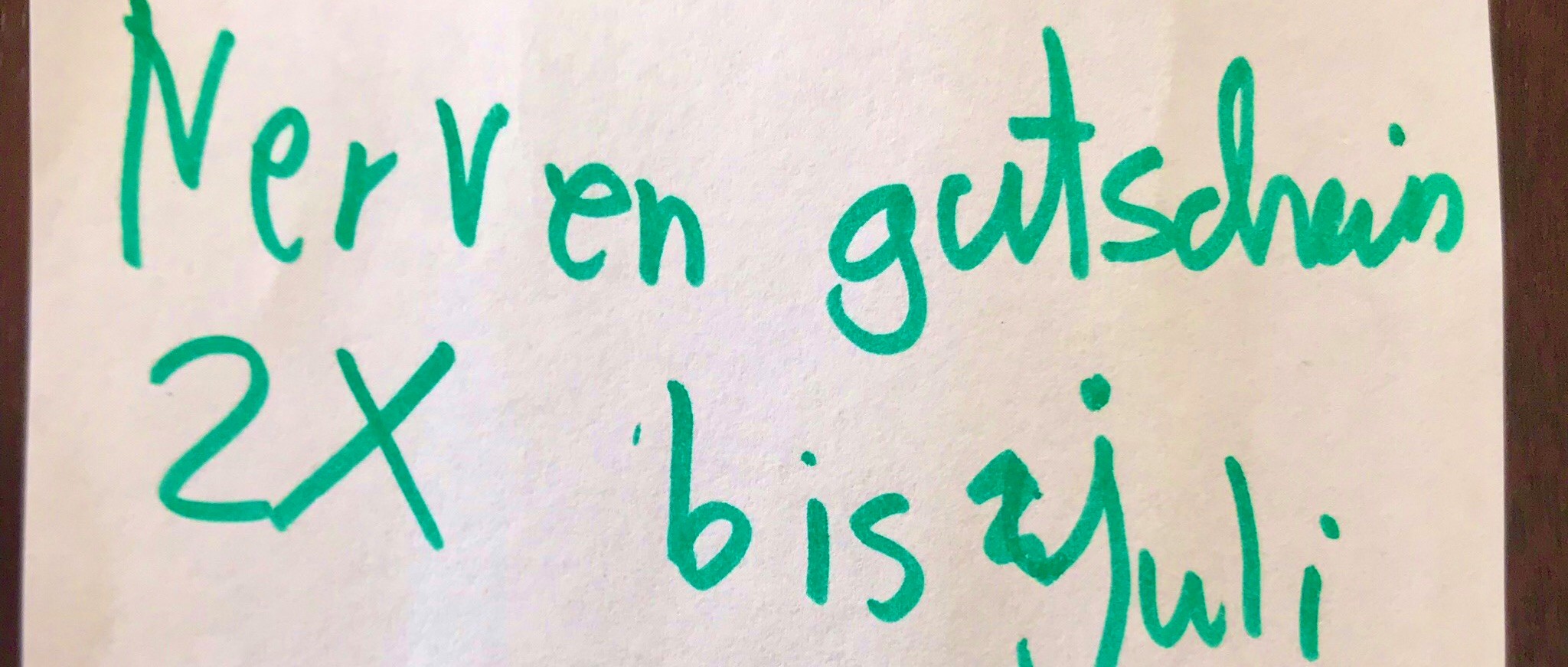

Luciana Berardo
super artikel es hat wirklich nichts geierhaftes wenn man staatsanleihen fuer 49 milionen aufkauft von anlegern welche fuer jeden investierten dollar schon 4 dollar zins kassierten und das ding dem ehrenweten paul singer verkauften welcher nun von argentinien ueber 800 milionen gekriegt hat weil er halt gute beziehungen zu presse und gerichten hat…dieser ehren hafte investor hat ja mit diesem geschaeftsmodell 120 mal aermste staaten verklagt und so nebenbei ein paar politiker reicher gemacht und die armut ein wenig dezimiert (es gibt weniger arme weil viele das gar nicht ueberlebten) traditioneller weise ist suedamerika auch ne kolonie wie afrika auch doch das haben halt die wenigsten begriffen ….
irgendjemand muss ja fuer den westlichen lebensstil auf kommen!!
frohe ostern!