Damals hatten die Mittelmächte das besiegte Russland zum Verzicht auf beinahe alle Territorien gezwungen, die das Land seit etwa Mitte des 17. Jahrhunderts an seiner westlichen Peripherie angegliedert bzw. erobert hatte – dazu gehörte auch die Ukraine. Obwohl Russland keinen Krieg verloren habe, existiere es aber seit 1991 erneut in den Grenzen des Brest-Litowsker Friedens, so Surkow. Diesen Zustand hält Surkow für unhaltbar. Einige Tage später erfolgte die Anerkennung der Unabhängigkeit der ostukrainischen Separatistengebiete durch Moskau und am 24. Februar begann der großangelegte russische Angriff auf die Ukraine. In gewisser Weise wiederholen sich jetzt im postsowjetischen Raum Entwicklungen, die vor dreißig Jahren in Jugoslawien stattfanden, und die man zur Zeit der Auflösung der Sowjetunion noch verhindern konnte. Warum ließ sich das „jugoslawische Szenario“ zur Zeit des Zerfalls der UdSSR vermeiden und warum wird es jetzt wieder aktuell?
Die „zweite“ russische Demokratie vs. das Milošević-Regime
Die Tatsache, dass die Auflösung der Sowjetunion nach dem Scheitern des kommunistischen Putschversuchs vom August 1991 beinahe friedlich verlief, rief allgemeines Staunen der Weltöffentlichkeit hervor. Dies nicht zuletzt deshalb, weil vergleichbaren geopolitischen und sozialen Umwälzungen bisher nicht selten verheerende Kriege und blutige Revolutionen vorausgegangen waren. Dieses Staunen wurde durch die Tatsache verstärkt, dass etwa zur gleichen Zeit ein anderer kommunistischer Vielvölkerstaat, nämlich Jugoslawien, einen Zerfallsprozess erlebte, der nach einem geradezu entgegengesetzten Szenario verlief. Diese Unterschiede waren eng mit der inneren Beschaffenheit der politischen Systeme verbunden, die sich damals einerseits in Belgrad, andererseits in Moskau etabliert hatten. Das rückwärtsgewandte, autoritäre und radikal nationalistische Regime von Slobodan Milošević, das mit Gewalt großserbische Ambitionen auf dem Territorium des sich auflösenden Jugoslawiens zu verwirklichen suchte, unterschied sich grundlegend von dem erneuerten Russland, dessen Konturen seit der Augustrevolution von 1991, also noch vor der Auflösung der UdSSR, immer sichtbarer wurden. Es handelte sich hierbei um ein Gemeinwesen, in dem reformorientierte und prowestliche Kreise dominierten. Boris Jelzin – die damalige Symbolfigur der russischen Demokratie – bezeichnete Mitte 1992 die westlichen Länder als die „natürlichen Verbündeten Russlands“. Natürlich handelte es sich bei der im August 1991 errichteten „zweiten“ russischen Demokratie um ein labiles und krisengeschütteltes Gebilde, das nicht zuletzt wegen der wirtschaftlichen Schocktherapie, der allgegenwärtigen Korruption und der scharfen Konflikte an der Spitze der Machtpyramide unentwegt erodierte. Dessen ungeachtet blieb der pluralistische Charakter des Staates in der Jelzin-Ära auch weiterhin im Wesentlichen bestehen. Der im Dezember 1994 begonnene Krieg gegen das abtrünnige Tschetschenien sollte daran nicht allzu viel ändern: „Wir sagen heute, was wir wollen, wir lesen, was wir wollen, und das ist, glauben Sie mir, nicht wenig“, sagte im Mai 1995, also ein halbes Jahr nach dem Beginn des Tschetschenienkriegs der vor kurzem verstorbene Menschenrechtler Sergej Kowaljow, der als „das Gewissen Russlands“ galt.
Die Politik der Regierung befand sich damals unter einem ununterbrochenen Beschuss der Öffentlichkeit und der Medien. Und nicht zuletzt unter dem Druck der Öffentlichkeit suchte die Regierung nach Wegen, den Krieg zu beenden, ohne dabei einen allzu großen Gesichtsverlust zu erleiden. So wurde im September 1996 in der nordkaukasischen Stadt Chassawjurt nach mehreren Wochen zäher Verhandlungen ein Abkommen unterzeichnet, das zwar ein Provisorium darstellte – die Frage nach dem endgültigen Status von Tschetschenien wurde bis zum Jahr 2001 verschoben – der Krieg wurde aber durch dieses Abkommen faktisch beendet.
Die „gelenkte Demokratie“ Wladimir Putins und die „farbigen Revolutionen“
Als Wladimir Putin nach seiner Wahl zum russischen Staatspräsidenten sein System der „gelenkten Demokratie“ zu etablieren begann, versuchte er vergleichbare Entwicklungen, die seinerzeit zum Abkommen von Chassawjurt geführt hatten, um jeden Preis zu verhindern. Der Gesellschaft sollte jede Möglichkeit genommen werden, die Politik der Regierung zu beeinflussen. Beinahe alle gesellschaftlichen Kontrollmechanismen, die sich im Lande in der Gorbatschow- und in der Jelzin-Zeit entwickelt hatten, wurden im Laufe der nächsten Jahre weitgehend demontiert. Die Verfechter der „gelenkten Demokratie“ schienen nach der Devise ihres autokratischen Vorgängers Nikolaus I. zu handeln, der meinte, die Gesellschaft solle lediglich gehorchen und dürfe sich nicht in die Angelegenheiten der Regierung einmischen. Ob dieses vormoderne Politikverständnis mit dem Zeitgeist der Moderne auf Dauer vereinbar ist, ist aber zu bezweifeln. Denn die Sehnsucht nach einer „Rückkehr Russlands nach Europa“ hört auch heute nicht auf, Teile der russischen Gesellschaft zu inspirieren. Deshalb verschärft die Kremlführung ihren ohnehin repressiven Kurs und versucht die regimekritischen Gruppierungen gänzlich von der politischen Bühne zu verbannen. Vertreter des freiheitlichen Russland scheinen bei ihr ähnliche Ängste hervorzurufen, wie dies seinerzeit die Dekabristen bei ihren zarischen Vorgängern getan hatten. Diese Ängste verstärkten sich insbesondere nach dem Sieg der farbigen Revolutionen in der Ukraine, insbesondere nach dem Sieg des „Euromaidan“, der für die Verfechter der „gelenkten Demokratie“ in Moskau einen wahren Schock darstellte. Sie waren sich darüber im Klaren, dass der demokratische Aufbruch in einem Land, das mit Russland sprachlich und kulturell so eng verwandt ist, an der Grenze der Ukraine nicht stehen bleiben würde. Daher auch ihr Versuch, die Ukraine zu destabilisieren und zu spalten, nicht zuletzt durch die Annexion der Krim, die im März 2014 erfolgte.
Boris Nemzows hellsichtige Prognose
Über die verhängnisvollen Folgen, die die Krim-Annexion für Russland haben sollte, reflektierte bereits kurz nach diesem Ereignis der am 27. Februar 2015 ermordete Regimekritiker Boris Nemzow. In einem Interview mit der regierungskritischen Zeitung „Nowaja Gaseta“ sagte er Folgendes:
„Putin hat (durch die Annexion der Krim) einen taktischen Erfolg erzielt. … Sein Rating hat nun eine schwindelnde Höhe erreicht. Es herrscht eine allgemeine Hysterie und Euphorie. Strategisch aber hat er alles verloren“.
Die Folgen dieses strategischen Fehlers würden gravierend sein, setzte Nemzow seine Ausführungen fort. Auf Russland käme nun der Verlust der Märkte in Europa und in Amerika, wirtschaftliche Erschütterungen, Arbeitslosigkeit und eine zunehmende technologische Rückständigkeit zu. Die im Kreml gehegte Hoffnung, China werde den Verlust der westlichen Märkte kompensieren, hielt Nemzow für eine völlige Illusion. China werde seine Monopolstellung dazu ausnutzen, um die Preise für die russischen Energielieferungen massiv nach unten zu drücken. Abgesehen davon stelle eine allzu starke Abhängigkeit von China eine große Gefahr für die territoriale Integrität Russlands dar. Die umfassenden territorialen Ansprüche Pekings in Bezug auf Sibirien und den russischen Fernen Osten seien bekannt.
Nemzow war davon überzeugt, dass Putin all diese Gefahren kannte. Warum hatte er sich dann zu einer für Russland derart riskanten Politik entschlossen? Nemzows Antwort auf diese Frage ist eindeutig. Es gehe Putin keineswegs um die Verteidigung der Interessen der Russen auf der Krim. Diesbezügliche Erklärungen des Präsidenten stellten ein reines Pharisäertum dar. Was Putin in erster Linie interessiere, sei die Sicherung seiner Macht – so lautete das Fazit eines der prominentesten Gegner des Kreml-Herrschers.
Die hellsichtige Analyse Nemzows hat ihre Aktualität auch nach 8 Jahren nicht eingebüßt. Wie Nemzow dies bereits im April 2014 feststellte, geht es Putin bei seiner Ukraine-Politik in erster Linie um die „Sicherung seiner Macht“ und nicht um die Verteidigung der Interessen der russischen Minderheit in der Ukraine. Sein Handeln wird also in erster Linie durch den Primat der Innenpolitik bestimmt. Nicht die Panzer der NATO, sondern die europäischen Ideen, die sich in der Ukraine nach 2014 durchgesetzt haben, rufen bei der Kremlführung panische Ängste hervor. Dies wird aber von Putin hartnäckig geleugnet. In seiner Rede, die den Angriff Russlands auf die Ukraine begründete, sprach er von folgenden Zielen Moskaus: „die Entmilitarisierung und die Entnazifizierung (sic!) der Ukraine“. Dies sagt Putin über ein Land, in dem die rechtsradikalen Parteien bei allen Wahlen, die nach 2014 stattfanden, immer wieder verheerende Niederlagen hinnehmen mussten und dessen Präsident ein Jude ist!
Pikanterweise bezeichnete Putin in der gleichen Rede den „von den USA gebildeten westlichen Block“ als „Imperium der Lüge“.
Putins Russozentrismus
Die rücksichtslose Machtpolitik im Namen der sakralisierten nationalen Interessen, die die Putin-Riege verfolgt, wirkt im postnationalen Zeitalter, das in Europa nach dem verheerenden „Zweiten Dreißigjährigen Krieg“ (1914-1945) angebrochen war, derart antiquiert, dass Russland nun erneut Gefahr läuft, den Anschluss an die Moderne zu verlieren. Aber nicht nur das. Dem Land droht eine beispiellose außenpolitische Isolation, die in gewisser Hinsicht an die Konstellation erinnert, die sich am Vorabend des Krimkrieges (1853-1856) ergeben hatte, als sich gegen die Hegemonialbestrebungen des Zarenreiches nicht nur die Westmächte und die Türkei, sondern auch der ehemalige Verbündete Russlands, das Habsburger Reich, wandten. Was das Ausmaß der heutigen Isolierung Russlands anbetrifft, so konnte man sich davon bereits bei der Abstimmung in der UNO-Vollversammlung zur territorialen Integrität der Ukraine überzeugen, die kurz nach der Angliederung der Krim an die Russische Föderation im März 2014 stattfand. Abgesehen von Russland selber haben nur 10 Staaten den Standpunkt Moskaus unterstützt, 100 Staaten waren dagegen, 58 enthielten sich der Stimme. Von den ehemaligen 15 Sowjetrepubliken haben sich nur zwei (Belarus und Armenien) mit Moskau solidarisiert. Ähnlich verhält es sich auch jetzt mit dem am 24. Februar begonnenen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Auch dieser aggressive Akt Moskaus stieß, wenn man von einigen Ausnahmen absieht, auf die beinahe einhellige Ablehnung der Weltöffentlichkeit. Was China anbetrifft, so ist seine Haltung recht zwiespältig. Aber eine allzu enge Anlehnung an Peking kann für Moskau durchaus gefährliche Folgen haben. Boris Nemzow hat davor bereits im April 2014 gewarnt.
Und noch eine abschließende Bemerkung zum Putinschen Russozentrismus, der zu einer Art offizieller Ideologie des Putinschen Systems wurde. Diesem Konstrukt fehlen gerade diejenigen Elemente, die der russischen Kultur, vor allem der russischen Literatur, ihre außergewöhnliche Attraktivität verliehen. Denn zum Wesen dieser Literatur, die Thomas Mann seinerzeit sogar als die „heilige Literatur“ bezeichnete, gehörten die Wahrheitssuche und der Freiheitsdrang. Die Verteidiger der „gelenkten Demokratie“ scheinen indes ihre Wahrheit bereits längst gefunden zu haben und was den Freiheitsdrang anbetrifft, so versuchen sie die Gruppierungen, die ihn verkörpern, mit aller Kraft zu bekämpfen. Dessen ungeachtet melden sich auch heute, trotz aller Repressalien, zahlreiche Vertreter des „anderen Russland“ zu Wort, die sich mit dem angegriffenen ukrainischen Nachbarn vorbehaltlos solidarisieren. Einige dieser Stimmen möchte ich nun zitieren:
„Wir empfinden einen tiefen Schmerz“, sagt der Chefredakteur der Zeitung „Nowaja Gaseta“ und Friedensnobelpreisträger, Dmitrij Muratow: „Unser Land hat auf Befehl des Präsidenten Putin einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Und es gibt niemanden, der imstande ist, diesen Krieg zu stoppen. Deshalb empfinden wir abgesehen vom Schmerz auch Scham“.
Und die Schauspielerin Lija Achedschakowa, die zu den schärfsten Kritikern des Putin-Regimes zählt, fragt: „Warum hassen wir die Ukrainer denn so? Das verstehe ich nicht. Wir haben doch zusammen (gegen Hitler) gekämpft und wir saßen auch zusammen im GULag“.
Hunderte von russischen Intellektuellen unterschrieben am 24. Februar einen offenen Brief, der den Krieg gegen die Ukraine mit äußerster Schärfe verurteilt und der folgende Passagen enthält: „Die Verantwortung für diesen neuen Krieg in Europa liegt gänzlich bei Russland. Es gibt für diesen Krieg keine Rechtfertigung … Es ist bitter zu erkennen, dass unser Land, das einen entscheidenden Beitrag zur Bezwingung des Nationalsozialismus geleistet hatte, nun selbst einen neuen Krieg auf dem europäischen Kontinent entfesselt hat“.
All diese Stellungnahmen zeigen, dass es der Putin-Riege keineswegs gelungen war, die Verfechter des „anderen“ Russland gänzlich zum Schweigen zu bringen. Irgendwann wird man in Russland auf sie mit Stolz zurückblicken.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



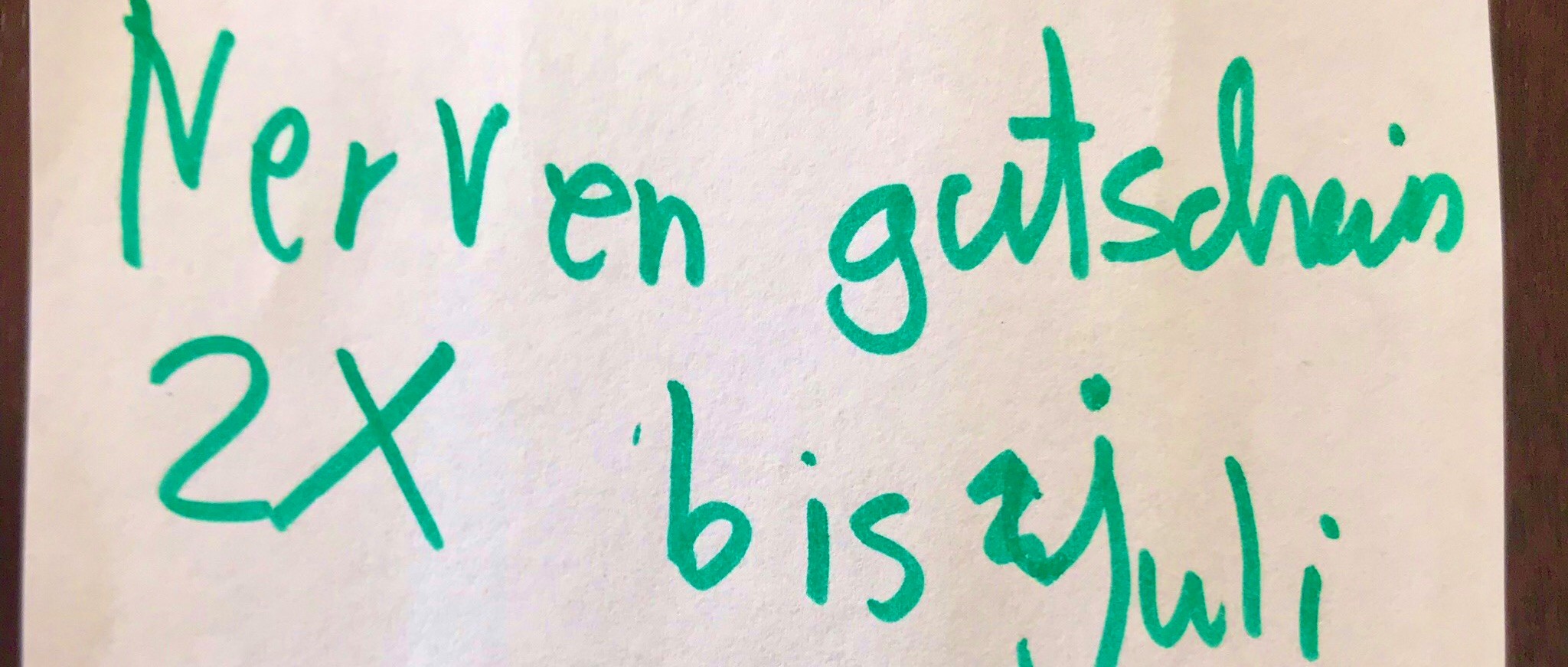

Ihr Kommentar