7 Jahre Game of Thrones, 26 Jahre A Song of Ice and Fire. Und immer noch erweist sich die von Matt Hilliard erstellte Prognose, wer eigentlich die Hauptcharaktere seien und wer damit bis in die Endphase der Kämpfe um den eisernen Thron vor überraschenden Toden gefeit (nebst weiterer interessanter Gedanken), erstaunlich tragfähig. Der „Jeder kann sterben“-Wahn war eben genau das, ein Wahn. A Song of Ice and Fire ist, und der Autor leugnet das längst selbst nicht mehr, aus dem Ruder gelaufen, und zum Zwecke der Verfilmung in durchaus vorteilhafter Weise. Ein konzentrierter Roman taugt selten zum Sieben-Jahre-Dauer-Milliardenblockbuster.
7 Jahre Game of Thrones, 26 Jahre A Song of Ice and Fire. Und immer noch wird man für kritische Beobachtungen zu Serie und Hype in einer Heftigkeit angegangen die nur mit dem so genannten Nahostkonflikt vergleichbar ist.
Doch ist die Sieben nicht eine magische Zahl? Vielleicht ist der Zeitpunkt günstig, die in den Essays Die Serie ist als Kunstform tot und Tot, toter, am totesten. Immernoch: Die Serie an einem breiteren Anschauungsmaterial entwickelten Kritikpunkte noch einmal am goldenen Kalb der Gilde der Schlachtermeister und der Schlachtfestjünger zu konkretisieren. Dabei ging es nie um einen Verriss von Game of Thrones als solchem und darum soll es auch hier nicht gehen. Es geht um die unkritische Verehrung eines Werkes als etwas, das es nicht ist.
Game of Thrones ist kein Pionier der Serie…
Die klassische Fernsehserie war ein Spiegel der Industriekultur. Sie variierte das immer Gleiche nur gerade so stark, dass es zu amüsieren, zu erschrecken, zerstreuen vermochte. Entscheidend war die Struktur der Episoden. Nach jeder Folge wurde der Status quo wiederhergestellt. Parallel dazu zielte der moderne Film (auch der Roman, andere Großwerke), wo er sich ernst nahm auf verdichtete Totalität: Sind die Konflikte durchgeführt, ist nicht einfach ein nahtloses Anknüpfen an das Ende wieder denkbar. Deshalb wirken aus finanziellen Gründen erstellte Fortsetzungen oft so lächerlich. Bereits Ende der achtziger öffnete sich die Serie selbst zur Totalität hin, auch als Reaktion wohl darauf, dass der gesellschaftliche Status Quo fragiler zu wirken begann, die fragmentarische Bearbeitung dem entsprechend adäquater. Seinfeld etwa führte lange Handlungsbögen in die Serienstruktur ein. Spätestens in den späten Neunzigern und den frühen Nullern war es Usus, pro Episode einer ambitionierteren Serie mehrere Handlungsbögen zu spannen, die mal besser, mal schlechter, als Kommentare zueinander fungierten, und deren mindestens einer gleichzeitig die übergeordnete Entwicklung der Staffel und/oder Serie vorantrieben. Serien die bereits relativ konsequent nach diesem Prinzip funktioniert waren etwa die letzten Staffeln von Star Trek Deep Space Nine, Ally McBeal oder Boston Legal.
… vielleicht noch nichtmal eine Serie
Mit dem Anbruch des so genannten goldenen Zeitalters wurde das Serienprinzip nicht perfektioniert, sondern aufgegeben: Die Sopranos, Mad Men, und zuletzt Game of Thrones sind in absteigender Folge Abgesänge auf die offen-geschlossene Kunstform der Serie, die sich mit den äußeren Zwängen von Parzellierung einerseits und Dauer andererseits produktiv auseinandersetzten. Es sind, auch begünstigt durch neue Konsumgewohnheiten, Langfilme, die anfangs noch den klassischen Cliffhanger Dickensscher Prägung wieder belebten, mittlerweile aber selbst darauf weitgehend verzichten können, da die Staffeln „gebingewatcht“ werden. Damit nähert sich Game of Thrones in jüngeren Staffeln strukturell der Seifenoper an. Das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, sondern die konsequente formale Beschreibung eines Modells, indem eine fiktive Welt und ihre Charaktere fortdauernd enzyklopädisch erfasst und aktualisiert werden, während eine Einzelfolgenstruktur kaum mehr auszumachen ist. Seifenoper ist der passendste Begriff des etablierten Apparates für serielles Erzählen außerhalb der Episodenform. Fans, schmollt nicht: Reclaim the Seifenoper!
Game of Thrones ist nicht „ultrakomplex“
Game of Thrones hat relativ viele Handlungsorte und führt relativ viele Nebencharaktere ein und bringt sie wieder um die Ecke. Und auch der Main Cast ist durchaus massiv. Das verschiedenen Handlungsstränge konvergieren dagegen eher so la la. Warum alle 5 bis 10 Minuten von hier nach dort geschnitten wird, bleibt oft unklar. Auch laufen die verschiedenen Handlungen regelmäßig nebeneinander her, ohne im Sinne oben genannter früherer Serien etwa auf Ebene der Symbolik eng geführt oder kontrapunktiert zu werden (auch das wurde schlimmer, je weiter die Serie fort schritt. Die einzige Einheit stiftet die Erwartung eines großen Finales. Und diese Einheit hätte durchaus Potenzial, orientiert sich die Serie doch am klassischen Königsdrama und schickt sich an das Thema der Unterwerfung von Partikularinteressen unter einer Art aufgeklärten Absolutismus zu verhandeln. Nur: die allein auf den Schluss sinnvoll zu Vereinende dramatische Struktur verträgt sich schlecht mit den größten Teils kontingenten Nebenhandlungen. Game of Thrones ist ob der schieren Masse des Geschehens durchaus kompliziert. Aber Komplexität ist mehr, Komplexität ist Qualifizierung von Komplikationen. Game of Thrones begnügt sich dagegen mit dem Nervenkitzel einer Straßenkreuzung, auf die mehrere Autos größtenteils unverbunden in Richtung der zu erwartende Katastrophe zu rasen.
Game of Thrones ist nicht „das ungeschminkte Leben“
„Jeder kann Sterben“. Da ist das Mantra wieder. Dass es schlicht falsch ist, wurde zur Genüge gezeigt. Die Hauptcharaktere Martins haben sich bisher als so unverwundbar erwiesen wie in jeder anderen Fantasyserie. Dass der heutige Durchschnittszuschauer sich unfähig zeigt, in einer so eindeutigen Figur wie Ned Stark von Anfang an den Mentor zu erkennen, der nach dem klassischen Topos aus dem Weg geräumt werden MUSS um den Zöglingen den Weg in die Geschichte freizumachen, ist nicht Problem des Kritikers. Aber „jeder kann sterben“ verweist auf Tieferes. Auf die Überzeugung, dass hier Leben und Politik endlich einmal ganz ungeschminkt in all ihrer Gewalt und notwendigen Blutrünstigkeit dargestellt würden. Was sie Game of Thrones fantastischen Kindergeschichten wie dem Herrn der Ringe vorziehen lasse, so viele Fans, sei der Naturalismus der Darstellung (ich paraphrasiere, man sagte heute „Realismus“). Dass der Kollege Kern diese Seite der Serie lobt verstört noch nicht weiter. Er ist ein Konservativer, und der Konservativismus braucht die „natürliche“ Blutrünstigkeit der Welt, um ihr sein in besseren Momenten durchaus respektables zivilisatorisches Projekt entgegenzustellen. Aber auch viele Linke und Liberale gingen und gehen auf dieses Mantra ab. Und mit jeder Wiederholung wird die Idee des Menschlichen: Dass aber eben nicht jeder sterben muss oder zumindest nicht jung und grausam auf dem Schlachtfeld, an den Rand gedrängt. Game of Thrones ist, das macht der Beginn der neuesten Staffel noch einmal mittels Holzhammerfeminismus klar, eindeutig eine linksliberal intendierte Serie. Auf der Ebene der erzeugten Bilder und platten Merksätze übt sie dennoch einen schmal Spur-Nietzscheanismus ein. Grim Dark Fastfood.
Game of Thrones ist nicht subversiv
Feminismus, Klimawandel, ein Lob der Abweichler usw. Nachdem es in den ersten Jahren aggressive Angriffe auf die Serie gab hat das linksliberale Spektrum mittlerweile seinen Frieden mit Game of Thrones gemacht. Nun werden, weil man nicht einfach Blut, Sex und Mittelalter genießen kann, allerlei Subversionen tradierter Normen in Westeros hineingelesen. Das ist nicht hundertprozentig falsch, aber deshalb noch lange nicht richtig. Tatsächlich arbeiten Martin und die Serienautoren sehr traditionell mit lange etablierten Stock-Charakteren (der zynische Zwerg, das Mädchen das zum Krieger wird, die kalte Königin, der Verräter, die Erlöserin usw) und verpassen denen dann genau einen interessanten „Twist“. Meist ein mehr oder weniger an Kälte oder Wärme, von mir aus auch Menschlichkeit/Unmenschlichkeit, als die Rolle erwarten ließe. Das ist an sich nicht schlecht. Das ist vom Blickwinkel des Marketings aus betrachtet geradezu genial. Es dürfte neben der „Jeder kann Sterben“-Illusion und der Bildgewalt vor allem dieser narrative Trick sein, der es durch alle politischen Spektren so leicht macht, sich mit Game of Thrones zu identifizieren.
Game of Thrones ist ordentliche Unterhaltung
Also: Klassische Intrigen. Spektakuläre Bilder. Ein familiäres Set an Charakteren, das fast alle Klassen, Schichten und politischen Spektren anspricht, genug Überraschung, um zu Fesseln, zu wenig, um vor den Kopf zu stoßen. Geht es darum unterhaltsames Material für viele Abende zu provozieren macht Game of Thrones seine Sache verdammt gut. Das darf man durchaus loben, auch wenn mindestens in den letzten beiden Staffeln die Scripts immer kürzer wurden, die Bilder gewaltiger, die Dialoge in den Hintergrund rücken. Man genieße dennoch. Warum auch nicht? Aber man verkaufe es nicht als das noch nie da gewesene, formvollendetste und durchdachtes Kunstwerk, das eine neue Art des Erzählens eröffne. Damit offenbart man nur seine literatur- wie sogar fernsehgeschichtliche Ignoranz.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



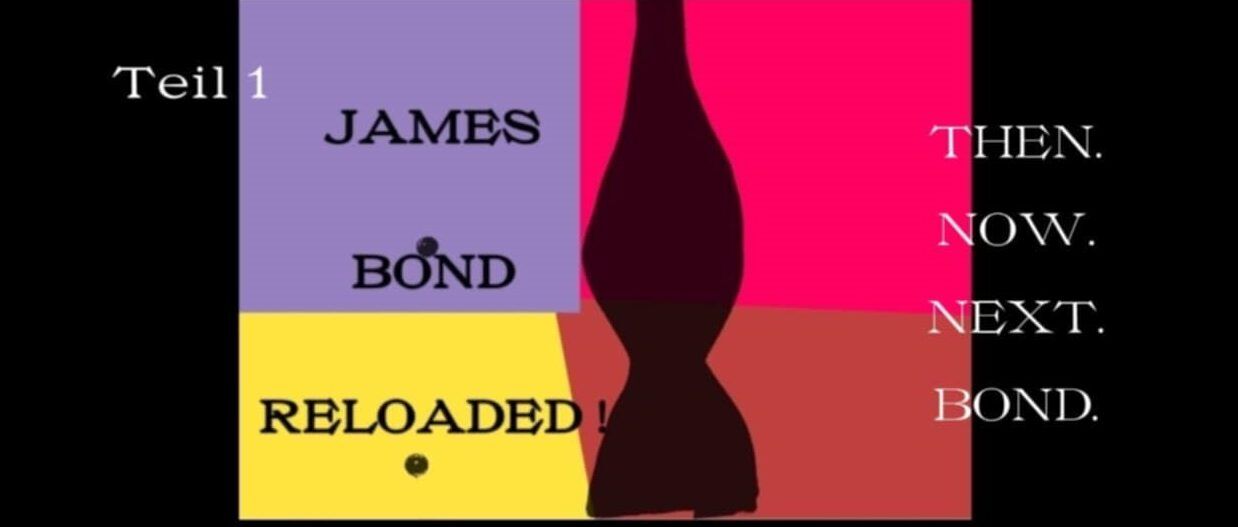
Fred Groeger
Ah. Also um der „Selbstviktimisierung“ vozubeugen: Deine Kritik an „Game of Thrones“ ist eher belanglos für mich.
Was ich aber als absolute Dummschwätzerei auf hohem Niveau bezeichnen muss, ist deine große und ungenaue Abhandlung über die „Serie“, ohne dass du wirklich Ahnung davon hast.
Du vergleichst Äpfel, Birnen und Zucchini.
Zitat [„Die klassische Fernsehserie war ein Spiegel der Industriekultur. Sie variierte das immer Gleiche nur gerade so stark, dass es zu amüsieren, zu erschrecken, zerstreuen vermochte. Entscheidend war die Struktur der Episoden.“]
Das stimmt schon…aber nur teilweise und bei „Game of Thrones“ ist dieser Spruch einfach nur Quatsch.
Also ja, was du als „klassische Fernsehserie“ bezeichnest, war tatsächlich diese teilweise erzwungene Abweichung von der Serie. Wäre aber schon besser gewesen, wenn du dir mal die Vorgänger der Fernsehserien“ angesehen hättest:
Die „Kino Serials“ wie „Fantomas“, „Asene Lupin“ (Stummfilm) „Flash Gordon“, „Buck Rogers“, „Green Hornet“ oder die „Radio Serials“ wie „The Shadow“ und „Lone Ranger“ aus den 1930/40ern.
Gerade der „Seifenoper“-Begriff stammt ja aus der Zeit des „Radio Drama“ und „Daily Soaps“ waren die Fortsetzungsgeschichtchen für „Hausfrauen“.
Was du irgendwie nicht verstehst oder bewusst ignorierst: Diese „klassische Fernsehserie mit den abgeschlossen Folgen“ ist eher keine „Serie“, da das „serialisierte Erzählen“ komplett verschwand.
Und das war eben auch die große erzählerische Schwäche der Fernsehserien, die irgendwann nur noch wenig Entwicklung der Handlung und Charaktere ermöglichte.
Das dies heute im Fernsehen neben der „klassischen Fernsehserie“ wieder anders ist, hat sehr unterschiedliche, teilweise witzige Gründe durch die Herkunft einiger Autoren.
Aber erstmal: Lass bitte „Game of Thrones“ raus. Die Verfilmungen von Romanen wurde im Fernsehen immer möglichst „serialisiert“ erzählt.
Eventuell einfach nochmal an „Roots“, „Fackeln im Sturm“, „Shogun“, „Die Dornenvögel“ oder
im deutschsprachigen Raum an „Der Seewolf“, „Silas“, „Tim Taler“ „Jack Holborn“ oder „Anna“ erinnern? „Das Boot“, der ewige U-Boot-Schinken, wurde für eine Fernsehfassung ebenfalls (von der BBC) als 6-teilige Serie ausgestrahlt.
Wenn heute also aktuell Romane in Fernsehserien umgewandelt werden, wie aktuell „Game of Thrones“, „The Expanse“ oder „The Strain“ entspricht das genau dem was man vorher schon mit den Romanverfilmungen als Miniserien gemacht hat, bloß dass es wegen des Umfangs der Handlung eben über mehrere „Staffeln“ geht.
Aktuell sehe ich beispielsweise Guillermo Del Toros und Chuck Hogans „The Strain“ und weiß, dass die Story nach der 4. Staffel endet.
Das sind die Äpfel. Romanverfilmungen.
Was du bei „Deep Space Nine“ ansprichst, ist eigentlich ein anderes Phänomen. Kulturell musst du da etwas verstehen: Drehbuchautoren und Produzenten einiger Fernsehserien sind heute eine Generation, die intensiv mit dem serialisierten Erzählen und dem Prinzip der „Story Arc“ aufgewachsen sind. J. Michael Straczynski („Babylon 5“) Ronald D. Moore („DS9“, „Battlestar Galactica“, „Helix“) J.J. Abrams („Lost“, „Alias“, „Fringe“, „Westworld“) Joss Whedon („Buffy“, „Angel“, „Firefly“, „Dollhouse“) oder Jeph Loeb („Lost“, „Heroes“) sind stark von der „Comicszene“ beeinflusst. (Jeph Loeb ist genaugenommen erst ein bekannter Comic-Autor für Marvel und DC gewesen)
Während sich in der Fernsehdustrie die Serie vom „serialisierten Erzählen“ wegbewegte, hat sich in der Comicindustrie gerade diese Erzählstruktur immer weiterentwickelt. Und Comics sind eben anders als in unserem kultursnobistischen „Dichter und Denkerländchen“ in den USA ein großes, altes und wichtiges Medium.
Dass also die Autoren, die intensiv mit Comics aufgewachsen sind oder sogar selbst Comicautoren sind/waren, die liebgewonnenen Vorzüge der „Serialization“ und „Story Arc“ übernehmen, ist irgendwie natürlich. Das sind die Birnen.
Und die Zucchini sind die Serien, die Serien für die jetzt durch die Birnen die Tür geöffnet wurden. 2012 hat beipielsweise Marc Guggenheim für Warner/DC den drittklassigen Superhelden „Green Arrow“ mit „Arrow“ zur TV-Serie gemacht, Netflix folgte mit „Daredevil“, „Jessica Jones“ usw.
Zum ersten Mal erlebt man eine adäquate Umsetzung von „Comicserien“ als „Fernsehserie“. Nicht nur beschränkt auf das „Superhero“-Genre, sondern auch in „The Walking Dead“, „Outcast“ und „Preacher“, die als Kinofilmreihe oder Serien mit abgeschlossenen Folgen gar nicht funktioniert hätten.
Selbst Neil Gaimans „American Gods“ profitiert von dieser Rückeroberung der Serie duch das serialisierte Erzählen.
Die Serie ist eben nicht tot. Sie wird eher gerade endlich im Fernsehen zu etwas gemacht, was auch die Bezeichnung „Serie“ verdient.
Es lebe die Serie!