Gegen Genre-Chauvinismus
Die einzige Todsünde wäre – und das gilt für jede Musik, jeden Stil gleichermaßen – Ideenlosigkeit, Ignoranz und Dünnbrettbohrertum. Ich meine jene Oberflächlichkeit, welche die eigene Stilrichtung zum Malen nach Zahlen-Debakel degradierte statt zum definierenden Spektakel. Oder anders gesagt: Taugt das Gebotene zur ebenso fetten wie sinnlichen Party oder doch nur zur Provinzkamelle? Ein qualitativer Gradmesser zum Vergleich ergibt sich hier besonders aus den künstlerischen Vorlagen dreier bärenstarker, deutschsprachiger Alphafrauen des Schlagers.
Starke Schlager-Frauen
Trendy Gesichtslosigkeit?
Doch Obacht! Ein dermaßen großes Heer williger Verrichtungsgehilfen birgt nicht selten die Gefahr musikalischer Zerfahrenheit. Selbst Ikonen wie Madonna machten mit dieser Methode zuletzt die Erfahrung, das zu viele Köche eher zu trendy Gesichtslosigkeit führen als zu musikalischer Konturenschärfe.
Und genau das passiert leider auch. „Sonne Auf Der Haut“ klingt als habe man eine zu Recht weg geworfene Skizze des 80er Mike Oldfield exhumiert – nur eben mit weniger Composer-Talent – und das ganze dann zur verstörenden Mischung aus Discofox-Zombie-Folk und zeitgeistiger Nichtigkeit aufgeblasen. Schön ist das nicht.
Aber noch vergleichsweise harmlos. Bezeichnend und ein echter Pferdefuß des gesamten Albums ist die hörbar eiskalt kalkulierte Plünderung pseudomoderner Zutaten, bei gleichzeitiger Amputation jeglicher auch nur halbwegs interessanter Melodien. Die abgezockte Verpackung kann leider nicht eine Sekunde darüber hinwegtäuschen, dass hier – im Gegensatz zu den oben genannten Heldinnen – über weite Strecken lediglich drittklassige Gefühlsimitate geboten werden, die jenseits ’ner halben Pulle Doppelkorn nicht gerade einladend wirken, noch nicht einmal einlullend. Professionalität ersetzt Herzblut und Leidenschaft? Bedauerlicherweise ja!
Wer das nicht glauben mag, checke getrost mal den plastinierten Geisterbahn-Ohrwurm „Herzbeben“ an. Man weiß gar nicht, was eigentlich schlimmer ist: Die aufgesetzte bitchy teenage Fashionshop-Musikattitüde zu Beginn oder doch der Gruselreim „Herzbeben, lass uns leben, wir wollen was erleben! Lass mich leben“? Am Ende nimmt man klangbildlich der Schlagerfachverkäuferin Fischer die 15 jährige Schulhofmobberin genau so wenig ab wie ihren vorgetäuscht schmachtenden Lebenshunger.
Der „Flieger“ zerschellt ebenso am Sangesfelsen Fischer. Ihr Gesang kommt so steril und persilweiß aus den Boxen, das jeglicher Charakter einer eigenen Stimme ins Bodenlose stürzt. Der belanglose Chorus lässt ohnehin sogar jeden DJ-Ötzi-Track wie ein Zeugnis waschechter Authentizität wirken. Diese Austauschbarkeit ihrerer seelenlosen Vocals jedoch ist schlichtweg indiskutabel. Dabei allerdings nicht ganz so schauderhaft, wie die lieblos hingeklecksten Kalenderblatt-Platitüden bar jeder Individualität. Überall lauern Zeilen jener Sorte, wo man niemals aufgibt, heller als das Licht wird, niemals still steht, immer weiter seinen Weg geht usw. Nun ist nichts gegen passionierte Mutmachtracks zu sagen. Es ist auch keine Schande, solche Lieder zu machen. Jedoch ist es eine Zumutung, dabei auf die altbekannte, tausendfach gehörte 200-Wörter-Mottenkiste zu setzen, die sich im Klischee suhlt ohne auch nur im Geringsten nach sprachlicher Unverwechselbarkeit oder gar Originalität zu suchen. Als ranzigen Anspieltipp hierzu empfehle ich „Wir Brechen Das Schweigen“. Wer soll das geil finden und älter als zehn Jahre oder nicht komatös sein?
Von Hoffnungslosigkeit und Wundern
Und dann, während man bereits jegliche Hoffnung fahren ließ, passiert zwischendurch ein gar nicht mal so kleines Wunder. Inmitten dieser Flut popkultureller Nullnummern erhebt sich hernach auf einmal doch ein zweiteiliger lichterner Moment. „Lieb Mich Dann“ glänzt als zaghafter, silbereisenfreier Silberstreif am ansonsten finsteren Horizont. Das Arrangement ist sparsam, für Fischers marktschreiende Verhältnisse geradezu spartanisch angelegt. Gut so, denn es braucht nicht mehr als die zarte Akustikgitarre, um diese tatsächlich ebenso fragile wie romantische Ballade in Szene zu setzen. Auch der Gesang klingt auf einmal organisch, fühlend und angemessen zurückgenommen. Hier erreicht sie tatsächlich jene Klasse ihrer Vorgängerinnen und ehrt das Genre statt es zu töten. Warum denn bitte nicht mehr davon? Es geht doch, verdammt!
Und tatsächlich: Nachdem man einen weiteren Trip durch den Dschungel musikalischer enttäuschungen hinter sich bringt, setzt sie mit „Adieu“ noch einen drauf. Das schnuckelige Liedchen ist ihr womöglich bester Track überhaupt. Der mehr als angedeutete, leicht melancholische Hauch von Chanson steht der Sängerin gut zu Gesicht und transportiert dabei simultan eine frankophone Luftigkeit, deren sinnliche Bittersüße jedem bekannt sein dürfte, der schon einmal unglücklich verliebt war.
Das Fazit lässt den Hörer etwas ratlos zurück. Einerseits erweitert Helene Fischer das Repertoire zaghaft mit wenigen, sehr guten Nummern. Andererseits fehlt ausgerechnet dieser Künstlerin, die es nicht mehr nötig haben sollte, ausschließlich auf das Kommerzkalkül „Freunde retardierter Musik“ zu setzen, anscheinend Wille und Courage, solche Ansätze nicht unter einem Haufen banalsten Plunders zu ersticken. Doch gerade Fischer, die sie weder in relevanter Hinsicht selbst schreibt oder textet, stünde eine solche Weiterentwicklung gut zu Gesicht, falls sie die musikalische Zitrone nicht nur auspressen, sondern auch schmackhaft-haltbare Limonade liefern möchte. Alle Möglichkeiten dazu hätte sie. Sie muss Es nur tun. Vielleicht beim nächsten Album. Denn wie lautet die Mutter aller Platitüden? „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“
+++
Lesen Sie auch: Cities in dust
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


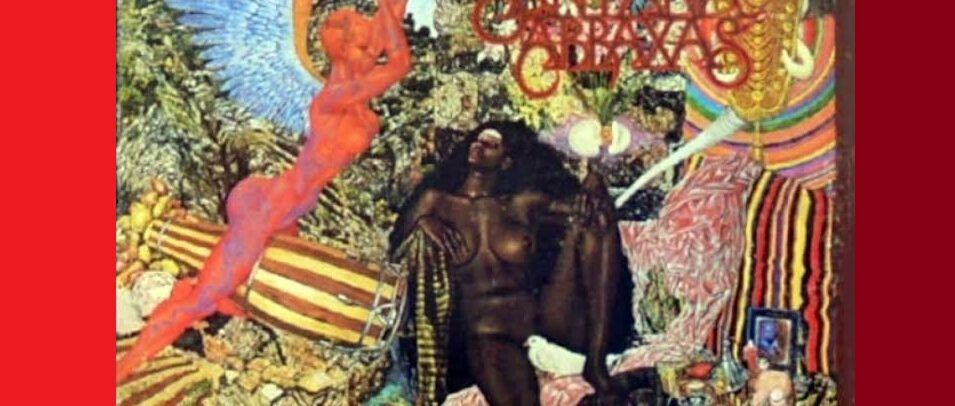

Courtney Course
Da muss ich leider zustimmen. Und danke, dass die absoluten Super-GAUS wie „Achterbahn“ oder „Das volle Programm“ gleich gar nicht genannt wurden.