Oliver Weber vertritt in seinem Beitrag die These von einem „epochalen Triumphzug“ des Westens seit Beginn der Neuzeit, insbesondere seit der Entstehung der Absolutismustheorie von Thomas Hobbes im 17. Jahrhundert, bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts, als sich die „Dekadenz“ des Westens aus Sicht des Autors bemerkbar machte. Hier könnte man fragen, warum die viel ältere, bereits im 16. Jahrhundert entstandene Theorie von Jean Bodin nicht erwähnt wird.
Zwar sagt Weber in seiner Einführung, dass dieser Triumphzug des Westens „keinesfalls linear, niemals widerspruchsfrei (war)“. Dieser Vorbehalt spiegelt sich aber in seinem Beitrag kaum wider. Hier wird der Eindruck von einem beinahe ununterbrochenen Aufstieg des Westens praktisch bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert vermittelt. Diese Argumentation erinnert in mancher Hinsicht an die Ideen, die für das Zeitalter des Positivismus im 19. Jahrhundert charakteristisch waren und die in einer besonders anschaulichen Form der russische Philosoph Wladimir Solowjow in seinem Werk „Drei Gespräche“ (1900) einem seiner Protagonisten, dem „Politiker“, in den Mund legt (den Schluss der „Drei Gespräche“ bildete die berühmt gewordene „Kurze Erzählung vom Antichrist“ ).
Der europäische Triumphalismus im „langen 19. Jahrhundert“
Beim Solowjowschen „Politiker“ handelte es sich um einen überzeugten Europäer, der an die segensreiche Wirkung der europäischen Kultur auf alle Völker der Welt glaubte. Die Europäisierung setzt der „Politiker“ mit der Überwindung der Barbarei gleich und als eine solche bezeichnet er den Krieg. Er ist davon überzeugt, dass die europäischen Völker bereits eine solche zivilisatorische Reife erreicht hätten, dass die Regelung ihrer Konflikte durch Kriege für sie nicht mehr in Frage komme:
Ein Krieg in Europa ist unwahrscheinlich, weil es so viele Möglichkeiten gibt, Konflikte friedlich zu lösen … Die geschichtliche Periode der Kriege ist nun vorbei … Ich bin davon überzeugt, dass weder wir noch unsere Kinder große Kriege erleben werden. Und unsere Enkel werden sogar über die kleinen Kriege irgendwo in Asien oder in Afrika nur aus den Geschichtsromanen erfahren.
Dass die Gedankengänge des Protagonisten der europäischen Idee im Werk Solowjows im damaligen Europa weit verbreitet waren, bestätigt auch Stefan Zweig in seinen Erinnerungen. Er schreibt:
An barbarische Rückfälle wie Kriege zwischen den Völkern Europas, glaubte man so wenig wie an Hexen und Gespenster; beharrlich waren unsere Väter durchdrungen von dem Vertrauen auf die unfehlbar bindende Kraft von Toleranz und Konzilianz.
Der europäische Gedanke der friedlichen Lösung von Konflikten werde demnächst die ganze Welt erobern, setzte der Solowjowsche „Politiker“ seine Ausführungen fort: „Überall kündigt sich jetzt die Epoche des Friedens und der friedlichen Verbreitung der europäischen Kultur an. Alle sollten jetzt Europäer werden “.
Wenn man bedenkt, dass die von Solowjow erdachte Figur des „russischen Europäers“ diese Prognose im Jahre 1900 aufstellte, also am Vorabend der wohl zerstörerischsten Kriege der Neueren Geschichte, klingt sie besonders bizarr. In gewisser Weise erinnert dieser Triumphalismus an die Gedankengänge Francis Fukuyamas, der 89 Jahre später vom „Ende der Geschichte“ sprechen sollte, also vom endgültigen und weltweiten Sieg der westlichen Wertvorstellungen. Auch diese Prognose wurde bekanntlich bald, nicht zuletzt durch die Terrorakte vom 11. September 2001, widerlegt.
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges erlebte allerdings der Westen in der Tat einen erstaunlichen Aufstieg. Man hätte damals beinahe der Versuchung erliegen können, den linearen Fortschritt als eine Art „Gesetz“ der neuesten europäischen Geschichte zu betrachten. Aufgrund der industriellen und wissenschaftlichen Revolution wie auch infolge von politischen Umwälzungen unterschiedlichster Art wurde die Periode von 1789-1914 – das „lange 19. Jahrhundert“ (Eric Hobsbawm) – zu einem Zeitalter, in dem ein bis dahin beispielloser Siegeszug der emanzipatorisch-aufklärerischen Prozesse stattfand. Zwar kam es zu gelegentlichen Unterbrechungen dieser Entwicklung, jedoch nur für kurze Zeit. Beinahe nach jeder Unterbrechung beschleunigte sich der Vormarsch der Europäer in Richtung Rechtsgleichheit und Befreiung von paternalistischer Bevormundung jeder Art.
„Das Jahrhundert der Unterwürfigkeit“
Um so rätselhafter wirkt die Tatsache, dass dieser unbändige Freiheitsdrang der Europäer, nach den Erschütterungen des Ersten Weltkrieges – der „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts (George F. Kennan) – so abrupt eingedämmt werden konnte, dass unzählige von ihnen in unterwürfige Untertanen der neu errichteten totalitären Diktaturen verwandelt werden konnten. Nicht zuletzt deshalb verleiht der 1964 verstorbene russische Schriftsteller Wassilij Grossman in seinem Roman „Leben und Schicksal“ dem 20. Jahrhundert – dem Jahrhundert der Lager, der Weltkriege, der Extreme und vielem mehr – auch eine andere prägnante Bezeichnung: das „Jahrhundert der Unterwürfigkeit“. Und in der Tat, der Siegeszug der totalitären Regime, welche die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts prägten, wäre ohne die Bereitschaft unzähliger Europäer, sich mit diesen Diktaturen abzufinden, kaum denkbar gewesen. Wenn man dabei bedenkt, dass viele dieser Mitgestalter bzw. Mitläufer der totalitären Systeme kurz zuvor noch die Freiheit über alles geschätzt hatten, muss man hier gemeinsam mit Grossman von einem erstaunlichen anthropologischen Phänomen sprechen.
Nach dem Aufstieg des europäischen Westens fand also sein, zumindest vorübergehender, Abstieg statt. Diese geschichtliche Phase, die bis 1945 und in manchen Teilen Europas bis 1989 dauern sollte, wird im Beitrag von Oliver Weber weitgehend ausgeblendet.
„Die Demokratie schläft“
Kurz nach der nationalsozialistischen „Machtergreifung“ fragte der russische Exilhistoriker Georgij Fedotow, in welche Epoche Deutschland, dem die westliche Kultur derart viel zu verdanken hatte, nun eintrat. Seine Antwort lautete:
In ein Zeitalter, in dem die Würde des Menschen an der Reinheit des Blutes gemessen wird, in dem die Juden durch den gelben (Stern) markiert werden. Es gibt noch keine Scheiterhaufen, auf denen die Menschen verbrannt werden (man übt dies noch an den Büchern). Man wird allerdings nicht allzu lange auf diese (Scheiterhaufen) warten. Ein großer Teil des Weges ist schon zurückgelegt worden.
Was Fedotow besonders große Sorgen bereitete, war die Tatsache, dass die deutsche Katastrophe es nicht vermochte, die noch übriggebliebenen europäischen Demokratien wachzurütteln. In seinem 1933 veröffentlichten Artikel unter dem vielsagenden Titel „Die Demokratie schläft“ schrieb er: „Dies ist bereits die dritte Warnung. Zunächst versank Russland im Abgrund, danach Italien, jetzt Deutschland… Ein großer Teil Europas befindet sich unter Wasser, und die Fluten, die auch den äußeren Westen des Kontinents bedrohen, kommen immer näher“.
Thomas Mann, Stefan Zweig und viele andere Verteidiger der nun bedrohten europäischen Kultur richteten ebenfalls mahnende Worte an die westliche Öffentlichkeit und an die Entscheidungsträger in den westlichen Hauptstädten. Zunächst ohne Erfolg. Bis 1938 schenkten viele westliche Politiker immer wieder den Friedensbeteuerungen Hitlers Glauben und erlaubten es dem Dritten Reich (aber auch dem faschistischen Italien) einen aggressiven Akt nach dem anderen ungestraft zu begehen. Der Zustand, in dem sich der Westen in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre, nicht zuletzt infolge der Appeasementpolitik der westlichen Demokratien befand, wurde vom britischen Historiker Lewis B. Namier mit folgenden Worten charakterisiert: „Europe in Decay“.
Europäische Integrationsprozesse nach 1945 und die Krise der europäischen Idee
Erst nach den verheerenden Erfahrungen der beiden Weltkriege und nach dem Zivilisationsbruch, den die totalitären Regime rechter und linker Prägung in Europa verursachten, fand auf dem alten Kontinent ein Paradigmenwechsel statt. Man hatte nun eingesehen, dass die Verklärung des nationalen Egoismus, wie sie für das 19. und die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts typisch war, höchst gefährliche Folgen haben kann. Diese Erkenntnis lag den europäischen Integrationsprozessen zugrunde. Heute aber erlebt der europäische Gedanke, ausgerechnet nach einem seiner größten Erfolge – nämlich nach der Überwindung der europäischen Spaltung – eine tiefe Krise, die Oliver Weber in seinem Beitrag zu Recht hervorhebt. Manche Schwierigkeiten der Transformationsprozesse im europäischen Osten, die Finanzkrise von 2008, die Euro- und die Flüchtlingskrise – all diese Themen tragen erheblich zur Euroskepsis bei. Abgesehen davon muss man hier noch die Orientierungskrise erwähnen, die in Europa nach der Beendigung des Ost-West-Konflikts begann. Bis 1989-91 stellte der europäische Gedanke im frei gebliebenen westlichen Teil des Kontinents eine Alternative zu den „geschlossenen Gesellschaften“ des Ostens dar. Die Gefahr, die von dem bis an die Zähne bewaffneten Warschauer Pakt ausging, wirkte mobilisierend auf die offenen Gesellschaften des Westens, stärkte ihre Identität. Vergleichbare Gefahren von außen bedrohen aber die heutige EU nicht mehr. Die Herausforderung, die die Putinsche „gelenkte Demokratie“ für den Westen darstellt, lässt sich mit derjenigen, die der Warschauer Pakt seinerzeit verkörperte, nicht messen. Die neue Bedrohung wird übrigens von den einzelnen EU-Mitgliedern unterschiedlich bewertet. Ähnliche Dissonanzen, die die Union zu zerreißen drohen, herrschen auch in vielen anderen Bereichen.
Trotz alledem lässt sich die heutige Identitätskrise der EU mit der Krise der 1930er und der beginnenden 1940er Jahre, also mit dem Zeitalter der siegreichen totalitären Diktaturen und der erodierenden Demokratien nicht vergleichen. Dessen ungeachtet spricht Oliver Weber beinahe elegisch vom „Abgesang“, von der „Dekadenz“ des Westens. Vergleichbare kulturpessimistische Stimmen konnte man auch in den 1930er Jahren hören (sie hatten damals übrigens eine viel größere Berechtigung als heute). Beispielhaft hierfür war der Artikel „Die Apologie des Pessimismus“ des russischen Dichters Jurij Iwask, der kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in der russischen Exilzeitschrift „Nowyj Grad“ (Neue Burg bzw. Neues Jerusalem) erschien. Das Jahrhunderte alte humanistische und christliche Europa befinde sich nun in seinem letzten Entwicklungsstadium, so Iwask, sein Untergang sei unausweichlich. Die Aufgabe der Zeit bestehe lediglich in der Verzögerung dieses Untergangs, um einen „Nekrolog“ zu Ehren der vergangenen Größe der europäischen Kultur zu „verfassen“.
Iwasks Klagelied rief eine zornige Entgegnung des bereits erwähnten Georgij Fedotow hervor. Der Glaube an ein unausweichliches Schicksal, amor fati, sei dem Christentum fremd, so Fedotow. Der Niedergang christlicher Kulturen sei nicht schicksalsgegeben, sondern eine Folge der Sünde und gegen die Sünde könne und müsse man kämpfen. Diejenigen, die eine große Idee oder einen großen Glauben vermissten, in deren Namen sie das vorherrschende Chaos bekämpfen könnten, müssten sich auf die Suche danach begeben. Gerade als freie Menschen seien wir dazu verpflichtet, nach einem solchen Glauben zu suchen, der uns helfen werde, Auswege aus der Krise zu finden.
Fedotows mahnende Worte bleiben auch heute aktuell.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


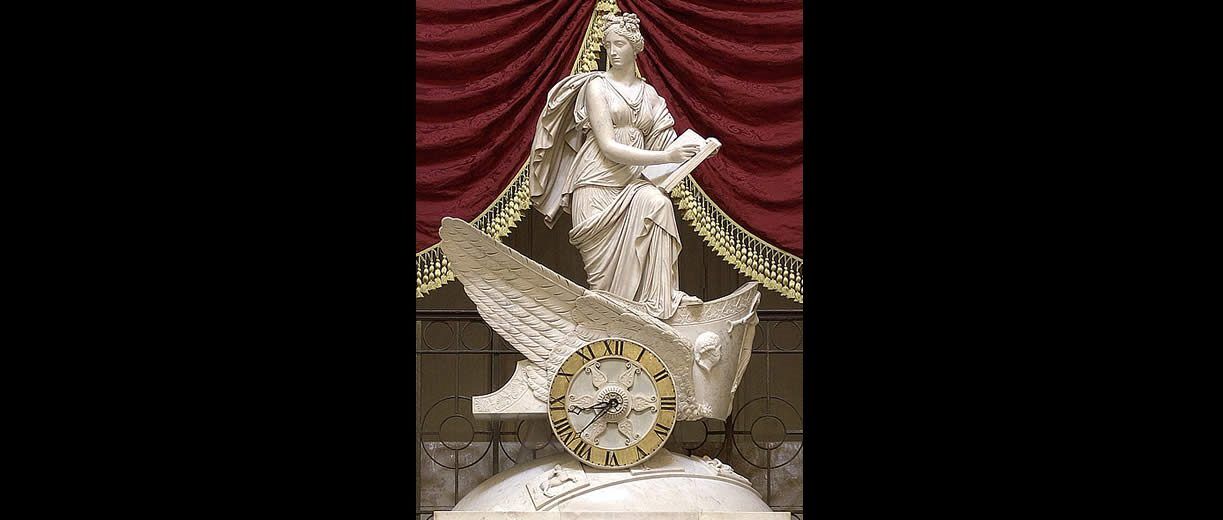

Michael Kumpmann
Ich muss ehrlich sagen, das eigene System als Endziel der Geschichte zu betrachten, wie es Fukuyama und Hegel taten, war für mich hauptsächlich Zeichen eigener Arroganz der jeweiligen Autoren, die dann später in George Bushs Versuch, den Nahen Osten mit Gewalt zu demokratisieren, endete.
Von sehr vielen Theorien der Philosophie mag Ich ehrlichgesagt diese Theorie fast am Wenigsten.
Und zum Thema Geschichtsverlauf. Mir schien Oswald Sprenglers zyklisches Geschichtsverständnis immer weitaus logischer als das „Bald erreichen wir dank des Fortschritts das Ende der Geschichte und das Paradies auf Erden“ von Hegel und Konsorten.