Die Absage an den Marxismus
Die erste Nummer der Zeitschrift „Tygodnik Powszechny“ (Allgemeines Wochenblatt) erschien am 24. März 1945. Die Zeitschrift entwickelte sich sehr schnell zum Sprachrohr der katholischen Elite des Landes. Sie akzeptierte aber auch Autoren, die keinen ausgesprochen katholischen Standpunkt vertraten, wenn ihre Ansichten dem allgemeinen Profil des Blattes nicht grundsätzlich widersprachen. Der Historiker Paweł Jasienica, der sich selbst eher als Freidenker betrachtete, veröffentlichte dessen ungeachtet in den Jahren 1946-49 unzählige Beiträge im „Tygodnik“. In seinen Erinnerungen ist er voll des Lobes über die außerordentliche Liberalität, die in der Zeitschrift herrschte:
In der Redaktion des „Tygodnik Powszechny“ mischte sich niemand in die Angelegenheiten der anderen ein, niemand dachte an irgendeine Kontrolle … Der Priester Jan Piwowarczyk, der im Auftrage der Krakauer Kurie das Blatt beaufsichtigte, hielt meine Ansichten für falsch, ja für absurd. Dies hat er mir immer wieder gesagt. Trotzdem hat er (keine einzige Zeile) in meinen Artikeln gestrichen.
Der polnische Katholizismus galt in den Augen seiner Kritiker bis dahin als engstirnig und provinziell. Die Offenheit des „Tygodnik“ veranlasste viele zur Revision dieses Bildes. Dennoch konnte sich das Blatt durchaus an bestimmte Traditionen aus dem Vorkriegspolen anlehnen. Dies war vor allem die liberale Studentenbewegung ,Odrodzenie’ (Wiedergeburt), die den Kampf gegen chauvinistische und antisemitische Tendenzen in der polnischen Kirche als eine ihrer Hauptaufgaben angesehen hatte. Aus den Reihen dieser Bewegung kamen einige der Zentralfiguren des „Tygodnik“ – vor allem sein langjähriger Chefredakteur Jerzy Turowicz.
Auf geistigem Gebiet hatte also der „Tygodnik“ bestimmte Vorläufer, politisch betrat er jedoch Neuland. Denn es ging ihm um die Ausarbeitung einer Strategie, die dem überwiegend katholischen Land, das sich zu den abendländischen Grundwerten bekannte, das Überleben im kommunistischen Umfeld sichern sollte. Den unter ihren Landsleuten verbreiteten Glauben, die Westalliierten würden Polen von der sowjetischen Hegemonie befreien, hielt die „Tygodnik“-Gruppe für völlig illusionär. Es war ihr bereits 1945 klar, dass das Land für unabsehbare Zeit unter sowjetischer Vorherrschaft bleiben werde, und dass die Abschüttelung dieser Kuratel unter den gegebenen Umständen nicht möglich sei. Deshalb lehnte sie den bewaffneten Kampf gegen die Kommunisten, den einige Untergrundorganisationen in den ersten Nachkriegsjahren noch führten, als sinnlose Kraftvergeudung ab.
Die Bereitschaft, den außenpolitischen Ausgleich mit der Sowjetunion zu unterstützen verband indes die „Tygodnik“-Gruppe mit einer Ablehnung jeglicher Kompromisse mit dem Marxismus. Die Herausgeber des „Tygodnik“ gingen zunächst davon aus, das Bündnis mit der UdSSR dürfe in keiner Weise die innenpolitische Ordnung Polens determinieren. Es schwebte ihnen eine Art ,Finnlandisierung’ Polens vor. Sie traten auch für die aktive Beteiligung der Katholiken am politischen Leben und für die Bildung einer christlich-demokratischen Partei in Polen ein. Das Blatt verwies auf die Beispiele Frankreichs und Italiens und sah zunächst keinen qualitativen Unterschied zwischen diesen Ländern und Staaten, die sich im sowjetischen Einflussbereich befanden. Da die Mehrheit der Polen katholisch war, hielten die Herausgeber die Respektierung des Willens dieser Mehrheit für eine Selbstverständlichkeit.
Trotz derartiger Äußerungen der katholischen Aktivisten hielten die Kommunisten zum damaligen Zeitpunkt nicht die Kirche, sondern die Bauernpartei von Stanisław Mikołajczyk für ihren gefährlichsten Kontrahenten im Lande. Die Parlamentswahlen standen damals in Polen noch bevor und die Bauernpartei galt dabei als Favorit. Dies nicht zuletzt deshalb, weil sie es vermocht hatte, ihren unabhängigen Status zu bewahren. Sie weigerte sich, dem von den Kommunisten dominierten sogenannten Demokratischen Block beizutreten.
Im Januar 1947 fanden die lang ersehnten Sejmwahlen statt, bei denen die mit Abstand populärste Partei im Lande – die Bauernpartei – lediglich 10% der Stimmen erhielt. Die Wahlergebnisse waren erwiesenermaßen gefälscht.
Nach der Zerschlagung der politischen Opposition stellte die Kirche die einzige Einrichtung im Lande dar, die sich dem allgemeinen Prozess der Gleichschaltung vorübergehend zu entziehen vermochte.
Dass die Katholische Kirche Polens sich diesem allgemeinen Zertrümmerungsprozess zumindest eine Zeitlang – bis 1953 – zu entziehen vermochte, stellt für die Kommunismusforschung eine Art Rätsel dar. Dieses Überleben der Kirche lässt sich sicher unter anderem darauf zurückführen, dass sie sich rechtzeitig aus dem parteipolitischen Leben zurückzog und das Machtmonopol der Kommunisten nicht in Frage stellte. Ähnlich verhielt sich auch die „Tygodnik-Gruppe“.
Der „katholische Minimalismus“
Ende 1946 formulierte Stanisław Stomma, der zu den prägenden Gestalten der „Tygodnik-Gruppe“ zählte, in der mit dem „Tygodnik“ eng liierten Monatszeitschrift „Znak“ folgende Thesen: Der Katholizismus könne sich mit ganz verschiedenen Gesellschaftssystemen abfinden. Es sei ein Fehler zu meinen, die Kirche müsse um jeden Preis versuchen, die katholische Soziallehre zu verwirklichen. Stomma war bereit, den historischen Sieg des Sozialismus im politisch-sozialen Bereich zu akzeptieren und sich auf die sogenannten letzten, d. h. religiös-ethischen, Positionen zurückzuziehen.
Der von Stomma postulierte religiöse Minimalismus rief in der katholischen Öffentlichkeit Polens heftige Proteste hervor. Stomma kapituliere vor der Entschlossenheit der Linken und verbreite eine resignative, beinahe defätistische Stimmung, schrieben einige seiner Kritiker.
Die spätere Entwicklung zeigte, wie unbegründet der Pessimismus Stommas war. Nicht die liberalen und christlichen, sondern die kommunistischen Werte erlebten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ständige Korrosion. 1981 gab Stomma selbst zu, dass er 1946 die Dynamik des Kommunismus maßlos überschätzt hätte. Bedeutet dies etwa, dass es Stomma seinerzeit an Weitblick gefehlt hatte? Keineswegs. Viel besser als seine Opponenten erkannte er rechtzeitig, welche Art von Widerstand in einem sich etablierenden totalitären Staat möglich war. Er konnte sich in der Tat lediglich auf die Verteidigung der letzten ethischen Werte beschränken. Die Befürworter einer kühneren Taktik hatten hingegen keine Überlebenschance und wurden von den Stalinisten niedergewalzt.
Infolge der Gleichschaltung der polnischen Medien – etwa um 1948 – bildete sich nun um den „Tygodnik Powszechny“ eine erschreckende Leere. Trotz ununterbrochener Eingriffe der Zensur, die unzählige Beiträge absetzte bzw. verunstaltete, bewahrte die Zeitschrift bis zum Schluss ihren unabhängigen Charakter. Mit ihrem Grundsatz: „Lieber schweigen als lügen“, bildete sie nicht nur in Polen, sondern auch innerhalb des gesamten Sowjetimperiums im Grunde eine Ausnahme.
Das von Stomma Ende 1946 formulierte Konzept wurde etwa ein Jahr später von der ganzen Redaktion übernommen. Die Vorherrschaft der Partei und die soziale Umgestaltung, die die Kommunisten in Polen durchgeführt hatten, wurden von der „Tygodnik“-Gruppe nicht mehr in Frage gestellt. Zu einer ihrer wichtigsten Aufgaben machte sie nun den Kampf gegen die Totalisierung des Denkens und gegen die kulturelle Gleichschaltung. Der Versuch des Regimes, Polens Verbindungen sowohl zum Westen als auch zu seiner eigenen Vergangenheit abzuschneiden, wurde auf subtile Weise sabotiert. Im Reich der totalitären Propaganda bildete das Blatt eine Insel der Sachlichkeit. Die von der Zeitschrift angestrebte politische Enthaltsamkeit erreichte gerade jetzt, im System des hochentwickelten Stalinismus, eine beispiellose politische Brisanz. Denn der siegreiche Stalinismus basiert auf dem Grundsatz: „Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns“. Er verlangte von den Beherrschten, also von seinen Opfern, die totale Identifizierung mit den Zielsetzungen der Herrschenden, also der Täter. Eine nicht-engagierte Haltung setzte er mit Hochverrat gleich.
Im Grunde nahmen die Herausgeber des „Tygodnik“ die Erfahrungen der in den 1960er/70er Jahren entstandenen osteuropäischen Bürgerrechtsbewegungen um einige Jahrzehnte vorweg. Sie erkannten, dass die ansonsten unpolitische Dimension des Ethischen und des Kulturellen in den totalitären Systemen mit ihrem Absolutheitsanspruch eine eminent politische Rolle spielte.
Für ihre angeblich nicht-engagierte Haltung wurden die Herausgeber des Blattes von den Behörden unentwegt gerügt. Dessen ungeachtet weigerte sich der „Tygodnik“, mit dem Strom zu schwimmen und sich mit den vom Regime propagierten Wertvorstellungen zu identifizieren.
Das Scheitern des „fortschrittlichen Katholizismus“
In diesem Zusammenhang wird oft die Frage gestellt, warum sich die Stalinisten nach 1948 auf dieses Spiel eingelassen hatten. Warum erhielt der „Tygodnik“ nach der Zerschlagung beinahe aller unabhängigen Einrichtungen im Lande eine zusätzliche Gnadenfrist von etwa fünf Jahren? Und man muss hinzufügen, dass erst das Verhalten der Redaktion in diesen fünf Jahren der Zeitschrift die Bedeutung eines Symbols zu verleihen vermochte. Die außerordentliche Autorität, die das Blatt im Grunde bis heute genießt, ist in erster Linie auf sein antistalinistisches Heldenepos von 1948-53 zurückzuführen.
Die Sicherheitsorgane hätten nur eine halbe Stunde gebraucht, um die gesamte Redaktion auseinanderzujagen, schrieb später Leopold Tyrmand – einer der Mitarbeiter der Zeitschrift. Dass diese Aktion recht lange auf sich warten ließ, war sicher mit politischen Überlegungen der Staatsführung verbunden. Indirekt kam dem „Tygodnik“ die Tatsache zugute, dass es den Kommunisten nicht gelungen war, die Kirche mit Hilfe des sogenannten ‚fortschrittlichen Katholizismus’ zu spalten. Bei dem wichtigsten Exponenten dieser Richtung – Bolesław Piasecki – handelte es sich um eine der bizarrsten Gestalten der polnischen Nachkriegsgeschichte. Dieser ehemalige Vertreter eines radikalen Antisemitismus und Antikommunismus, Anführer der faschistoiden Organisation ,Falanga’, entwickelte nach 1945 eine der seltsamsten ideologischen Mischformen, die die Geschichte der Ideen kennt. Chauvinismus war hier mit einer servilen Einstellung gegenüber der Hegemonialmacht verknüpft, und diese Servilität setzte Piasecki mit Patriotismus gleich.
Das Regime setzte zunächst große Hoffnungen auf die Piasecki-Gruppe. Sie sollte ihm helfen, die Kirche auszuhöhlen und gefügig zu machen. Das Unternehmen erlitt jedoch ein vollkommenes Fiasko. Primas Stefan Wyszyński bezeichnete die Anhängerschaft des ehemaligen ,Falanga’-Führers in einem Hirtenbrief vom 9. November 1949 als ‚abtrünnig’.
Da das kommunistische Experiment mit dem ‚fortschrittlichen Katholizismus’ gescheitert war, vergrößerte sich die Bedeutung der „Tygodnik“-Gruppe. Das Vorhandensein eines katholischen Organs, das zwar offen seinen autonomen Standpunkt verteidigte, sich zugleich aber völlig loyal gegenüber den neuen Machthabern verhielt, brachte dem Regime gewisse Vorteile. Dies verlieh ihm und der von ihm durchgeführten Umgestaltung des Landes eine zusätzliche Legitimation.
Stalin-Nachruf
Es gehört jedoch zu den Wesenszügen der totalitären Regime, dass sie sich nicht nur vom rationalen Machtkalkül, sondern auch von irrationalen Motiven leiten lassen. Die stalinistische Führung war nicht gewillt und wahrscheinlich auch innerlich nicht in der Lage, dauerhafte innenpolitische Kompromisse einzugehen. In ihrem Streben nach absoluter Beherrschung der Gesellschaft, nach Vernichtung aller ‚abweichenden’ Tendenzen, konnte sie vor der Autonomie der Katholiken nicht Halt machen. Letztendlich musste auch der „Tygodnik“ für seine Unabhängigkeit mit einem Verbot bezahlen. Den Anlass hierfür lieferte die berühmt gewordene Weigerung der Redaktion nach dem Tode Stalins, einen Nachruf auf den Despoten zu veröffentlichen.
Über die gesamte polnische Presse … verbreitete sich das Gestöhne … eine groteske Verzweiflung“, schrieb Leopold Tyrmand in seinem „Tagebuch“. Nur der „Tygodnik“ hat sich geweigert, sich diesem Klagechor anzuschließen.
Trotz aller Einschüchterungsversuche seitens der Parteiführung rückten die Herausgeber von ihrem Standpunkt nicht ab. Stomma berichtet von einem Gespräch mit dem Politbüromitglied Franciszek Mazur, der ihn und andere Redakteure des Blattes zu überzeugen versuchte, in der Frage des Stalin-Nachrufes nachzugeben:
Sie sind naiv“, so Mazur, „niemand kann gegen den Strom der Geschichte schwimmen und jeder, der es versucht, wird hinweggefegt werden.
Dennoch erreichte das Regime mit dieser Forderung die für viele unsichtbare ‚letzte Verteidigungslinie’, hinter die es auch für die Verfechter des ‚katholischen Minimalismus’ kein zurück mehr gab. Stomma sagt dazu:
Seit Ende 1950 waren wir davon überzeugt, dass (die Auflösung der Zeitschrift) unausweichlich ist. Wir versuchten lediglich dieses Ende so weit wie möglich hinauszuschieben. Angesichts der damaligen Totalisierung des Denkens … gab es keinen Platz für ein so unabhängiges Blatt wie den „Tygodnik Powszechny“. Wir wussten genau, dass es nur ein Kampf um die Zeit war.
Und diese Zeit war schließlich im März 1953 abgelaufen. Die Gruppierung „Pax“ um Bolesław Piasecki übernahm die Herausgabe des „Tygodnik“. Die Zeitschrift, die sich nun in ein Sprachrohr des Regimes verwandelte, behielt ihren alten Namen. Dies war für die ursprünglichen Herausgeber des Blattes ein beispielloser Affront.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
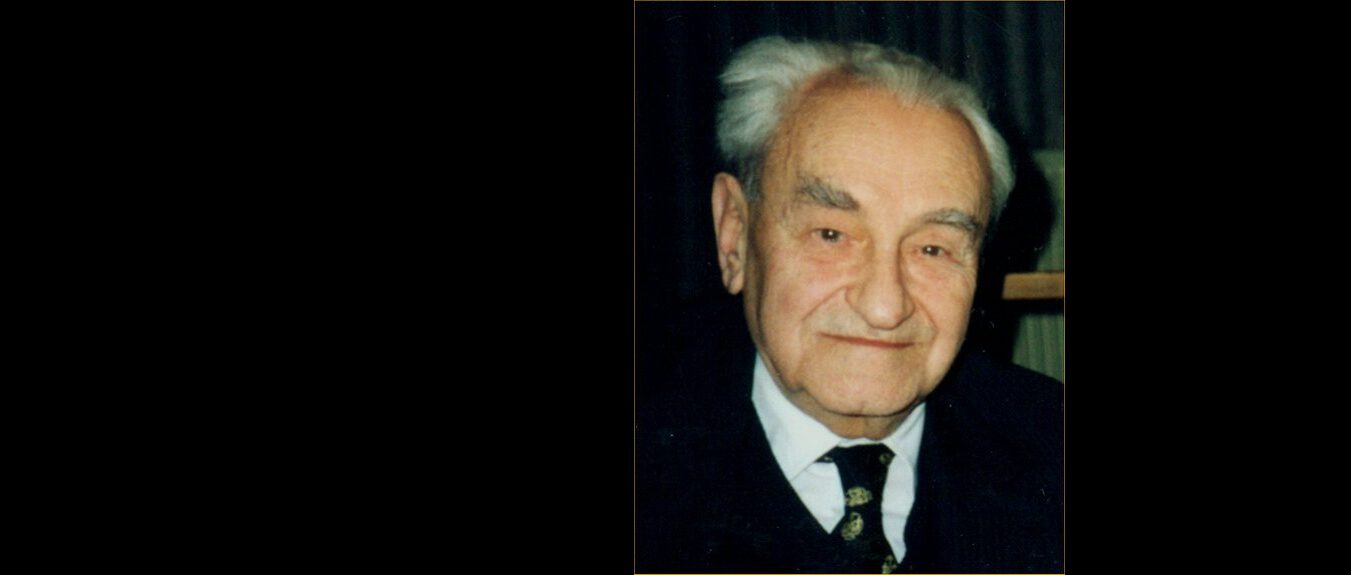


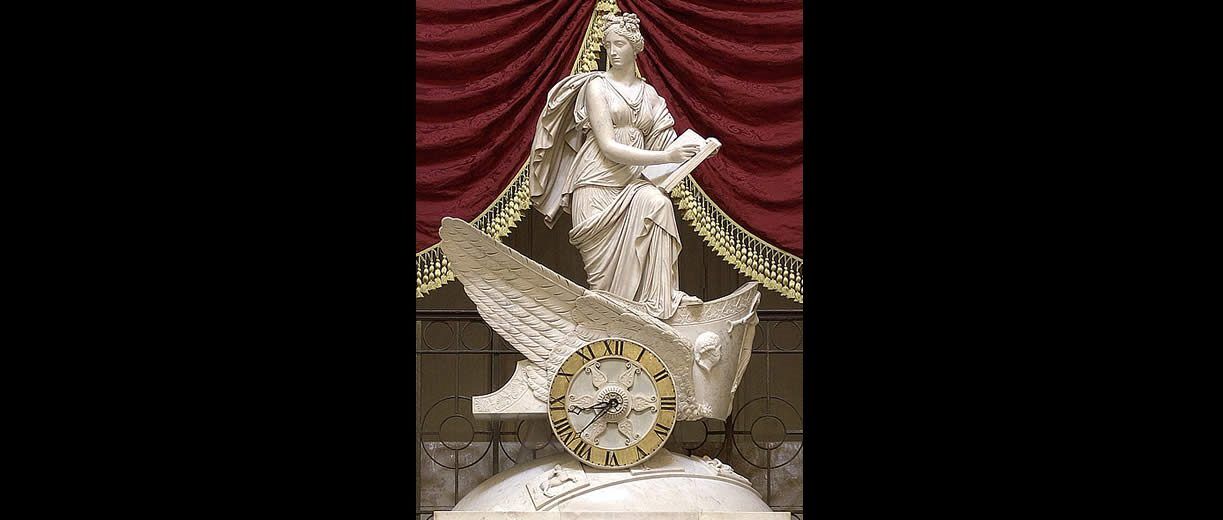

Ihr Kommentar