Biopics sind seit einiger Zeit en vogue. Nach „Elvis“, „Blond“, „Rheingold“, „AIR“, „Oppenheimer“, „Powell“ nun also „Maestro“: die Verfilmung des Tag & Nacht von Musik geprägten Lebens der US-amerikanischen Komponisten- & Dirigenten-Legende Leonard Bernstein. Mit Bradley Cooper [der ebenfalls Regie führte und am Drehbuch mitschrieb] und Carey Mulligan in den Hauptrollen.
Ich geb’s zu – ich bin kein allzu großer Freund dieses Genres. Die meisten Biopics kleben für meinen Geschmack zu sehr dran an der Realität und wirken deshalb oft spröde (Elvis) bis hin zu zäh (Oppenheimer). Ganz schlimm wird es, wenn das Leben von Politikern minutiös nacherzählt wird – bspw. Vice – Der zweite Mann oder LBJ – John F. Kennedys Erbe –; dabei schlafe ich dann entweder ein oder zappe weiter zu ner Zombie-Serie. Der Schwachpunkt des Biopics liegt darin, dass Drehbuchautor & Regisseur eine möglichst große Spannweite der Biografie des jeweils im Mittelpunkt stehenden Promis auf der Leinwand abbilden wollen. Bei Oppenheimer umfasste die Geschichte 30 Jahre, was zum einen echt viel ist und zum anderen spätestens zur Hälfte der Handlung hin beim Zuschauer unweigerlich den Eindruck von Langatmigkeit entstehen lässt.
Ich erwartete vom in meinem Netflix-Account seit Weihnachten angepriesenen Streifen „Maestro“ also nicht sonderlich viel, klickte trotzdem auf „abspielen“ und wurde zu meinem Erstaunen wirklich angenehm überrascht.
Das Leben eines Ausnahmekünstlers
Die Story startet Anfang der 40-er Jahre, als der junge Komponist Leonard Bernstein (Bradley Cooper) einen Anruf des Managers der New Yorker Philharmoniker erhält, ob er kurzfristig für deren erkrankten Dirigenten einspringen und bei einem Konzert in der Carnegie Hall den Taktstock schwingen könne. Der Film zeigt diesen Moment in Schwarzweiß: der Raum ist dunkel, dann öffnet Leonard den Vorhang wie auf einer Bühne, im Anschluss beschleunigt die Kamera das Tempo: Wir begleiten den Protagonisten im Laufschritt und erleben mit, wie er nahezu fliegend am Dirigenten-Pult anlangt. Die Vorstellung wird ein voller Erfolg, Bernsteins Name ist seit diesem Abend in aller Munde. Auf einer Party lernt er die Chilenin Felicia Montealegre (Carey Mulligan) kennen; zwischen den beiden funkt es sofort, sie werden ein Paar. Felicia ermuntert ihren Verlobten, dem Wunsch seines Agenten auf keinen Fall nachzugeben, der ihm zu völliger Konzentration aufs Dirigententum rät, sondern sich stattdessen der einzig wahren Passion, dem Komponieren von Musikstücken, zu widmen. 1951 heiraten Felicia & Leonard, beziehen eine schicke Wohnung am New Yorker Central Park, bekommen 3 Kinder, die Ehe scheint glücklich zu sein. In dieser Phase entstehen Evergreens wie „Wonderful Town“, „Candide“, „West Side Story“, die Filmmusik zu „Faust im Nacken“ und die „Symphony Nr. 3 Kaddish“.
Jetzt erfolgt ein Zeitsprung in die späten 60-er Jahre – Festivität im Hause Bernstein: viele Künstler und noch mehr hippe Beinahe-Künstler versammelt. Man sieht Felicia in der Rolle der Gastgeberin und Mutter, während sich Leonard wie ein Fremder auf der eigenen Party benimmt. Er verschwindet plötzlich, wird von Felicia gesucht und im Treppenhaus beim Knutschen mit einem jungen Mann erwischt. Sie sagt nichts, wendet sich um und geht schweigend zurück zu ihren Gästen. Leonard folgt ihr mit beschwichtigenden, jedoch augenscheinlich ins Leere laufenden, Worten. Der Zuschauer begreift, dass sich die Handlung nun an einem Wendepunkt befindet. Mehr soll an dieser Stelle nicht gespoilert werden.
Fokus liegt auf komplizierter Ehe
Während ich bei Biopics sonst oft meckere [ja ja, alte Männer meckern eh gerne], weil ich sie als weitschweifig empfinde, gilt das für „Maestro“ erfreulicherweise nicht: mit 2 Stunden verfügt der Film über eine gute Länge [einige Passagen hätte die Regie zwar kürzer abspulen können, die erschienen mir künstlich aufgebläht zu sein; jedoch sind 120 Minuten für eine mehr als 4 Jahrzehnte umfassende Spanne völlig okay] und es kommt in keinem Moment Langeweile auf. Das liegt aber stark an der erzählten Geschichte, die sich nicht an Bernsteins Œuvre entlanghangelt und dabei minutiös jeden Meilenstein herausstellt, sondern den Fokus stattdessen auf sein kompliziertes Liebesleben legt. War er immer schon schwul – und hat Felicia bloß aus beruflicher Räson geheiratet –, handelte es sich um eine komplette sexuelle Umorientierung, die während der Ehe einsetzte, wusste seine Frau von Anfang an Bescheid, oder wurde ihr die Angelegenheit schlagartig erst bei der Szene im Treppenhaus klar? Bernstein-Experten werden die Antworten kennen; ich bin allerdings kein Bernstein-Experte, habe bloß „Maestro“ & „Westside Story“ gesehen und kann deshalb nur spekulieren: Ja (1), Leonard war immer schwul [zumindest bi, mit einer im Alter stärker werdenden Tendenz in Richtung gleichgeschlechtlich] und hat seine Frau aus einer gemischten Motivationslage heraus geehelicht = im prüden Nachkriegsamerika wäre es für einen homosexuellen Dirigenten ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, die Karriereleiter zu erklimmen und ja (2): er hat Felicia geliebt; vermutlich mehr platonisch als körperlich, aber er hat sie geliebt. Zumal – was ihm nicht entgangen sein wird – er seine schöpfungsreichste Periode in den zwei Jahrzehnten aufwies, in denen Felicia eng an seiner Seite stand. Sobald sie Scheidungstendenzen signalisierte und sich räumlich von ihrem Mann trennte, ging es künstlerisch mit Leonard bergab. Er blieb zwar weiterhin ein weltweit umjubelter Starmaestro, dem das Publikum nach jeder Aufführung tosenden Applaus zollte; allerdings entstand seit Anfang der 70-er kein nennenswertes Musikstück mehr aus seiner Feder. Lovestorys – vor allem tragisch verlaufende – sind ein Stoff, aus dem auch ein unterhaltsames Biopic gewebt werden kann. Wen interessiert schon die Entstehungsgeschichte von „West Side Story“, wenn er stattdessen an einem Ehedrama teilhaben kann?
Felicia ist die wahre Heldin der Geschichte
An dieser Stelle wollen wir kurz mit Musik & Genie innehalten und uns der Frage zuwenden, von wem das (Film-) Stück eigentlich handelt bzw. wer in dessen Mittelpunkt steht. Selbstverständlich Bernstein (m), sagen Sie, die Überschrift lautet ja eindeutig „Maestro“? Das sehe ich leicht anders. Natürlich ist der Film ohne Leonard undenkbar, aber noch undenkbarer wäre er ohne Felicia. Ohne sie kein erfolgreicher Komponist, ohne sie keine – in den ersten Jahren glückliche – Familie, ohne sie keine 3 Kinder. Sie hält den Laden zusammen und nimmt sich selbst völlig zurück, um das Licht des Ruhms ungefiltert auf ihren Gatten strahlen zu lassen. Felicia ist die stille Heldin dieses Dramas. Diese Rolle ist Carey Mulligan wie auf den Leib geschneidert: Sie spielt sowohl die frisch verliebte als auch die junge glückliche Mutter sowie die ins Zweifeln geratene ältere Ehefrau zu 100 Prozent überzeugend. Sie macht das perfekt, ist jederzeit ehrlich und authentisch, wo man manch anderen manieriert finden kann. Denn Cooper überzeichnet streckenweise bei der Darstellung des Maestros. Gut gelingt ihm der jungenhafte Bernstein [die 45 Minuten, die in Schwarz-Weiß gezeigt werden]; während die nachfolgende Stunde [startend mit der Party-Sequenz im Hause des Maestros] mich manchmal zweifeln ließ, ob ich einen „realen“ (iSv. wirklichkeitsnah) oder einen künstlich angeschwulten Leonard präsentiert bekomme. Denn so homosexuell affektiert wie in der zweiten Halbzeit der Geschichte gab er sich anfangs nicht. Entweder hatte also in den 70-er Jahren ein Sinnes- & Verhaltenswandel eingesetzt, oder aber der Drehbuchautor hat’s mit dem späten Schwulsein des Künstlers übertrieben. Vielleicht um fiktiv einen deutlichen Kontrast zur sich selbst treu bleibenden Felicia zu setzen. Sei’s, wie es sei – hin und wieder überkam mich der Eindruck, hier nicht dem „realen“ Bernstein, sondern einer von Bradley Cooper dramaturgisch verfremdeten Kunstfigur zu begegnen.
Ein weiteres Manko des Films besteht darin, dass er viel zu sehr auf Leonard abzielt und die Geschichte von Felicia sträflich außen vorlässt. Denn auch sie war in den 40-er- und frühen 50-er-Jahren eine erfolgreiche Bühnen- und Fernsehschauspielerin, opferte ihre Karriere für die Familie, stand nach der Trennung von Leonard kurz vor einem beruflichen Neuanfang. Das wird zwar en passant ab und an angerissen; aber nie auch nur halb so ausführlich abgehandelt wie die einzelnen Konzertauftritte [von denen es ne Menge zu sehen gibt] ihres Göttergatten. Felicia wird vom Autor doch stark auf die 2 Funktionen Ehefrau + Mutter reduziert. Dass sie selbst ein TV-Star war, findet kaum Erwähnung. Man könnte glatt von einem patriarchalisch verengten Blickwinkel des Regisseurs sprechen.
Die Dialoge zwischen ihr und Leonard passen wiederum, wirken nie gekünstelt oder hölzern. So wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen den beiden abgelaufen sein.
Zwischenfazit an dieser Stelle: „Maestro“ liefert – speziell für das ansonsten eher spröde Genre „Biopic“ – gute Unterhaltung. Das liegt an 2 Faktoren: der Fokus wird auf das (komplizierte) Eheleben des Künstlers gelegt + Carey Mulligan geht völlig auf in der Rolle der Felicia.
Maestro: oscartauglich?
Nachdem Netflix im vergangenen Jahr mit der Neuverfilmung von Im Westen nichts Neues 4 Oscars abräumte [u.a. als bester internationaler Film], soll „Maestro“ bei der Preisverleihung im März 2024 noch erfolgreicher abschneiden. Ob es in den Hauptkategorien [bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch] gegen die beiden Favoriten Barbie und Oppenheimer reichen wird, bleibt mit einer gehörigen Portion Skepsis abzuwarten. Außenseiterchancen rechnen sich Bradley Cooper als „bester Hauptdarsteller“ und Carey Mulligan als „beste Nebendarstellerin“ aus. Bei Hauptdarsteller wird zwar vermutlich Margot Robbie (Barbie) das Rennen machen; aber Mulligan hätte den Oscar für ihre Interpretation der Maestro-Gattin auf jeden Fall verdient (ob sie ihn bekommt, ist wegen der starken Nebendarsteller-Konkurrenz aus Barbie & Oppenheimer jedoch ebenfalls ungewiss].
Wo sich „Maestro“ allerdings berechtigte Hoffnungen auf den Award machen kann, ist die Spezialdisziplin „Make-up“ [hier auch bereits nominiert] . Der Visagist Kazu Hiro hat Carey Mulligan & Bradley Cooper sowohl in ein den beiden Vorbildern Felicia & Leonard verblüffend ähnelndes Ehepaar verwandelt als die 2 auch überzeugend altern lassen. Ärger gab’s zwischenzeitlich mit der Nasenprothese des Protagonisten. Die schien der politisch hyperkorrekten Fraktion wahlweise übertrieben oder für einen Nicht-Juden unstatthaft zu sein, weshalb von (politisch unkorrektem) Jewfacing die Rede war. Obwohl schnell klargestellt wurde, dass die Nase 1 zu 1 der des realen Maestros entspricht und seine Kinder, die natürlich dazu befragt wurden, keinerlei Probleme mit dem filmischen Zinken [an dieser Stelle nur aus dem Grund verwendet, um das Wort „Nase“ nicht ständig zu wiederholen. Auf gar KEINEN Fall despektierlich gemeint!] haben, beruhigte das die politisch hyperkorrekte Fraktion natürlich nicht, die blieb weiterhin empört; weshalb Kazu Hiro dann alle zerknirscht um Verzeihung bat, die sich durch die realitätsgetreue Darstellung in ihren Gefühlen verletzt empfanden. Gottseidank ging das Schuldempfinden der Filmmacher nicht so weit, den Zinken [pardon: die Nase des Künstlers] nachträglich wegzuradieren, sodass der Zelluloid-Leonard dem realen Bernstein von der reinen Optik her nach wie vor weitgehend entspricht.
Besonders hervorzuheben ist die Bildgestaltung von Matthew Libatique [speziell die ersten 45, in Schwarz-Weiß gedrehten, Minuten sind hinsichtlich des gekonnten Einfangens der 40er- & 50er-Jahre-Stimmung visuell außerordentlich gelungen]; aber auch bei „beste Kamera“ wird’s sehr schwer werden, sich gegen die 2 Topfavoriten durchzusetzen.
Maestro ist ein sehr gutes Biopic; handwerklich virtuos, sich dabei phasenweise an das schwierige Thema verschleierter Homosexualität herantastend. Der Film bleibt dabei aber stets schamhaft; als ob man bei den Liebesszenen dann plötzlich doch Angst vor der eigenen Courage bekam und die deshalb auf jeweils wenige Sekunden beschränkte. Dahinter steckt vermutlich der Wunsch der Produzenten, bei den Preisverleihungen wählbar sowohl für konservative als auch liberale und besonders woke Juroren zu sein.
Von mir gibt’s 8.5 Punkte (2 davon für Carey Mulligan).
+++
Maestro
Erscheinungsjahr: (Herbst) 2023
Länge: 120 Minuten
Regie: Bradley Cooper
Drehbuch: Bradley Cooper & Josh Singer
Produktion: Fred Berner, Bradley Cooper, Amy Durning, Kristie Macosko Krieger, Martin Scorsese, Steven Spielberg
Vertrieb: Netflix
Darsteller: Bradley Cooper, Carey Mulligan, Maya Hawke, Matt Bomer, Vincenzo Amato u.a.
Erhältlich einzig bei Netflix.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.




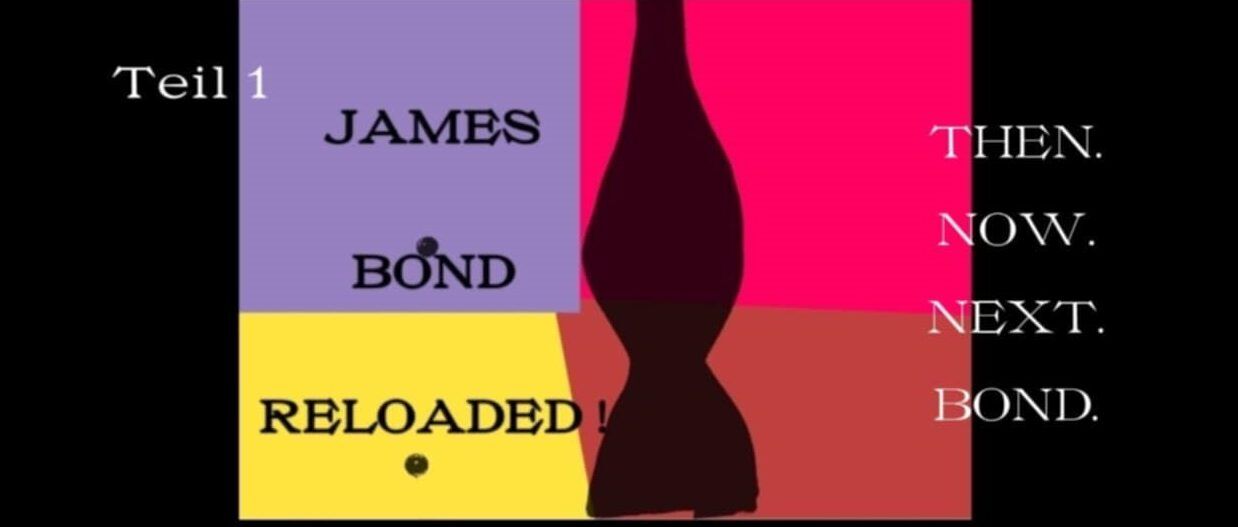
Ihr Kommentar