Nun, sie war kein „Pölenkind“, sie war eine deutsche Frau, die als Kind einer zwar nicht reichen, immerhin aber finanziell gut gestellten Familie aufwuchs. Ihre Generation der Familie war entgegen den damals üblichen Großfamilien überschaubar, neben ihr gab es lediglich einen fast gleichaltrigen Stiefbruder, der aber schon bald nur aus weiter Ferne grüßte und die Heimat fluchtartig verließ. Denn es waren schlimme Zeiten für Kinder, die in den Jahren um ’33 herum geboren waren und den Größenwahn des selbsternannten Führers ertragen mussten.
Doch es ging lange gut, der Krieg war allgegenwärtig und gleichzeitig weit genug entfernt, um das Leben nicht sonderlich zu beeinflussen. Man war deutsch, die Schmach von Versailles nagte noch am Nationalstolz, der Feind im benachbarten Russland war klar definiert und die Gräuel der Vernichtungslager – so weit überhaupt bekannt – durchdrangen nicht den Panzer der gut behüteten Kindheit. Die Familie galt etwas im Ort und die Zukunft lag trotz der dunklen Wolken am Horizont hell und leuchtend vor ihr.
Stolzer Held
Dass der Vater unter dem ollen Wilhelm zunächst ein stolzer, junger Grenadier war, später aber ein Kriegsversehrter, dem ein Schrapnellsplitter vom Steißbein bis hinauf zum Nacken eine Erinnerung an den Wahnsinn und den schmalen Grat, auf dem ein stolzer Held des Vaterlandes stets wandelt, in die Haut brannte, führte zu einer seltsam distanzierten Sicht auf die Vorgänge der damaligen Zeit. Heimat ja, aber nicht um jeden Preis. Später, nachdem der zweite Jahrhundertwahnsinn ein Ende hatte und sich die Überlebenden, zerstreut in alle Himmelsrichtungen, neu organisierten, fuhr man zwar zu den Treffen der Landsmannschaften, fand aber in der CDU eine anständige politische, in der katholischen Kirche die altvertraute religiöse Heimat. Nazis gehörten nicht zum Leben dazu, der geistesgestörte Mann mit dem komischen Schnäuzer wurde nie erwähnt, eine wirkliche politische Aufarbeitung fand nicht statt.
Erzählt wurde von diesen Zeiten aber viel, die Geschichten drehten sich – natürlich – voller Wehmut um das, was man zurücklassen musste auf dem Weg mit Pferdewagen und Handkarren in den sicheren Westen, die geschundene und geschrumpfte Rumpfheimat. Der Russe war auf eine vage Art böse oder tölpelhaft, aber auch nicht schlimmer als der Gastarbeiter im bald boomenden Wirtschaftswunderland im Ruhrgebiet. Der war ja fremd, hatte komische Angewohnheiten, wenn man aber schon mit ihm arbeiten musste, konnte man sich auch gleich an ihn gewöhnen. Und schon war er gar nicht so schlimm, fast sogar nett und sympathisch. So ähnlich war es mit dem Russen.
Herr im Land
Dann war da noch der Pole, aber der war Nachbar, Freund, Klassenkamerad, Arbeitskollege, Mitarbeiter und nahezu gleichwertig. Vor allem war er ein ewiges Opfer der endlosen Kriege in dieser Region Europas, gehörte mal hierhin und mal dorthin, manchmal sogar sich selbst bei stets sich verschiebenden Grenzen und neuen Siegern. Bald schon würde es wieder einen Wechsel der Herren geben, denn seit 5 Uhr 45 wurde zurrrrückgeschossen und das reinste aller Völker war der Herr im Land. Nicht lange, aber zu lange und um einen hohen Preis.
Nach dem Krieg, als Osten und Westen durch einen Vorhang aus Eisen getrennt waren, floss immer wieder ein Teil des nun bescheideneren Wohlstands mittels oft geöffneter und reduzierter Päckchen hindurch zu den Menschen, die Dank der Gnade ihrer Gene in der alten Heimat bleiben durften. Die Kontakte blieben bestehen, ein Leben lang. Päckchen, Briefe, Telefonate, immer wieder persönliche Besuche in beide Richtungen.
Der Bruder
Auch der Bruder reiste eines Tages aus dem weit entfernten Land an, in das es ihn auf der Flucht vor dem Krieg als Jugendlichen verschlagen hatte. Vor diesem weltumspannenden Krieg konnte er frühzeitig fliehen, die Flucht vor der Enge seiner inneren Welt gelang ihm viele Jahre nicht. Die neue Heirat des Vaters nach dem Tod der Mutter, die Rolle des Stiefkindes bei der neuen Mutter, der Krieg und die Angst, gegen seinen Willen zum sinnlosen Töten verpflichtet zu werden waren seine Lebensbegleiter, die Geister, die er nie rief und die dennoch stets in seiner Nähe waren. Trotz der Versuche, die schlimmsten Auswüchse mit Wodka zum Frühstück zu verbergen, weil der weniger intensiv zu riechen war als die anderen alkoholischen Getränke, war seinem Umfeld klar, wie es um ihn stand. Alle Hilfsangebote wies er von sich, bis eines Morgens im Badezimmer Jesus zu ihm sprach und die Abkehr von seinem Weg ins Unglück befahl. Wie immer man nun solche Stimmen beurteilen mag, für ihn war es die richtige Stimme zur richtigen Zeit, und wenn jemand Verständnis dafür hatte, dass Menschen solche Erfahrungen machen, dann waren es seine Nachbarn. Die bekamen ein neues Mitglied für eine der vielen christlichen Gemeinden, die es in diesem Land gibt, dankten dem Herrn und machten ihn zum Missionar ihrer Kirche.
Stand es um seine Ehe schon wegen des Alkohols nicht gut, die Droge des missionarischen Eifers gab ihr den Rest. Kein lebendes Wesen, das von seinem Eifer verschont blieb, niemand konnte seinen Bekehrungsversuchen entkommen, vermutlich ächzten selbst die Steine unter seinen Füßen vor Entsetzen, wenn er auf der Suche nach willigen Schäflein für seine neue Gemeinde war. Wie familiäre Bande auch über Kontinente hinweg wirken, kennt man aus den Erzählungen von Zwillingen, auch hier gab es sie – auch wenn sie nur Halbgeschwister waren. Zu der Zeit, wo der Bruder zu seinem Glauben fand, weil der Herr ihn rettete, verlor seine Schwester ihn, weil der Herr während einer schweren Krankheit nicht rettend zur Stelle war. Mag sein, dass dieser Herr nicht multitaskingfähig ist und sich nicht auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren kann, jedenfalls blieb die Welt im Gleichgewicht – ein Schäfchen kam, ein anderes ging.
Letzter Blick
Aber der Glaube ist nicht per se schlecht, denn der Bruder war zuvor ein guter Mensch und das blieb er auch im Glauben. Als nun also dieser Bruder eines Tages vor dem ehemaligen Haus der Familie stand und sich den nun polnischen Besitzern zu erkennen gab, war die Unruhe groß. Es konnte ja wieder einer von denen sein die nun kamen, um Besitzansprüche geltend zu machen und die neuen Bewohner zu vertreiben. Doch danach stand ihm nicht der Sinn, es war nicht mehr und nicht weniger als ein letzter Blick auf die Vergangenheit, eine Form von Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte, der Abschluss des Teils einer Geschichte, die ihn neben dem Anlass des Krieges in die Fremde getrieben hatte.
Und Gott sah es und befand es für gut, so entließ er ihn aus seiner Knechtschaft und aus dem Missionar wurde im Laufe der Jahre ein ganz normaler Mensch. Kein Alkohol, kein Gott mehr, dafür die endgültige Rückkehr in den Schoß der Ehe, noch viele Jahre bis zur letzten Stunde seines Lebens. Seine Asche ruht auf dem Grunde des Pazifik, dem Ozean, über den ihn seine Flucht trieb. Die alte Heimat war ihrer nicht würdig.
Apfelsine
Die Besucher der Schwester in der alten Heimat waren anderer Natur und regelmäßig, lebten doch noch viele gute Freunde aus den Tagen der Kindheit dort. Der Krieg zog seine Grenzen zwischen die Wohnorte der Menschen, die Herzen durchtrennte er nie. Mitbringsel, im Westen nur noch mäßig gewürdigt und längst zum Alltag gehörend, konnten Sturzbäche an Freudentränen auslösen.
Eine Apfelsine, eher zufällig vom Reiseproviant verblieben, machte das beschenkte Kind fassungslos. Das war nicht einfach eine Apfelsine, die geschält und zwischen Leberwurstbrot und Abendnachrichten so nebenher gegessen wurde – das war eine Kostbarkeit, die erst Weihnachten hervorgeholt und gegessen würde. Nein, nicht gegessen, sondern ehrfurchtsvoll und in tiefster Dankbarkeit als eigentlicher Hauptgang des weihnachtlichen Festmahls verspeist würde!
(Viele Jahre später erlebte ich selbst eine solche Anekdote, wie sie mir damals zu Gehör gebracht wurde. Im Westen, im reichen Deutschland der Jetztzeit, dem Land, in dem wir gut und gerne leben, saß ein kleines Mädchen staunend vor meiner Freundin, während die sich eine Apfelsine schälte und sagte mit leuchtenden Augen: „Oh, eine Apfelsine! Die gibt es bei uns immer nur Weihnachten!“ Nach einem solchen Erlebnis schmeckt eine Apfelsine nie mehr wie zuvor, der Gedanke an dieses Kind kommt immer wieder auf).
Es gab auch Geschichten von der Flucht, Tauschgeschäfte – Geige gegen Brot. Menschen, die am Wegesrand liegen blieben und die neue Heimat nie erreichten, Hunger und Durst, angeschimmeltes Brot als Schatz, den Eltern lieber den Kindern gaben und ihren knurrenden Magen ertrugen, böse Soldaten und gute Soldaten, das treue Pferd, das unter dem Gewaltmarsch zusammenbrach, die Anstrengungen, beim Besteigen der überfüllten Züge nicht getrennt zu werden, die wenigen Habseligkeiten, die man retten und die vielen, die man aufgeben musste, Registrierung, Sammelunterkunft in Unna-Massen, Trennung von Teilen der Familie und Verteilung in die nächsten Unterkünfte, das nächste Wohnheim und irgendwann – endlich!!! – die erste eigene Wohnung. Kein weites Land, kein Eigentum, keine Freunde, keine Arbeit, keine Vorstellung hinsichtlich der Zukunft. Oft genug erfuhren sie den Neid derer, denen es besser ging. Heute heißt es in bestimmten Kreisen gerne, dass es damals ja Deutsche waren, die auf der Flucht innerhalb der Heimat mit offenen Armen empfangen wurden, arme Landsleute und keine „Asyltouristen“. Das Gedächtnis der Geschichte trügt nicht, Missgunst, Neid und Hass findet sich selbst in der kleinsten Keimzelle der Gesellschaft, in der Familie. So auch unter den eigenen Landsleuten.
Arbeiten konnte nur die Mutter, der Vater war durch. Zwei Kriege, zwei Niederlagen. Zwei Mal alles gegeben, das Leben den Führern anvertraut. Geglaubt, gehofft, enttäuscht. Verloren die Heimat, verloren alles, was die Vorfahren geschaffen haben, verloren die Vergangenheit und die Zukunft, verloren die Gesundheit. An der Wurzeln getrennt, auf dem Feld des Krieges verdorrt, vom Winde des europaweiten Chaos in eine Welt geweht, die nicht seine war und die es nie sein würde.
„Du hast ja Einfälle wie ein altes Haus!“ war nicht nur der ständige Spruch seiner Frau, der Mutter des Pölenmädchens, es war die Beschreibung des endgültigen Verfalls, die Selbstaufgabe, die „Verkalkung“. Es war die Demenz, und da gingen die schlimmsten letzten Jahre zuerst verloren. Manchmal kann auch eine solche Erkrankung eine Gnade sein, zumal es bei ihm bis zum Ende kindliches Staunen war, wenn er angesprochen wurde und keinen Bezugspunkt zur Wirklichkeit der ihn umgebenden Menschen hatte, kein sichtliches Leiden. Was er von seinem Ende mitbekam, blieb unklar, besser als ein Dahinsiechen in den Schützengräben von Verdun oder im eisigen Frost von Stalingrad war es gewiss.
Einen Enkel, die glücklichere Form der Zukunft, sollte er noch erleben dürfen, wenige Jahre nur und selbst die nicht im vollen Bewusstsein. Die weiteren zu erleben war ihm nicht vergönnt.
In die Zukunft
Sie aber, die Tochter und Mutter der Enkel, das Mädchen, ging in die Zukunft, denn die gehörte ihr. Es war ein unerwartet leichter Weg hinein in die Gesellschaft der neuen Bundesrepublik, mit Arbeit für den Mann und Haushalt für die Frau, dem ersten eigenen Telefon und dem TV in Schwarz und Weiß, mit Kuhlenkampf und Rosenthal, mit Uwe Seeler und Franz Beckenbauer, dem Familienopel und der ersten Flugreise, mit Freddy Quinn und Heino, Oswald Kolle und Uschi Glas, VW Käfer und Mondlandung, Neckermann und Rabattmarken, Hippies und Dauerwelle, Bockwürstchen und Kartoffelsalat, Pfirsichbowle und Streuselkuchen, mit Gummibaum und Nierentischchen, Kohleofen und Zechensiedlung, Platzdeckchen und Wackeldackel, Waschmaschine und Trockenhaube. Das Wirtschaftswunderland riss die Menschen mit, Deutsch sein war kein Makel mehr, für die Beschäftigung mit der Vergangenheit blieb nur wenig Zeit. Der eine oder andere stramme Nazi in den Regierungen der neuen Bundesrepublik – ja nun, wir blicken nach vorne und nicht jeder war ja ein Nazi, nur weil er mal eine paar Hinrichtungen unterschrieben oder ein paar Familien enteignet hat. Hätten wir nicht alle so gehandelt, was hätte man denn tun können? Es waren halt schlimme Zeiten, wer möchte da den ersten Stein werfen? Na also, es geht doch, weiter jetzt mit Foxtrott und einem Gläschen Kellergeister.
Doch gerade wer in diesen Zeiten groß geworden ist, für den bleibt die Vergangenheit immer ein besonders intensiver Teil der Gegenwart, eine solche Vergangenheit prägt und bereitet den weiteren Weg. Sie soll nicht da sein, aber wie die Gespenster, die das kleine Kind in der Dunkelheit nicht sieht, während sie unter dem Bett lauern und sich den klammheimlich den Weg in die Träume bahnen, wartet sie geduldig. Sie hat Zeit, denn sie wird immer da sein, auch wenn die Menschen, die sie geprägt haben, längst zu Staub zerfallen sind.
Und so ging das Mädchen voran in sein neues Leben, mit den unsichtbaren Schatten an seiner Seite. Das Leben verlief in Kurven, mit manch einem auf und manch einem ab. Es war leicht und schwer, denn die Zukunft sollte der Vergangenheit gleichen, doch wir wissen, das solche Wünsche beide nicht interessiert. Es ist eine lange Geschichte, und zum Glück münden solche Geschichten manchmal in einem späten Happy End.
Das aber wäre eine spätere Folge dieser Erzählung.
In einem kleinen Teiche,
da fischt man eine Leiche,
die war so schön.
Sie trug ’nen Zettel in der Hand,
darauf geschrieben stand:
Ich hab einmal geküßt
und schwer gebüßt.
https://www.volksliederarchiv.de/in-einem-polenstaedtchen/
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



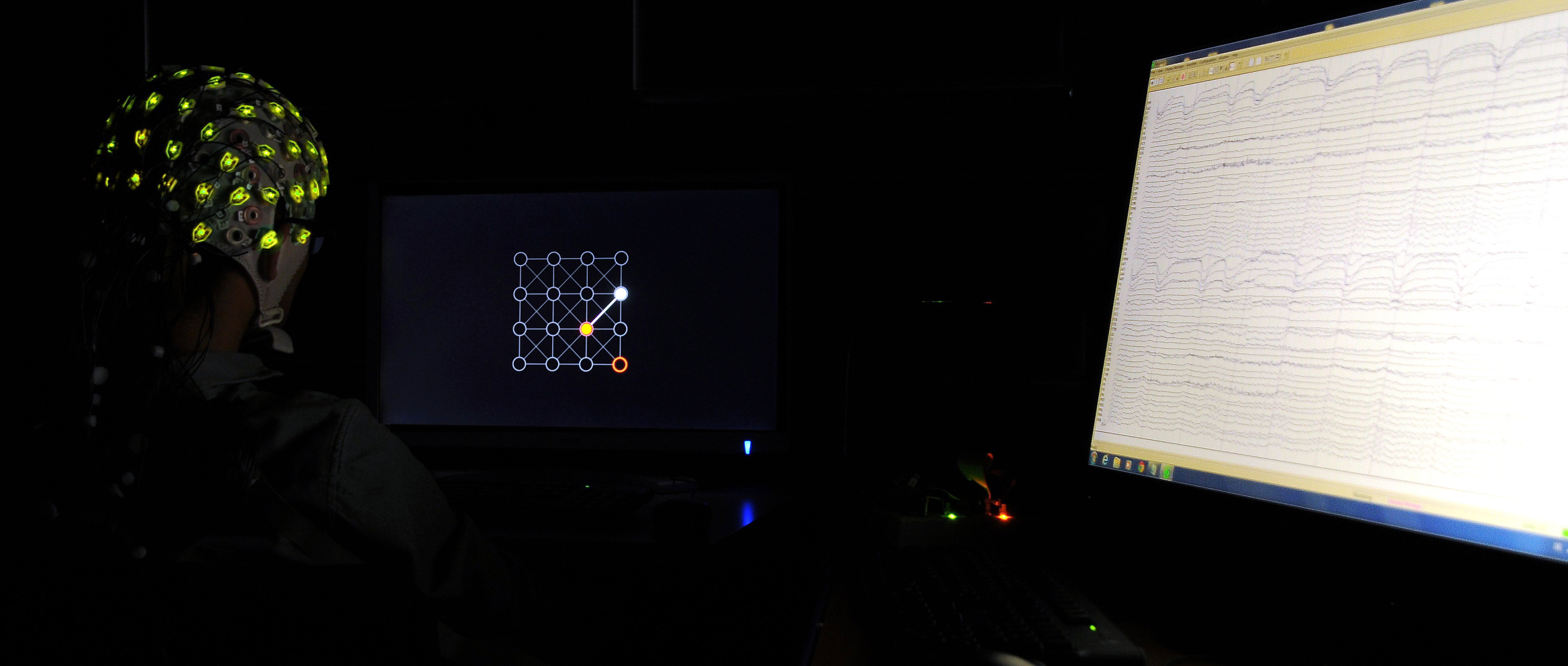
Sabine Klante-Allweier
Wieder ein Schmakerl aus der Fischerfeder. Lebendige Bilder , die ich genauso erzählt bekommen habe, ja das treue Pferd, ich glaube es variert immer nur die Farbe. Was mir besonders gefällt ist das unausgesprochene, das was in unseren Genen steckt. Die Angst vorm Krieg aber auch die vertane Chance der Aufarbeitung. So brauchen wir diese Geschichten , um nicht zu vergessen. Denn nun sind wir dann, da die Alten gehen.