Der Tag ist gekommen: Was lange Jahre unvorstellbar schien, ist seit gestern Realität. Erstmals seit der Revolution 1959 steht kein Castro mehr an der Spitze des kubanisches Staates. Schon 2008 hatte sich der inzwischen verstorbene Revolutionsführer Fidel Castro aus dem Präsidentenpalast zurückgezogen, nun tat es ihm sein jüngerer Bruder und Nachfolger Raul gleich. Mit Miguel Diaz-Canel regiert nun ein Berufsfunktionär aus der zentralkubanischen Provinz Santa Clara die Insel, der erst ein Jahr nach dem Putsch der Castro-Brüder gegen den Diktator Fulgencio Batista das Licht der Welt erblickt hat. Vorerst wird ihm der 86-jährige Raul – zumindest Stand jetzt, wie ein gewisser Niko Kovac sagen würde – aber als Oberaufseher erhalten bleiben. Erst 2021 soll Castro II auch den Vorsitz der Kommunistischen Partei abgeben.
Bereits seit Ankündigung des Präsidentenwechsels rätseln Kuba-Experten aus aller Welt, was will und was darf der neue Staatschef im siechen sozialistischen Staat ändern. Nun ist außerhalb Kubas wenig über Havannas neuen starken Mann bekannt. Diaz-Canel, der optisch irgendwie wie eine Mischung aus Bill Clinton und Egon Krenz daherkommt, ist ausgebildeter Elektroningenieur, hat aber eine blitzsaubere Parteikarriere in der Provinz hingelegt. Als junger Kader soll er liberal und pragmatisch gewesen sein, andere nennen ihn einen typischen Apparatschik. Als Funktionär war er später jedenfalls so fähig und systemtreu, dass er auf das Radar von Raul gelangen konnte. Der jüngere Castro hat Diaz-Canels Aufstieg fortan Schritt für Schritt möglich gemacht. 2003 zog der Aufsteiger, der heute seinen 58sten Geburtstag feiert, als jüngstes Mitglied ins Politbüro der kubanischen KP ein. 2009 ernannte ihn Raul zum „Minister für Höhere Bildung“.
Provinzkader folgt auf Revolutionslegenden
Wenn der Spruch „wie der Herr, so´s Gescherr“ stimmt, dann wird Diaz-Canel zunächst einmal den bisherigen Kurs fortsetzen, was bedeutet: vorsichtigste Wirtschaftsreformen ja, politische Freiheiten nein. Allerdings entscheidet sich Kubas Schicksal nicht nur in Diaz-Canels Staatskanzlei oder in Rauls Parteizentrale, sondern vor allem in Peking und Caracas – und zum Teil auch im Weißen Haus. So marode ist das Regime fast 60 Jahre nach der Revolution, dass es am Tropf fremder Mächte hängt und einen äußeren Feind für den Zusammenhalt braucht.
Rauls Reformen – beschränkte wirtschaftliche Freiheiten in einigen auserwählten Sektoren, wie etwa in der privaten Gastronomie – haben zwar einigen Druck vom Kessel genommen. Zu einer umfangreichen Liberalisierung der Wirtschaft à la China oder Vietnam hat sich die KP-Führung aber nicht durchringen können. Ideologisch fürchteten Castro & Co., die Legitimation der Revolution zu verlieren, ganz praktisch hätte dies allen vor Augen geführt, wie ineffizient und unproduktiv die staatlichen Betriebe sind. So wenig Spielraum das Regime den privaten kubanischen Kleinstunternehmen auch lässt, so beschäftigen sie doch bereits zwölf Prozent aller Arbeitnehmer. Außerdem hätte sich das unter Raul immer mächtiger gewordene Militär durch weitreichendere Wirtschaftsliberalisierungen in seiner Macht bedroht gefühlt. Immerhin unterstehen wichtige Schlüsselunternehmen in Tourismus und Wirtschaft dem direkten Einfluss der Armee.
Abhängig von Geld aus China und Öl aus Venezuela
Nun hat Raul in den vergangenen Jahren verstärkt um chinesisches Kapital und chinesische Investitionen geworben. Sollte Havanna gegenüber Peking immer mehr in die Position des Bittstellers geraten, könnten die Chinesen versucht sein, Wirtschaftsreformen nach eigenem Vorbild zu verlangen oder aber Teile der kubanischen Wirtschaft in chinesische Hände zu übertragen. Und dieser Zeitpunkt könnte schneller kommen als erwartet. Peking hat zwar Geld und will Macht, in Fässer ohne Boden investiert es ohne eigenen Nutzen aber nicht.
Nachdem Kuba nach dem Zusammenbruch des großen Sponsors Sowjetunion eine Dekade des Mangels bewältigen musste, tauchte Ende der 90er Jahre noch ein potenzieller Retter auf: Hugo Chavez, der großsprecherische Gesinnungsgenosse aus Venezuela. Der sah in den Castros nicht nur verehrenswerte Vorbilder, er brauchte auch dringend kubanische Agenten und Militärberater, um seine eigene Revolution gegen seine Widersacher abzusichern. Deshalb gewährte Chavez Kuba Erdöllieferungen zum Sonderpreis und hielt den karibischen Sozialismus der Castros lange Zeit quasi im Alleingang am Laufen. Im Gegenzug entsandte Havanna Ärzte in den Bruderstaat.
Maggie Thatchers im Kern sehr wahrer Spruch, dass der Sozialismus dann am Ende ist, wenn das Geld der anderen Leute weg ist, bewahrheite sich auch im Fall Kubas. Mit dem Tod von Chavez 2013 und fallenden Rohölpreisen, kamen weniger Überweisungen aus Caracas. Der neue Machthaber in Venezuela, Nicolas Maduro, muss sich vor allem um sich selbst und sein eigenes politisches Überleben kümmern. Deshalb könnte der Reformdruck auf Kuba erneut ansteigen.
Stabilisiert Trump das Regime?
Ausgerechnet Donald Trump läuft indes Gefahr, das marode System à la Castro unfreiwillig zu stabilisieren. Je mehr er von der Sonnenschein Politik seines Vorgängers Barack Obama abrückt und je abwertender die Signale ausfallen, die er gelegentlich an die lateinamerikanische Welt aussendet, desto mehr nutzt der US-Präsident den Propagandisten des Regimes von Havanna. Wer die Geschichte Kubas kennt, der muss kein Sozialist sein, um die zwiespältigen Gefühle zu verstehen, die die Insulaner gegenüber ihrem großen Nachbarn empfinden. Verglichen mit Konfrontation dürfte Wandel durch Annäherung letztendlich die größere Bedrohung für den Status quo im Karibikstaat sein.
Die Gesetze der ökonomischen Schwerkraft sprechen jedoch dafür, dass es mit dem dogmatischen Sozialismus à la Fidel irgendwann zu Ende gehen wird. Der Wasserweg zwischen Kuba und der Gegenküste in Florida ist ähnlich kurz wie der zwischen Libyen und dem italienischen Lampedusa. Die Menschen könnten sich also irgendwann gezwungen sehen, in noch größerer Zahl als bisher mit den Flüchtlingsbooten gegen ihr Regime abzustimmen. Zumal dann die Castros nicht mehr da sind, die es immer wieder geschafft haben, viele Menschen mit ihrer Vita, ihrer Rhetorik und ihrer revolutionären Vergangenheit irgendwie bei der sozialistischen Stange zu halten.
Wiederholt sich Geschichte doch?
Vielleicht wiederholt sich Geschichte ja doch. 1985 fand in einem anderen sozialistischen Land ein Wechsel von einem in die Jahre gekommenen Machthaber hin zu einem deutlich jüngeren, unbekannten Funktionär aus der Provinz statt. Das Land war die Sowjetunion, der neue Kreml-Chef Michail Gorbatschow. Besteht also doch die Chance, dass der erste Tag nach den Castros der erste Schritt hin zu mehr Freiheit in Kuba sein könnte?
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

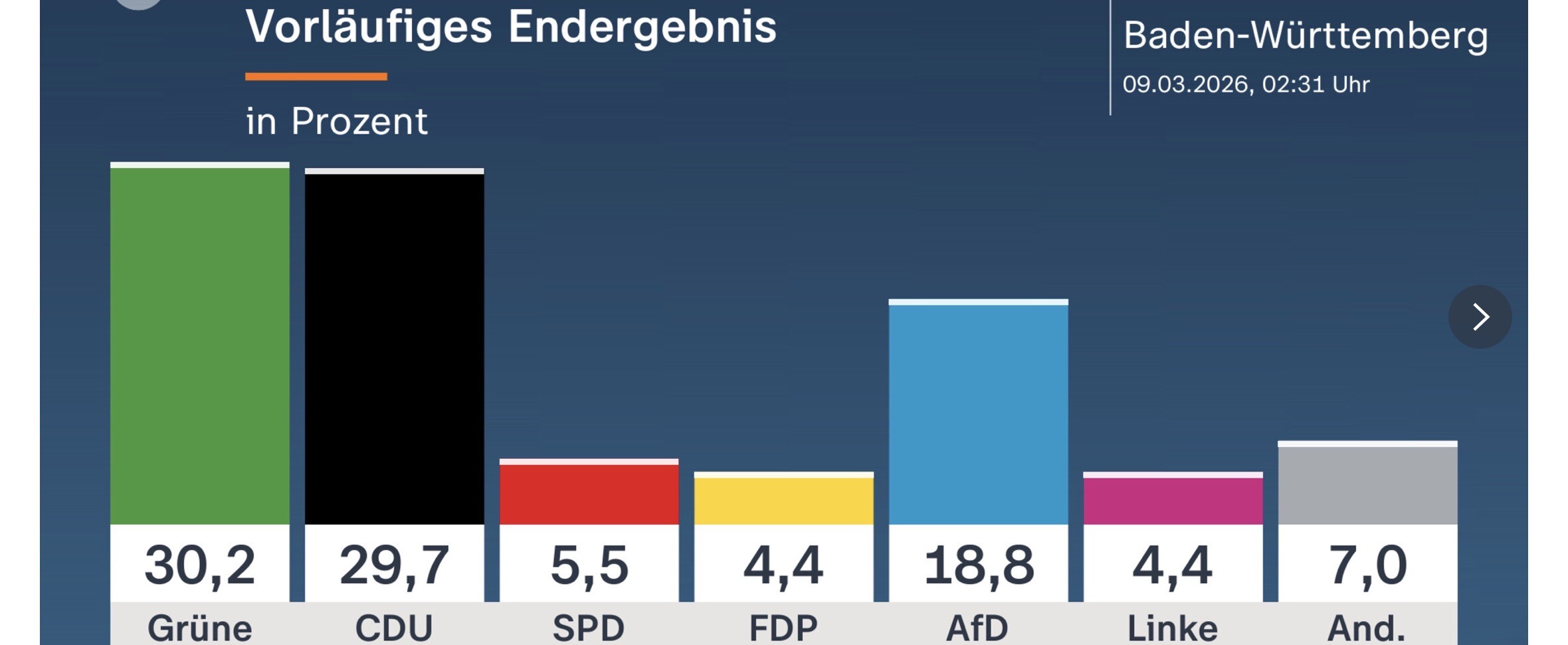

Sonia Matus
Excelente artículo…..felicitaciones!!!!