„All in all you’re just another brick in the wall.“
(„The Wall“ 1979)
Wenn Roger Waters ein Vierteljahrhundert nach dem letzten echten Soloalbum „Amused To Death“ eine neue Platte veröffentlicht, darf er sich des Rauschens im popkulturellen Blätterwald gewiss sein. Zu Recht! Denn „Is This The Life We Really Want?“ ist das womöglich finale Album eine echten Rockpioniers, ohne dessen Mitwirkung – besonders mit Pink Floyd – die Musikgeschichte der letzten 50 Jahre eine andere geworden wäre.
Hinzu kommt, dass wir gerade die Dämmerung der Erfindergeneration erleben. Man freut sich mithin über jeden Dino, der noch quicklebendig und aktiv ist. Es ist ein wenig als würde man als Zeuge – analog Rolling Stones, The Who, Gilmour, Waters etc – die letzten Kantaten Bachs erleben.
Polarisierender Zankapfel
Zum anderen erweist sich der Brite auch mit Mitte 70 als polarisierender Zankapfel. Die Ex-Floyd-Kollegen haben längst ebenso reißaus genommen vor dem schwierigen, zum Egotrip neigenden Wesen Waters, wie auch vier Ex-Frauen. Sogar das Fanlager ist tief gespalten. Besonders seine ebenso einäugige wie einseitige Parteinahme im Nahostkonflikt führt dazu, dass er bei einigen als Heilsbringer verehrt wird, während andere „nur noch die Floyd-Stücke hören, an denen er nicht beteiligt ist.“
Kein leichter Ausgangspunkt für eine Werkschau seiner relevanten Veröffentlichungen. Eines jedoch ist sicher: Der streitbare Engländer löst hie Ablehnung und dort Zuneigung aus. Er ist womöglich vieles, aber alles andere als egal. Die nachfolgende Reise durch Waters Schlüsselmomente zeigt auf, warum das so ist und beantwortet, die Frage, ob dies auch für die aktuelle Scheibe gilt.
„The Wall“:
„The Final Cut“:
„The Pros And Cons Of Hitch Hiking“:
Bereits im darauffolgenden Jahr sind Zerquältheit und Politisieren vorerst Geschichte. „The Pros And Cons“ bietet eine sinnliche Story zwischen Sexphantasie und surrealem Traum inklusive provokantem Coverartwork. Um ein Haar wäre die Scheibe „The Wall“ geworden. Etliche Songfragmente entstanden bereits 1978. Waters spielte sie damals den Floyds ebenso als Ideen vor wie die ersten Wall-Tracks. Gilmour, Mason und Wright wählen jedoch das obig besprochene Material. Nicht aus zu denken, wie anders die Musikgeschichte verlaufen wäre, hätte man sich hierfür entschieden.
Ein Beinbruch ist das gleichwohl nicht. Denn das Ergebnis überzeugt in den 80ern auf ganzer Linie. Rein musikalisch knüpft es mitunter an die ruhigen Passagen des „Final Cut“ an. Allerdings in etwas psychedelischerer Ausrichtung. So zitiert Waters in „Go Fishing“ das „Fletcher Memoral Home“ und nachfolgend sogar „Your Possible Pasts“. Michael Kamen (Piano, Co-Producer) und David Sanborn (Saxophon) machen einen hervorragenden Job als Sidekicks. Absoluter Clou und heimlicher Überflieger des Albums ist jedoch Eric Claptons Leadgitarre. Der als ausgleichend und sehr umgänglich geltende Clapton hatte anscheinend auch deutlich weniger Probleme mit Waters Ego als dessen Ex-Kollegen. Kein Wunder, bereits bei Cream war Old Slowhand an die harschen, teils bis zu Handgreiflichkeiten on Stage ausartenden Streitereien von Ginger Baker und Jack Bruce gewöhnt. Er ging mit Waters hernach sogar auf Tour.
„Radio K.A.O.S.“:
„Amused To Death“:
„The kid in the corner looked at the priest and fingered his pale blue japanese guitar.“ Es dauert fünf Jahre, bis er wieder zu voller Form aufläuft. Im Herbst 1992 erscheint „Amused To Death“ und zeigt ihn wieder wie gewohnt von seiner politischen und sozialkritischen Seite. Inspiriert vom Titel eines Neil Postman Buches keilt er gewohnt sarkastisch gegen Militär im allgemeinen und den ersten Golfkrieg im Besonderen. Ebenso nimmt er übersteigerte Konsumgeilheit, Ausbeutung der Dritten Welt und tumbe Berieselungssucht aufs Korn. Damals wurde das Doppelalbum nahezu einhellig als pessimistisches Grantlertum eines passionierten Griesgrams abgetan. Heute mutet die Realität mitunter ähnlich apokalyptisch an, wie er es dort schildert.
Musikalisch bieten die über 70 min Spielzeit etliche Höhepunkte. „What God Wants Part I“ ist ein kernig groovender Opener; sein bester Solo- Rocksong überhaupt. Als prominenten Joker holt er sich diesmal Jeff Beck ins Boot. Der Edel-Gitarrero enttäuscht erwartungsgemäß nicht. Auch das ebenso leidenschaftlich wie sinnlich dargebotene „Perfect Sense I & II“ gehört zum besten in Waters Katalog.
Gipfelmoment ist hernach „It’s A Miracle“. Auf den ersten Blick eine verbitterte Abrechnung mit der Spezies Mensch. Beim zweiten Hinschauen offenbart sich ein seltener Augenblick aufblitzenden Humors. Und zwar in Form eines köstlichen Andrew Lloyd-Webber-Disses: „Lloyd-Webber’s awful stuff runs for years and years and years. (…) Then the piano lid comes down. And breaks his fucking fingers. It’s a miracle!“
Wie passt nunmehr die neue CD in dieses überwiegen herausragende Werk?
„Is This The Life We really Want?“:
Erwartungsgemäß macht die Scheibe es Fan wie Kritiker alles andere als leicht. Sie ist wortlastig und vollgepackt mit Waters gängigem, dabei aktualisierten Themenbuffet. Man kommt nicht umhin, die textliche, hochpolitische Ebene getrennt von der musikalischen zu betrachten. Denn Zeilen und Noten schlagen mitunter recht unterschiedliche Wege ein. So nimmt Donald Trump in etwa jene Rolle ein, die früher Maggie Thatcher inne hatte. Eindringlich schildert er das Los der Flüchtlinge, urplötzlichen Dronentod argloser Zivilisten oder geißelt zornerfüllt weltweite Ignoranz gegenüber der Umwelt. So weit so gut.
Als Achillesferse entpuppt sich jedoch einmal mehr sein bauchladenhaft zur Schau gestellter Tunnelblick auf den Nahostkonflikt, den er mehrfach als Eckpfeiler akzentuiert. In Waters Wahrnehmung gibt es lediglich niedergewalzte und unterdrückte Palästinenser. Ein ähnlich mitfühlender Blick auf die israelische Zivilgesellschaft, die seit 70 Jahren unter schlimmem Druck des Terros lebt, den Petro-$-Regimen auch nach dem Holocaust unwillkommen war, sich ebenso in der Asterix-Situation fühlt und dennoch bar jeden Öls eine funktionierende Demokratie voller freiem Sex, freier Kunst, freien Frauen, freien Religionen und freien Wahlen aufbaute, fehlt gänzlich.
Damit verpasst Waters die Chance, konatruktiv das einende beider ungleicher Brüder zu betonen und bleibt damit im eigenen Ansatz selbst destruktiv. Die wohlfeile Rolle des eitlen Dorfrichters analog Günter Grass gefällt ihm zu gut. Wie es anders geht, zeigen seit über 20 Jahren z.B. Orphaned Land, eine israelische Band, die beide Seiten als Fans vereint und friedlich an einen Tisch bringt. Bei Waters Platte muss man bedauerlicherweise schon für deutlich weniger dankbar sein. Etwa dafür, dass er statt BDS-Phrasen mit „Waiting For Her“ die Bearbeitung des palästinensischen Dichters Mahmoud Darvish-Textes singt. Der zweifellos große Poet war zwar auch Teil der PLO. Dennoch prangerte er die eigene politische Führung ebenso deutlich an, wie die israelische, war ein erklärter Gegner der zivilgesellschaftsfeindlichen Hamas und bis zum Lebensende friedensgläubig.
Die musikalische Ebene präsentieert sich ähnlich durchwachsen. Sie zeichnet sich vor allem durch clevere Inszenierung aus. Alle typischen Trademarks sind tendenziell vorhanden. Auch wenn die Stimme nicht mehr ganz die Kraft früherer Eruptionen besitzt, reicht es noch, den ihm eigenen Laut-Leise-Kontrast effektiv zu transportieren. Sound und Arrangements kann man getrost als eine Art „Final Cut trifft Amused To Death“ bezeichnen. Der Löwenanteil dieser gelungenen Zurschaustellung wichtiger Kennzeichen gebührt Nigel Goodrich. Auf das Konto des versierten Produzenten gehen etliche Radiohead-Tonträger, so auch deren Meilenstein „OK Computer“. Daneben zeigt er eine hohe Bandbreite von Postpunk (Siouxsie & The Banshees, Warpaint) bis hin zu R.E.M. oder Paul McCartney. Was Goodrich z.B. „Picture That“ an Dynamik alter Schule verpasst und mit Klängen zwischen Tangerine Dream und Pink Floyd anno „Dark Side Of The Moon“ würzt, ist aller Ehren wert.
Die einzige, aber entscheidende Schwachstelle liegt in Waters erschreckend mediokrem Songwriting. Vieles klingt lediglich wie ein Schatten früherer Inspiration. „Deja Vu“ etwa macht seinem Namen leider alle Ehre. Es mutet wie ein Zweitaufguss von „Mother“ als Schlaflied an. „Broken Bones“ oder „Part Of Me Died“ hingegen wirken – trotz ästhetischer Instrumentierung – wie inspirationslose Outtakes. Das Titelstück erinnert zu sehr an eine dahinplätschernde Vorlesung, um emotional zu berühren. Und die Ballade „The Last Refugee“ überzeugt lediglich durch das intensive Video von Waters Filmspezi Sean Evans. Flächendeckend verlegt Waters sich zu sehr auf gleichförmigen Sprechgesang. Das tat er früher zwar auch gern. Jedoch achtete er damals stets darauf, zupackende Melodien ein zu bauen.
Der Grund für die Schwächen mag darin liegen, dass Waters bis vor kurzem an der Idee eines dramatischen Radiohörspiels arbeitete. Ein paar jener Spoken-Word-Tracks wurden für diese CD verwendet und von Waters/Goodrich in Richtung Rocktauglichkeit umgekrempelt. Solche Flickschusterei ist man vom Perfektionisten Waters nicht gewohnt. Keine Überrascung, dass die musikalische Dramaturgie – sonst sein roter Faden in fast allen Werken – auf der Strecke bleibt.
Ein paar Hinhörer gibt es dennoch. „Bird In A Gale“ lässt zumindest teilweise den Zauber Watersscher Wucht aufblitzen. „The Most Beautiful Girl“ und „Last Refugee“ zitieren augenzwinkernd und sehr passend zum deprimierenden Grundgefühl, den Drumbeat aus Bowies Weltuntergangshymne „Five Years“ ( von „The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars“ 1972). „Smell The Roses“ lässt in punkto Atmosphäre – wie das obig genannte „Picture Me“ – ein seit Äonen lieb gewonnenes Pink Floyd-Feeling auferstehen. Aber das war es auch schon.
Wenn somit weniger als die Hälfte der Songs überzeugen, ist das für einen Mann mit Roger Waters Anspruch allemal zu wenig. Aber die Lebensleistung kann auch ein Schwächeln auf der Zielgeraden nicht schmälern. Alles in allem ist das laue Album keine tragende Wand, sondern kaum mehr als ein weiterer Stein in der Mauer.
+++
Lesen Sie auch: Cities in dust
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

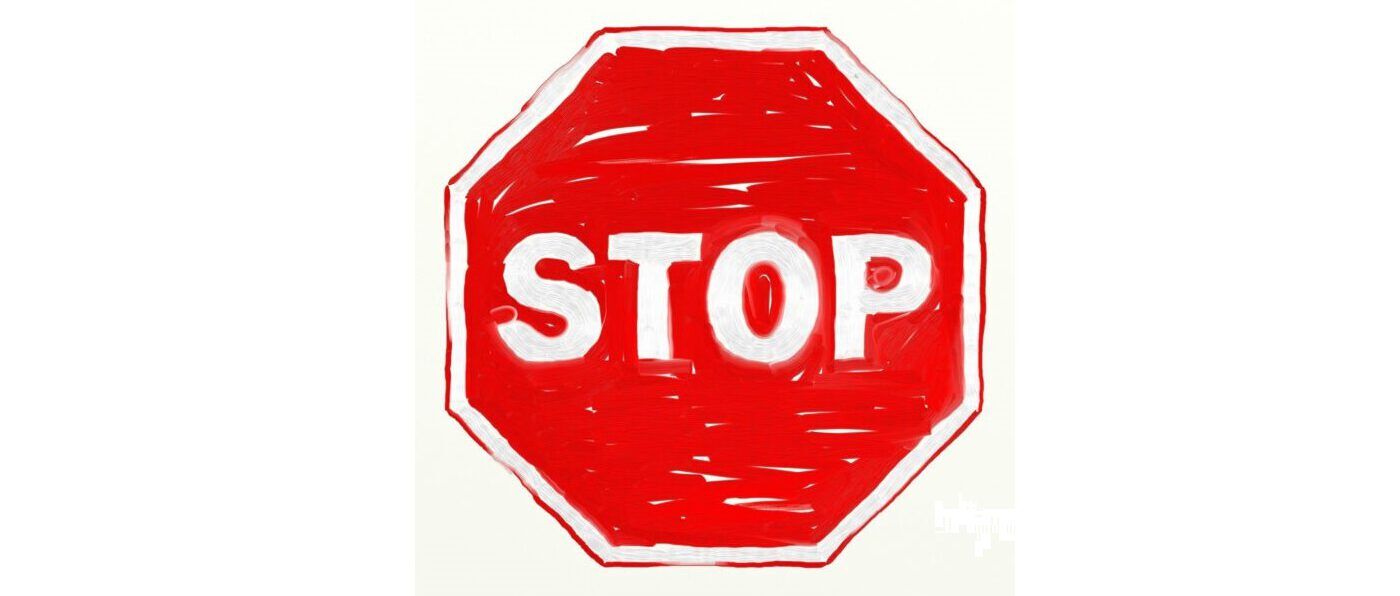

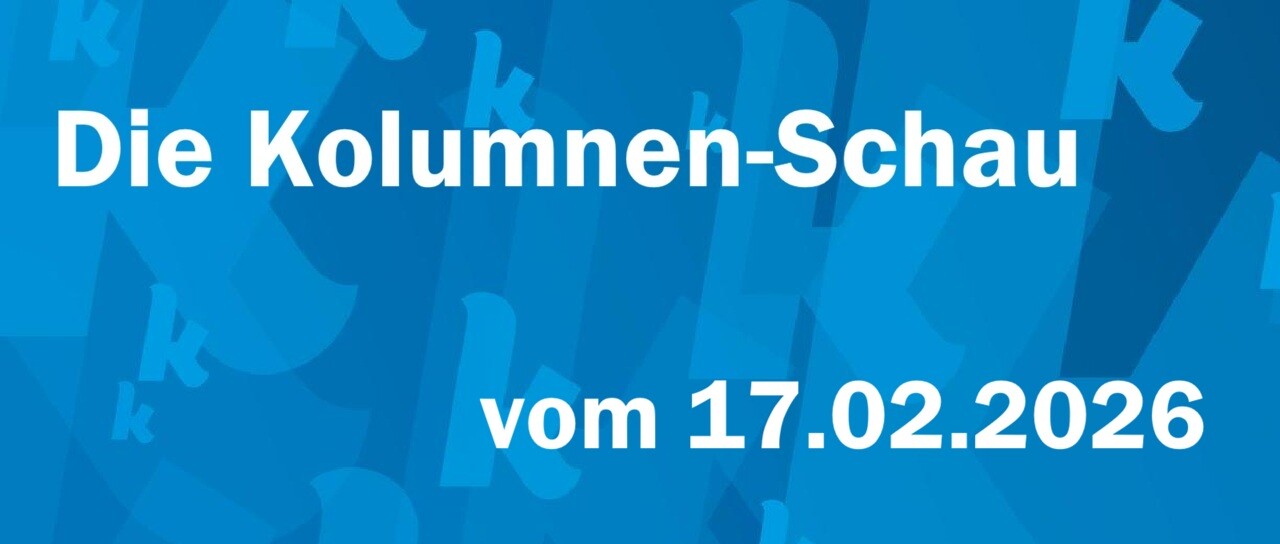
Ihr Kommentar