Musik ist ein Vehikel für Traurigkeit und Freude. Wenn es gelingt, beide Extreme zusammenzuführen, entsteht Magie. – Paul McCartney
Es gibt Lieder, gewebt aus purer Magie. Ich spreche hier nicht von jenen gelegentlichen Übertreibungen, denen meine Zunft und ich – “voll magischer Track, Alter!” – in Reviews oder Portraits mitunter leicht übertreibend anheimfallen. Auch meine ich keine okkulten Szenenummern aus der schwarzmagischen Truhe. Nein, Freunde, dort draußen existieren tatsächlich Songs, bis zum Bersten gefüllt mit positiven Schwingungen und durchflutet mit Licht. Sie sind ein Teil des Guten, des Einenden, verachten alles chauvinistisch Trennende.
Keiner von ihnen fragt den Hörer, welchem politischen Lager er angehöre, welcher Hautfarbe, Religion, Kultur oder was für Bildung oder Beruf das Publikum mitbringe. Diese Partisanen der Liebe wollen nur eines: Das offene Ohr. Nichts weiter mehr.
In geduldiger Beharrlichkeit mäandern sie über unseren kleinen, blauen Planeten und durchdringen – frei von Raum und Zeit – unaufhaltsam jede Mauer. Kein Schlagbaum kann sie aufhalten, keine Waffe sie töten – noch nicht einmal die Schwerter in den Köpfen der Menschen.
Klingt esoterisch?
Oh nein, Leute. Ich war Anwalt und versichere euch meine Unempfindlichkeit gegen Hokuspokus. Die These ist vielmehr dem Beweis nachprüfbar zugänglich. Erlaubt mir bitte, diesen im Dienste eurer Überzeugung zu führen. Es soll – wie immer in dieser Kolumne – euer Schaden nicht sein.
Zunächst müssen wir einmal all jene Stücke ausschließen, die es nicht sind. Sonst gerät man in konfuses Durcheinander und kommt schlussendlich ins Trudeln. Jegliche Form des Protestliedes, des Agitations-Tracks, des “Free ABC!”, „Fuck DEF!“ oder “Give XYZ A Chance” bleibt vor der Tür. Warum? Ganz einfach: Es mangelt ihnen aufgrund kontextgebundener Fesseln an universeller Leuchtkraft. Letztere darf zwar Worte enthalten. Sie muß indes auch dann unwiderstehlich sein, wenn die bloße nonverbale Energie zuschlägt; mit Melodie und Rhythmus und Schluss! Alles andere ist Tüdelkram.
Somit erkennt man die wahren Glanzstücke vor allem an einer Eigenschaft: Sie sind allesamt Gestaltwandler, deren Mantel oder äußeres Antlitz wechseln mag. Doch ihr kraftvoller Kern bleibt stets unangetastet. Manitu, Jaqen H’ghar und Pennywise würden jedem, der dies verstanden hat, sicherlich mehr als nur einen Drink ausgeben – somit auch uns.
Hier ist so eine auch in den dunkelsten Nächten ewig lodernde Fackel:
Peggy Lee – Johnny Guitar
Das grandiose Songwriterduo Peggy Lee (Lyrics)/Vic Young (Music) erschuf dieses Kleinod 1954 für den gleichnamigen Westernklassiker mit Joan Crawford und Sterling Hayden. Doch wollen wir an dieser Stelle weder über den Streifen noch über “Mommy Dearest” sprechen. Dies wird hoffentlch eines schönen Tages passieren, wenn Filmkenner und Kolumnistenkollege Wolfgang Brosche hierzu ein blumiges Essay verfasst – und ich freue mich jetzt schon darauf. Das Lied selbst jedoch emanzipierte sich rasch von diesem recht engen Zusammenhang. Hier zunächst einmal das Original:
Wundervoll, nicht wahr? Doch lediglich ein Ausgangspunkt. Metamorph, Baby, Metamorph! Von hier geht die Reise los. Schlager und Easy Listening-Freunde zeigen sich ebenso fasziniert wie Old Slowhand, chronische Melancholiker oder Freunde der Einstürzenden Neubauten, Israelis wie Araber, Pfeffer wie Salz. Ab dafür!
Wer munter drauflos recherchiert, stößt eventuell auf Varianten die gen Jazz, Bossa etc. streben. Auch gibt es etliche, leicht angerockte Uptemponummern. The Leemen oder The Shadows sind nur zwei davon, die sich lohnen. Mein Favorit unter den schnelleren Versionen ist die knuffig-launige Surfrock-Interpretation der Clee-Shays.
So intensiv wie Peggy Lees Original serviert die großartige Daliah Lavi eine Art würdevollen Schmachtens. Melodram pur! Dabei trotz großer Geste so umwerfend zielsicher pointiert. Es ist eine wahre Ohrenfreude.
Das Lied geht durch viele Sprachen und Länder; unter anderem in Gigliola Cinquettis spanischer Version. Sogar die Finnen integrieren es als „Surujen Kitara“ – wenn auch instrumental. Für Chill-Out-Fans offeriert der Perser Khalid Barzanji ein Bild des Songs, welches „Johnny Guitar“ auch in Nahost – besonders den arabischen Ländern – beliebt macht. Die Produktion ist allerdings schon etwas nah an der Kitschgrenze gebaut.
Da kann die Leichte-Muse-Fraktion nicht abseits stehen. James Last, seines Zeichen der bremische Godfather of Easy Listening, haut 1968 diese fluffige Deutung heraus.
Geht es auch groovy? Klar! Eric Clapton tunkt es in seinen typisch flickernden Bluesrocktopf. Das Besondere ist hier jedoch nicht seine Gitarre. Das tolle Piano – gedacht als Sidekick – stiehlt Old Slowhand lässig die Show.
Mit gallonenweise Rotweinmelancholie erobern hernach die Tindersticks das schöne Stück. Die ersten drei ihrer Alben lege ich ohnehin jedem ans Herz. Auch hier lebt die Atmosphäre besonders von Stuart Staples knödelig wisperndem Gesang.
Doch der hypnotische Höhepunkt steht noch aus.
Die Haut ist ein Bandprojekt aus dem Bad Seeds-Kosmos. Kein Wunder, dass Nick Cave oder Blixa Bargeld gern als Gastsänger vorbeischauen. Der Neubauten-Vordenker hat sowieso ein Händchen für Zeilen, die eigentlich aus weiblicher Sicht erzählen. Bei zahllosen Cave-Gigs übernahm er im Duett gern den Kylie Minoque/Eliza Day-Part von “Where The Wild Roses Grow”. Seine Version ist mein persönlicher Liebling und als “Perfekt Nightsong” der optimale Ausklang dieser Kolumne. Hochsensibel gesungen verbindet sich die Stimme Bargelds mit den ebenso ausdrucksstarken, abgründigen Gitarrenlicks. Romantik trifft Weltschmerz nach Sonnenuntergang.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

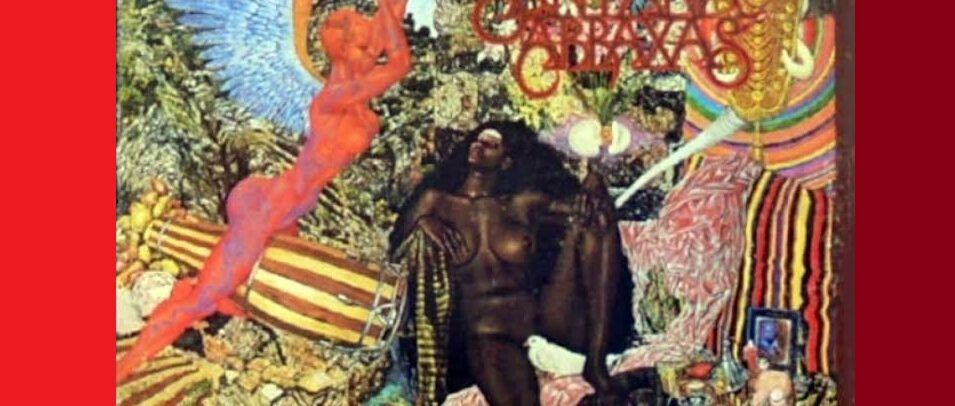


Wolfgang Brosche
„Ohhhhh…“ – woher wußtest Du das, Ulf? Also, wenn ich eine Radio-Sendung über „Frauen singen im Western“ machen würde, dann stünde „Johnny Guitar“ von Peggy Lee an erster Stelle…
Und überhaupt und sowieso…die erste halbe Stunde von Johnny Guitar ist glorios – auch glorioses Ballett, wie auf einer Bühne. Wie Nick Ray die Posse-Gruppe im Saloon arrangiert, Wahnsinn! Und dann dieses Gesicht von Joan Crawford („Männer wollen Liebe, Frauen wollen Sicherheit“ – sagt sie in „Harriet Craig“) – mir geht´s immer wieder durch und durch, wenn am Ende dieser halben Stunde sie endlich Johnny küßt und ihn fragt: „What kept you so long?“
Und dann diese abscheußlichen Farben, lila und gelb – weil Trucolor eben nicht das ganze Spektrum sauber erfassen konnte – aber an der richtigen Stelle blütenweiß, wenn sie gehängt werden soll, unsere Joan, die ja eigentlich ein Mann ist.
Aber die schönste Stelle, die schönste Stelle, die je in einem Western die Liebe zeigte ist jene als Dancing Kid gefragt wird: „Can you Dance?“ – und Kid zurückfragt: „Can you Play?“ Und Joan mit dem Rücken zu Johnny steht, ohne ihn anzusehen und seine Gitarre vom Tresen nimmt und über ihren Kopf hinweg das Instrument in seine schon wartenden Arme legt… Leute, wenn Ihr das nicht seht und versteht, dann nützt kein CGI oder was für ein Trick auch immer…dafür ist das Kino gemacht…das ist „Liebe machen“ – und Peggy Lee hat genau gewußt, welche Musik dazu gehört…
So hoabt´s mi?