Salman Rushdie1988, vor mittlerweile knapp 30 Jahren, erschien Salman Rushdies Die satanischen Verse. Kenan Malik lokalisierte in dem Streit um den Roman, in dessen Verlauf unter anderem Rushdies japanischer Übersetzer ermordet wurde, einen der zentralen Momente, in denen sich die westliche Linke mehrheitlich vom Universalismus dem Kulturalismus zuwandte. Rushdie selbst hat in seiner Autobiografie Joseph Anton gezeigt, dass die Fronten so einheitlich nicht verliefen. Es gab durchaus auch wortgewaltige und tatkräftige linke Unterstützter und rechte Kräfte, die beim Revival des Religiösen nicht rasch genug mit den Islamisten gemeinsame Sache machen konnten. Ich habe all das hier nachgezeichnet. Im vergangenen Jahr erschienen bei Penguin eine neue deutsche Ausgabe von Die satanischen Verse. Das Jahr des 30. Geburtstag dieses viel diskutierten und wahrscheinlich deutlich seltener gelesenen Werkes ist ein guter Anlass, einmal wieder auf dessen literarische Qualitäten zu blicken.
Wenn man die Jugendliebe wiedersieht
Vor dem Wiederlesen von Rushdies Die satanischen Verse beschleicht mich eine gewisse Unsicherheit, wie bei noch einigen anderen Texten, die man einst einerseits wegen ihrer ungewöhnlichen, ein konservatives Verständnis von Literatur provozierenden Struktur, andererseits in erster Linie aber doch wegen der augenscheinlich darin vertretenen Positionen, denen man selbst zugeneigt war, gut fand. Schlagworte wie „Postkolonialismus“ und und „kulturelle Hybridität“ kommen in den Sinn. Die gerne gelobte strukturelle Anlage solcher Texte ist dem so orientierten Leser womöglich sogar eher nur Beiwerk und dem postkolonialen Habitus zuzuschlagen. „Wilde Fabulierkunst“, „produktives Chaos“ et cetera – in der Begeisterung für Marquez, Llosa, Bolano & Co schwingt regelmäßig eine gehörige Portion Missverständnis und vielleicht einiges an unfreiwilliger Exotisierung mit.
Wiederlesend stellt sich die Frage: Sind diese Texte wirklich gut? Oder schmeicheln sie nur meiner persönlichen Weltsicht? Sind strukturelle Phänomene aus dem Gegenstand begründbar? Oder bin ich einem Hype aufgesessen, der geschickt an den Widerspruchsgeist junger Menschen andockt? Bei Rushdie ist diese Unsicherheit sogar besonders geboten, wurde doch der Autor nach Fatwa, Verfolgung, Exil und Versteck von links wie von rechts von Menschen in den Himmel gehoben, die wahrscheinlich kaum einen längeren Blick in sein Werk riskiert haben. Etwa polemisiert Rushdie, soweit vorzugreifen sei erlaubt, in Die satanischen Verse gegen linke politische Korrektheit ebenso mit spitzer Feder, wie gegen die „das wird man wohl noch sagen dürfen“ – Fraktion, die sich gegen „Neusprech“ einsetzt, und doch in der Regel nur ungestört und unwidersprochen Menschen beleidigen möchte. Hier Die satanischen Verse z.B. zum Dogma, es gebe keinen Rassismus der Diskriminierten – sowie auch gleich zur rechten Instrumentalisierung solcher Selbstkritik:
»Viele von euch in Großbritannien sprechen von Opfern. Ich war nicht dort, ich kenne eure Lage nicht, aber aus meiner persönlichen Erfahrung heraus habe ich es noch nie als angenehm empfunden, als Opfer bezeichnet zu werden. In Klassenbegriffen bin ich es offensichtlich nicht. Selbst in kultureller Hinsicht findet man hier all die Bigotterien, all die Vorgehensweisen, die man mit Unterdrückung in Verbindung bringt.Während viele Inder also zweifellos unterdrückt werden, bin ich nicht der Ansicht, daß auch nur einer von uns eine solchglänzende Rolle für sich beanspruchen kann.
»Die Schwierigkeit mit Bhupens radikaler Kritik ist«, hatte Zeeny bemerkt, »daß Reaktionäre wie Salad Baba sie nur zu gern schlucken.«
Rhythmus, Melodie und reichlich Verrückte
Die Unsicherheit vor dem Wiederlesen also. Wird das Werk den Erwartungen und der vergangenen Erfahrung gerecht? Und dann der Blick ins Buch, der die Unsicherheit in diesem Fall rasch und ebenso gründlich vom Tisch wischt:
„Um wiedergeboren zu werden«, sang Gibril Farishta, während er vom Himmel stürzte, »mußt du erst sterben. Ho ji!Ho ji! Um weich zu landen am Busen der Erde, mußt du erst zum Vogel werden. Tat-Taa! Taka-tan! Um heiter zu genießen,müssen erst Tränen fließen.Wie willst du die Liebe wagen,mein Herr, ohne zu klagen? Baba, willst du wiedergeboren werden. . .« An einem Wintermorgen kurz vor Tagesanbruch, so um den ersten Januar herum, fielen zwei leibhaftige, ausgewachsene,quicklebendige Männer aus einer Höhe von achttausendachthundertvierzigMetern in Richtung Ärmelkanal, und zwar ohne Hilfsmittel wie Fallschirme oder Flügel, aus heiterem Himmel. (…)”
„»Aus Japan sind meine schönen Schuh’«, sang Gibril und übersetzte dabei das alte Lied in halbbewußter Hochachtung vor dem entgegenstürmenden Gastland, »die Hosen sind englisch, was meinst du dazu? Auf dem Kopf ein russischer Hut, aber indisch ist mein Blut.« Die Wolken ballten sich ihnen entgegen,und vielleicht war es wegen der mystischen Formationen von Kumulus und Kumulonimbus, der mächtig dahinziehenden Gewitterwolken, die wie Hämmer in der Morgendämmerung aufragten, oder vielleicht war es das Singen (wobei der eine die Vorstellung gab und der andere sie ausbuhte), oder ihr Detonationsdelirium, das ihnen die volle vorherige Kenntnis des ihnen unmittelbar Bevorstehenden ersparte . . . doch aus welchem Grund auch immer, die beiden Männer, Gibrilsaladin Farishtachamcha, zu diesem endlosen und doch endenden engelgleichen, teuflischen Fall verdammt, merkten nicht, in welchem Augenblick der Prozeß ihrer Transmutation begann.“
Der Schauspieler Gibreel Farishta und der Synchronsprecher Salahudin Chamcha stürzen im ersten Kapitel aus einem von Terroristen gesprengten Jumbojet, sinnigerweise “Bostan” genannt nach einem der beiden islamischen Paradiese. Während sie ungebremst gen Erde fallen reißt Rushdie in einem durchweg im oben zitierten Sprachmischmasch gehaltenen, teils lyrischen Dialog, mit Rück- und Vorblenden in innerem Monolog zahlreiche Themen des Romans an, lässt Leitmotive aufblitzen und verschwinden und macht den Leser mit seinem „magischen Realismus“ vertraut, in dem real Übersinnliches (oder von einer gemeinsamen Psychose getragenes?) Geschehen gleichzeitig metaphorische Schlaglichter setzt. Unverkennbar: Es handelt sich hierbei um eine Exposition im stärksten Wortsinn, analog zur musikalischen, deren Haupt und Nebenthemen dann in vielfacher Weise „durchgeführt“ werden. Wie es hier unter anderem bereits für Pynchon gezeigt wurde.
Verschlungener Plot für verworrene Zeiten
Und so fulminant wie es begonnen hat geht Die satanischen Verse weiter. Der zentrale Plot und die wo möglich nur von Gibreel geträumten, und später zu Filmen verarbeiteten Nebenlinien kommentieren sich geschickt wechselseitig, durchdringen sich insbesondere durch parallel angelegte oder in verschiedenen Linien auftauchende Charaktere und eine komplexe Namenssymbolik, wirken dabei jedoch nie aufgesetzt, als sei die Komplexität weniger dem Roman als der Demonstration der Gewitztheit des Schriftstellers geschuldet. Die Behauptung darf gewagt werden: Kein Wort steht an der falschen Stelle und über die tatsächlich oft chaotischen und verwirrenden Zwischenwelten zwischen London und Bombay, legaler und illegaler Immigration, „Othering“, Assimilation, Integration und Überkompensation, Thatcher und Gandhi, Anti- und Postkolonialismus, Freude am Konsum und marxistische Agitation, Hollywood und Bollywood, Rassismuskritik und Hindunationalismus lässt lässt sich kaum anders auf diesem Niveau schreiben als in Die satanischen Verse. Und auch die Charaktere sind durchweg überzeugend ge- bzw. überzeichnet, die Dialoge brillant, die Szenerie mit all ihren Unwahrscheinlichkeiten so plastisch, dass sie sich noch nachts in die Träume des Lesers drängt. Ja: All das wirkt auf den ersten Blick chaotisch, und man wird bezweifeln müssen, dass die Ankläger des Werkes sich jemals die Mühe gemacht haben, den in Wahrheit komplexen, aber durchdachten Plot zu entwirren. Sonst wäre ihnen vielleicht aufgefallen, dass die Darstellung des Propheten, der Stein des Anstoßes, nur eine Fiktion innerhalb der Fiktion ist, während die wahre Blasphemie von Die satanischen Verse besser versteckt ist und universeller zuschlägt. Denn: Rushdies Werk ist eine verkappte Ich-Erzählung. Genau einmal spricht der Erzähler selbst den Leser an und kann wahlweise als Personifikation des Autors oder als Gott gelesen werden. Ist das nicht eine Anmaßung?
Großer Roman und witzig dazu!
Fazit: Rushdies Die satanischen Verse reiht sich mit Marquez Hundert Jahre Einsamkeit, Llosas Das Grüne Haus und Das Gespräch in der „Kathedrale“, Bastos Ich, der Allmächtige, und dem Gesamtwerk Pynchons bei jenen sogenannten „post-„modernen Texten ein, die auch noch lieben kann, ja, muss, wessen Verständnis von Ästhetik dem Goethes und Schillers näher steht als dem zeitgenössischen “Alles geht”. Dabei ist Die satanischen Verse übrigens auch noch unglaublich lustig. Ein Sprachwitz, der, wie ich mich kürzlich überzeugen durfte, in der englischen Hörbuchversion noch einmal deutlich besser zur Geltung kommt. Doch auch die deutsche Übersetzung halte ich mit den Einschränkungen, die für Übersetzungen eben immer zu machen sind, für gelungen (natürlich lässt sich der teils regelrecht melodische Sound des von indischem Englisch durchzogenen Originals nur schwerlich einfangen. In wie weit das in der besonders schwierigen Anfangspassage gelungen ist mag der Leser selbst beurteilen, untenstehend das oben Zitierte auf Englisch).1
Einziger Wermutstropfen: Dass sich die bereits im Roman so treffend erfassten politischen Frontlinien eher verhärtet haben, dass die PC-Debatten eher mit noch mehr Vehemenz geführt und der politische Islam weiter verharmlost werden, führt die Lektüre schmerzhaft vor Augen. Das aber ist natürlich kein Fehler von Die Satanischen Verse.
_________________________________________________________
1 “To be born again,” sang Gibreel Farishta tumbling from the heavens, “first you have to die. Hoji! Hoji! To land upon the bosomy earth, first one needs to fly. Tat-taa! Taka-thun! How to ever smile again, if first you won’t cry? How to win the darling’s love, mister, without a sigh? Baba, if you want to get born again . . .” Just before dawn one winter’s morning, New Year’s Day or thereabouts, two real, full-grown, living men fell from a great height, twenty-nine thousand and two feet, towards the English Channel, without benefit of parachutes or wings, out of a clear sky.
“O, my shoes are Japanese,” Gibreel sang, translating the old song into English in semi-conscious deference to the uprushing host-nation, “These trousers English, if you please. On my head, red Russian hat; my heart’s Indian for all that.” The clouds were bubbling up towards them, and perhaps it was on account of that great mystification of cumulus and cumulo-nimbus, the mighty rolling thunderheads standing like hammers in the dawn, or perhaps it was the singing (the one busy performing, the other booing the performance), or their blast–delirium that spared them full foreknowledge of the imminent . . . but for whatever reason, the two men, Gibreelsaladin Farishtachamcha, condemned to this endless but also ending angelic devilish fall, did not become aware of the moment at which the processes of their transmutation began. “
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


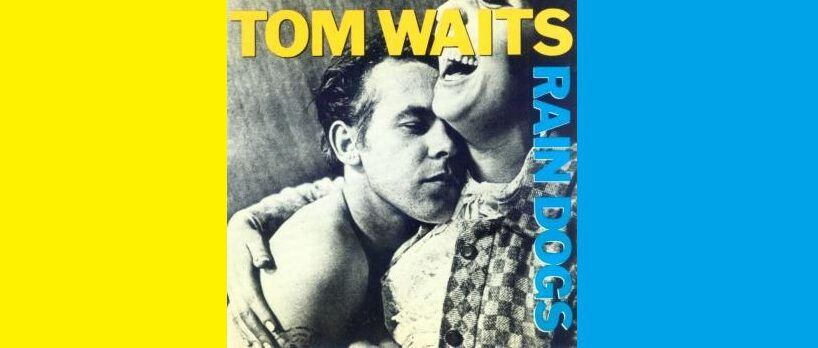

Ihr Kommentar