Kürzlich klickte ich mich einmal wieder durch Videos einer PC-Zeitschrift, die ich als Jugendlicher gelesen hatte. Wühlte mich durch ältere und neuere Tests, durch ein paar Diskussionen zu Wertungsfragen in den zugehörigen Online-Foren. Warum? Wahrscheinlich simpler Eskapismus. Das ständige Ellebogen raus in der herbstgrauen Realität lässt sich leichter ertragen, wenn man an friedlichere Orte flieht. Oder anderen dabei zusieht: Wie sie in Skyrim Drachen schlachten oder Gangster und Polizisten in Los Santos oder sich gegenseitig auf den Schlachtfeldern des ersten Weltkriegs. Jugendidyllen eben.
Rezensionen als Orientierungshilfe
Als Nebenprodukt der kleinen nostalgischen Reise fiel die Erkenntnis ab, dass PC-Magazine die einzigen gewissermaßen feuilletonistischen Produkte sind, die ihren Job noch machen. Also Kulturgüter ernsthaft kritisch durchleuchten und regelmäßig, wenn nötig, die rote Flagge heben. Während der Rest der Zunft eigentlich nur noch zwischen den Extrempunkten ignorieren oder abfeiern schwankt (den ein oder anderen konsensfähigen Verriss eingestreut), machen sich PC Games, Gamestar und Co ( die letzten Überlebenden eines auch in dieser Branche grassierenden Zeitschriftensterbens) weiterhin die Mühe, Monat für Monat einen möglichst breiten Querschnitt des Marktes zu beackern und für den Leser tatsächlich einzuordnen: Lohnt sich der Kauf?
Dabei liegen die Autoren natürlich ständig falsch (siehe: die zahlreichen angeregten Diskussionen online). Wie könnte es anders sein? Eine Besprechung dient ja nicht als letztes und definitives Urteil über ein Sache, sondern praktisch vielmehr als Sprungbrett zur Debatte. Und als solches fungieren die Spieletests weiterhin. Weil sie tatsächlich begründete Urteile zu den verschiedenen handwerklichen Aspekten (Spielmechanik, Ästhetik, Spieldauer, usw usf) zu liefern suchen. Ai Wai Wai, das Spiel (ein dicker Mann liegt stundenlang am Strand und lässt sich fotografieren) bekäme ganz definitiv den Verriss, den es verdiente.
Wo Quantifizierung zum Qualitätsurteil beiträgt
Das faszinierende: Es ist gerade die pedantische Lust an der Quantifizierung, die Spiele-Autoren zu begründeten qualitativen Urteilen zwingt. Ja: der Quantifizierungswahn greift um sich, und wenn es sich etwa um Arbeitszeit- oder Leistungserfassung dreht, ist er eine regelrechte Plage, die das qualitative Urteil eher überdeckt als ermöglicht. Hier wird für gewöhnlich die Einzelfall-Betrachtung durch die Gewichtung von Zahlen ersetzt. Und es gibt oft genug niemanden, vor allem kein breites Publikum, dem der/die Urteilenden Rechenschaft schuldig sind. Bald, so droht uns die nahe Zukunft, übernehmen Computer die kaum geprüfte fröhliche Urteilerei.
Aber: Das Beispiel der Spieletests zeigt, es geht anders. Ausgerechnet der absurdeste, immer doch relativ willkürliche und in seiner Willkürlichkeit auch durchschaute Aspekt, das Verteilen von Prozenten und Schulnoten, zwingt hier dazu, auch in der textlichen Begründung der Wertung deutlich zu werden. Wer 94% und Einsen in fünf Detailfragen vergibt (oder 54 % und Fünfen in in allen Bereichen) kann das nicht mit einer Nacherzählung des Inhalts und einigen lapidaren Sätzen zu gesellschaftlicher Relevanz abtun, wie es in der Kunstkritik oft geschieht. Und so machen sich Spieletester mit ihrem Gegenstand, und auch mit Werken abseits der 4 bis 5 Blockbuster, die jeder im Regal stehen haben muss, tatsächlich eine Mühe, die man bei Büchern und Filmen vergebens sucht (von Bildender Kunst und Theater ganz zu schweigen, die finden in der Öffentlichkeit ja kaum noch statt, wenn es nicht gerade einen Skandal gibt).
Sollte man also für literarische Rezensionen nun auch ein quantitatives Bewertungssystem einführen? Schulnoten vergeben für Lesespaß, Charakterzeichnung, Sprache, Innovativität und Komposition? Vielleicht nach Genres und Lesergruppen aufgeteilt, um den Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen den neuesten Brown mit Virginia Woolf zu vergleichen?
Warum eigentlich nicht? Es graust den Freunden der Schönheit wohl mit Recht vor der Tendenz, alles in Zahlen zu pressen. Aber kann denn die Praxis der Literaturkritik überhaupt noch mehr auf den Hund kommen? PC-Spieletests belegen zumindest: besser geht es immer.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

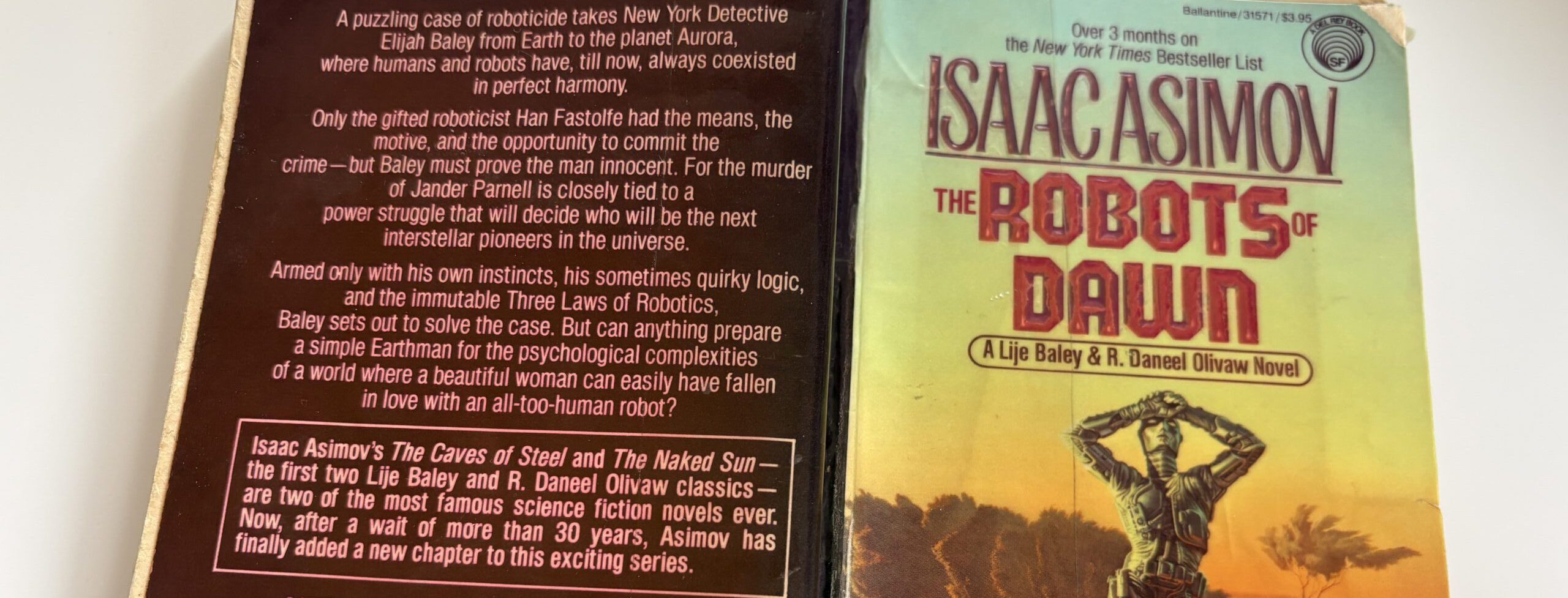


Ihr Kommentar