Die staatlich anerkannte Nordstern.Kirche Frankfurt feiert ihr alljährliches Grillfest im Ostpark. Zwischen Flaschenbier und Grillsteaks beruft Pastor Stephan eine Gemeindeversammlung ein, da wichtige Entscheidungen satzungsgemäß getroffen werden müssen. Dieses Mal stimmt die Gemeinde über die Bestätigung der Festanstellung von Kirchen-Mitgründer Felix ab. Ich lege noch schnell meine Bratwurst ab, dann hebe auch ich meine vom Senf verschmierte Hand.
Pastor Tony von der Partnergemeinde Imago Dei aus North Carolina ist auch da. Im Auftrag seiner Pfingstkirche besucht er die nach Deutschland ausgesandten Missionare. Auf dem Weg von einem Missionar zum nächsten scheint er ein Jägerschnitzel nach dem anderen zu vertilgen. Ob ich auch so gerne Jägerschnitzel esse, fragt er mich. „Als Kind immer und gerade neulich“, stimme ich in seine Begeisterung ein. Später hält er vor versammelter Grillmannschaft noch eine kleine Ansprache. Er entschuldigt sich ironisch für Donald Trump, lobt die Gastfreundschaft der Deutschen unter Merkel und schließt unter Gelächter: „Praise God for Jägerschnitzel!“ – An Bio als Staatsziel denkt hier niemand.
Wie steht’s um die Gastfreundschaft?
Jägerschnitzel ist zweifellos ein kulinarisches Highlight. Was die Gastfreundschaft der Deutschen betrifft, habe ich so meine Zweifel. Schließlich gibt es zwischen der politisch erwünschten und von der Politik orchestrierten Gastfreundschaft gegenüber „Flüchtlingen“ und der Gastfreundschaft eines sich von der Politik unbeaufsichtigt fühlenden Deutschen einen ziemlich großen Unterschied.
Szenenwechsel: An der Goethe-Uni in Frankfurt unterrichte ich Deutsch-als-Fremdsprache. Folgende Textpassage einer deutschen Auswanderin nach Australien führt zu peinlich berührten Blickwechseln zwischen mir und meinen Studenten: „Überraschend war für mich, dass das Leben hier lockerer als in Deutschland ist. Die Leute sind nicht immer so gestresst und ich habe schnell viele neue Freunde gefunden. In Deutschland dauert das ja oft ein bisschen länger.“ Was sich liest wie ein Klischee, ist keines mehr, sobald ich meine Studenten anschaue. Von China bis nach Syrien ist die Meinung fast unisono: „Genauso ist es. Die Deutschen sind voreingenommen, stellen viele Fragen, sind distanziert und laden uns nie zu sich nach Hause ein. Es ist fast nicht möglich, mit ihnen befreundet zu sein.“
Nach dem Unterricht kommen einige Studenten auf mich zu, um mich für ihre Whatsapp-Gruppe einzuladen. Fast erleichtert verweise ich auf mein Neandertalerhandy ohne Internet. Von meinem Klapphandy könne man eigentlich nur die Uhrzeit ablesen, bedeute ich Ihnen.
Mittag bei Mama Zana
Rühmliche Ausnahmen gibt es Gott sei Dank immer: Die Frankfurter Werbeagentur Vier für Texas, die sich inmitten von Drogen, Dreck und Dirnen im Bahnhofsviertel eingerichtet hat, besitzt einen massiven Holztisch in der Größe von drei aneinandergestellten Tischtennisplatten, gleich wenn man zu Tür reinkommt. Dort versammeln sich jeden Mittag um 12.30 Uhr alle Mitarbeiter und lassen sich von Mama Zana bekochen. Das Besondere ist, dass die Agentur immer einen Platz für jemanden von außerhalb reserviert. Ich schreibe eine kurze Mail und bin dabei. Das Essen steht auf der Theke bereit. Mama Zana klingelt um 12.25 Uhr die Triangel. Man passt jetzt besser auf sich auf oder man wir von den aus den Büros herausströmenden Mitarbeitern überrollt. Leider wird heute bei Vier für Texas kein Jägerschnitzel serviert, sondern nur Tandoori Hähnchen mit Kichererbsen und Römersalatherzen und als Nachtisch ein Waldbeerendessert mit unter der Creme zerkrümelten Schokocookies. Spaß habe ich aber trotzdem, da die hübsche Werbetexterin Kate aus Texas neben mir sitzt. Kate lebt seit zwei Monaten in Frankfurt. Sie berichtet mir von ihren Schwierigkeiten, in Frankfurt Freunde zu finden:
„Ich komme aus Austin. Die Leute sind dort im Gegensatz zu hier sehr freundlich. Und auch ein Freund aus Schweden sagte mir, dass er ein Jahr brauchte, um in Frankfurt Freunde außerhalb seines Arbeitsplatzes zu finden. Und er versuchte es wirklich. Er ging in Bars, versuchte sich mit jedem zu unterhalten. Frauen ignorierten ihn, weil sie dachten, er wollte sie anbaggern. Er wollte aber nur nett sein und mit den Leuten plaudern. Männer fanden es komisch und dachten, warum redet der Typ jetzt mit mir.
Ich bin selbst allein in Bars ausgegangen und keiner hat mich angesprochen. Jeder hat mich allein gelassen. Hier wird man schon ziemlich ignoriert. Vielleicht ist es aber einfach nur Höflichkeit.
Die mürrischen Deutschen
Amerikaner lächeln natürlich viel mehr. In Deutschland sieht jeder so verärgert und traurig und mürrisch aus. Dabei lebt ihr in einem der besten Länder der Welt. Eine großartige Krankenversicherung, die wir Amerikaner nicht haben, unglaublich viele Urlaubstage. Bei uns zum Beispiel müssen die Kassierer im Supermarkt acht Stunden am Tag stehen. Sie dürfen sich nicht hinsetzen. Die Angestellten werden bei uns überhaupt nicht gut behandelt. Aber sie haben eindeutig die bessere Laune.“
Meine gute Laune ist schlagartig im Eimer. Abrupt wird unser Gespräch unterbrochen. Faust bedroht mich, Faust kommt näher, aggressiv und entschlossen. Doch Mama Zana greift zur Wasserpistole und spritzt Faust – alle Hunde in Frankfurt heißen entweder Faust oder Mephisto – in das linke Ohr. Faust trollt sich schließlich in seine Ecke. Kann man eigentlich auch aus einem Hund Jägerschnitzel machen?, frage ich mich.
Ich sehe wirklich keinen Grund, warum die deutschlandweite Jägerschnitzelmissionswelle ausgerechnet vor einem durchgeknallten Agenturhund haltmachen sollte.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

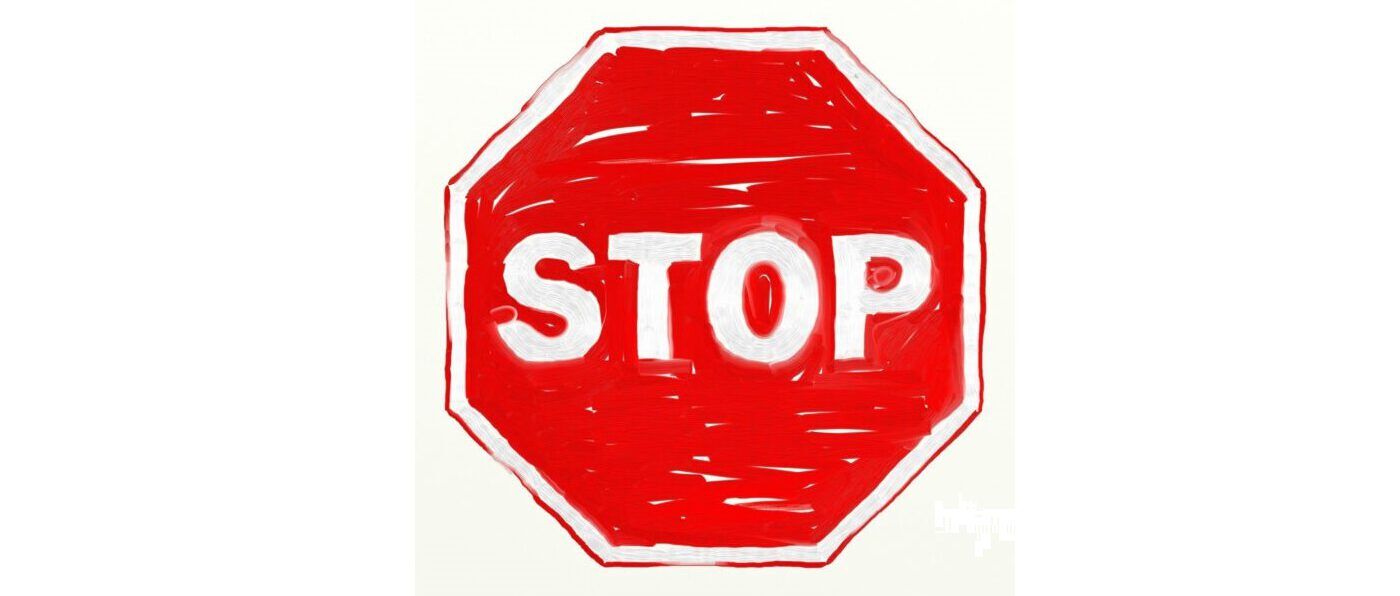
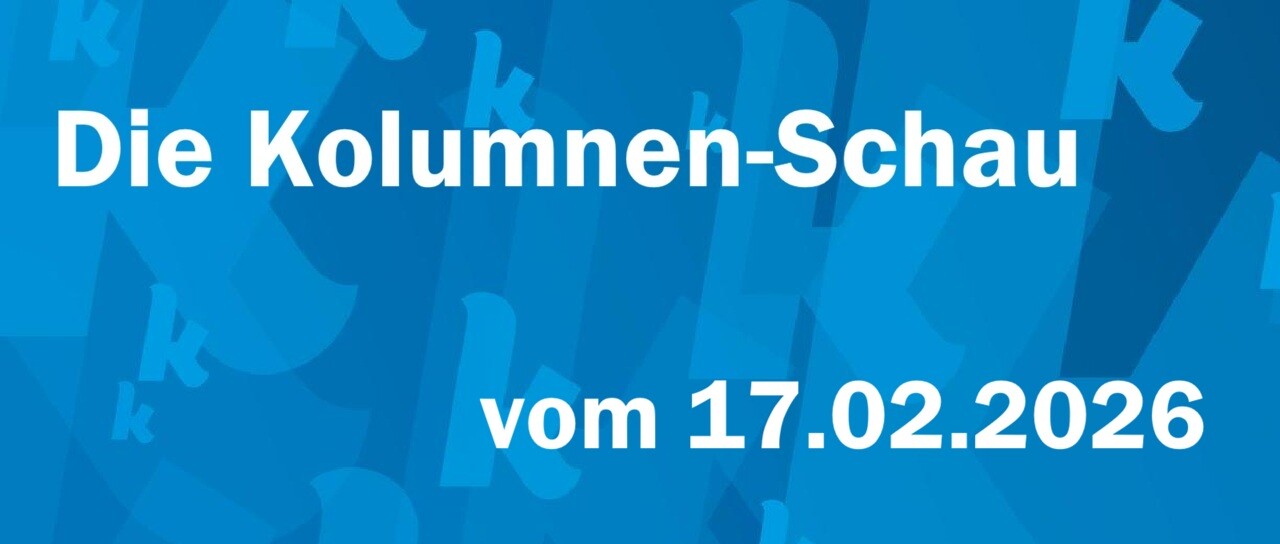

Marianne
Na gut Claus.
Du solltest mal den Aushang an der Sprachenschule in Leeds sehen, das Äquivalent zur Frankfurter DAF Troupe.
* Do not hug and kiss us. We would feel embarrassed and wouldn’t know how many times it would be appropriate to hug either. *
* Do not ask how many children we have or if we have any at all *
And so it goes on! 🙂 ☆