Wir leben, scheints, in einer Zeit der absoluten Urteile ebenso wie des totalen Relativismus. Verrückt: Differenzierung, das ist nicht mehr das notwendige Durchdenken eines Gegenstandes, das zu einem – und sei es noch vorläufigen – Schluss kommt. Differenzierung ist die falsche Antipode des Bauchgefühls. Die einen wüten über den Wald, bis sie die Bäume vor Kleinholz nicht mehr sehen, die anderen sezieren zu Tode, was zum gleichen Ergebnis führt.
In dieser Zeit, in der Denken unmöglich scheinen will, möchte ich empfehlen, einen zur Erstveröffentlichung schon kaum wahrgenommenen und heute wohl fast vergessenen Roman des tansanischen Schriftstellers Abdulrazak Gurnah zur Hand zu nehmen: Das verlorene Paradies, das gleich mehrere heute das Blut in Wallung bringende Themen von unerwarteter Seite anschneidet.
Blutige Handelsreise. Schulden und Schuld
Ein kleiner Hotelier im fiktiven Kawa im damaligen Deutsch-Ostafrika ist von finanziellen Sorgen geplagt. Er leiht sich Geld von einem lokalen Großkaufmann, der routinemäßig in derartige Unternehmungen investiert. Der Hotelier aber schafft es nicht sein Geschäft auf Vordermann zu bringen, und kann seine Schulden nicht zurückzahlen. Als Ausgleich gibt er seinen Sohn in den Sklavendienst des Kaufmanns.
Im bürgerlichen Leben bedeute Freiheit, dass ein jeder die Verantwortung für seine Entscheidungen zu tragen habe, so ein Leitsatz, den vor allem der klassische Liberalismus geprägt hat. Paradies erinnert daran, dass, wo immer es um die Frage von Schuld und Schulden geht, Bereitschaft und Zwang Verantwortung tatsächlich zu tragen höchst ungleich verteilt sind. Gurnahs Schuldner trägt das Risiko der Geschäftspleite in einer Gesellschaft ohne soziale Sicherungssysteme – einer Pleite also bei Strafe des eigenen Untergangs. Der Investor das Risiko, sein Geld zu verlieren, mit dem bei der Investition in ein sowieso schon schlecht gehendes Hotel einfach zu rechnen ist. Schuld am Scheitern wären beide, die ein schlechtes Geschäft eingegangen sind, könnte man denken. Schwamm drüber. Doch als die Unternehmung fehlschlägt, wälzt der Investor, der von Anfang an die bessere Position in einem schlechten Geschäft innehatte, auch das finanzielle Risiko so gut es geht auf den Schuldner ab und verdient noch an der Arbeitskraft des Sohnes (woraus natürlich folgt: Auch der Schuldner bleibt hier nicht einfach Opfer, sondern schiebt Verantwortung ab und lässt einen anderen für sich leiden).
So oder so ähnlich soll es heute nicht mehr laufen, zumindest in Rechtsstaaten, wo im privaten Rahmen Konkursgesetzgebung die schlimmsten Auswüchse früherer Schuldknechtschaft und der auch ökonomisch unsinnigen Schuldhaft (lesen Sie Dickens dazu!) verhindern soll. Doch die Macht zwischen Kreditgeber und Schuldnern ist faktisch ungleich verteilt, und gerade wenn die Schuldner Banken oder Staaten sind, darf weiterhin der schwächste Dritte büßen (also für gewöhnlich jener Teil der Bevölkerung, der zuvor schon am wenigsten profitierte).
Rassismus, Imperialismus, „arabischer Sklavenhandel“
Der versklavte Sohn arbeitet erst im Garten, dann im Laden des reichen Kaufmanns. Er findet manchmal Zeit, durch die von Leben flirrenden Straßen Kawas zu streifen, in Streitereien zu geraten und mit jungen Mädchen in Kontakt zu kommen. Diese Jugendjahre nutzt Gurnah, um dem Leser ein plastisches Bild tansanischer Hafenstädte im späten 19. Jahrhundert zu zeichnen. Der Sohn dient sich hoch, er wird zur rechten Hand des Kaufmanns und begleitet später eine ausgedehnte Expedition ins Landesinnere. Sklavenhandel, Imperialismus, trickreiches Übervorteilen von „Eingeborene“, denen das Tauschprinzip nach bürgerlichem Modell fremd ist, das lernt man heute schon in der Schule als ein westliches Monopol betrachten, von der Bewertung einmal ganz abgesehen. In Paradies zeigt Gurnah uns den arabischen Sklavenhandel, der an der afrikanischen Ostküste ähnlich einschneidende Änderungen mit sich brachte wie der europäische im Westen und der spätere westliche Kolonialismus im Osten. Nicht zuletzt ist das in Tansania, Kenia, Uganda und Ruanda gesprochene Swahili unter anderem auch ein Produkt der fortdauernden arabischen Kontakte mit diesen Ländern. Doch Paradies moralisiert nicht und spielt nicht Imperialismen gegeneinander aus, wie es im rechtsliberalen und konservativen Spektrum dann gerne versucht wird. Auch die nicht arabisierte Bevölkerung im Landesinneren wird nicht nach dem Bild des Edlen Wilden verklärt. Fortschritt kann schrecklich barbarisch sein, und doch können sich meist nicht einmal die, die der Fortschritt brutal überschritten hat, guten Gewissens in die Zeit davor zurück wünschen.
Eine ganz ähnliche Dialektik entfaltet übrigens Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa in Der Geschichtenerzähler.
Das Herz der Finsternis
„Joseph Conrad war durch und durch Rassist. Herz der Finsternis projiziert das Bild Afrikas als die andere Welt, die Antithese Europas” – das schrieb einst der nigerianische Schriftsteller Chinua Achebe. Gurnahs Paradies ist nun in seiner gesamten Struktur ein Spiegel des verfemten Meisterwerkes, und auch in seiner Ideenwelt nicht einfach die sogenannte Dekonstruktion, sondern mindestens ebenso sehr, wie es stereotypen Darstellungen bei Conrad einen Widerpart bietet, Bestätigung der zu Grunde liegenden scheinbar unaufhaltsamen Dynamik. Gerade westlichen, postkolnial sensibilisierten Lesern, müssten Gurnahs Darstellung des tansanischen Inlands mindestens ebenso aufstoßen wie der immerhin absichtsvoll durch den dämonischen Blick des Kurtz gebrochene Kongo Conrads. Hätte wohl Achebe seine wortgewaltigen Anschuldigungen auch im Angesicht Gurnahs wiederholt? Ich bezweifle es. Die Geschichte des Kolonialismus ist eine gewaltvolle, und doch ebenso schwer in den Kategorien einfacher Moral zu greifen wie Literaturkritik als moralische gelingen kann.
Freiheit, Verantwortung, Schuld. Rassismus, Kolonialismus. Abdulrazak Gurnahs Paradies ist womöglich harter Stoff für Leser, die mit vorgefertigten Denkmustern an diese Themenkomplexe herangehen. Allen anderen bietet es eine literarisch ebenso anspruchsvolle wie kolonialgeschichtlich lehrreiche Leseerfahrung, und eine Antwort mehr auf den idiotischen Anwurf Saul Bellows „Wer ist der Tolstoi der Zulus?“, populär teilweise generalisiert zu „zeigt mir den afrikanischen Tolstoi“ (wobei fragleich bleibt ob nicht, wie es Bellow darstellt, eher die Presse, die seine These zuspitzte, in den Fokus der Kritik zu rücken wäre) .
Aber da gibt es neben Gurnah unter anderem mit Mwangi, Ben Okri, Ngugi, Sembene, Mongo Beti und zahlreichen anderen ja eigentlich sowieso genügend gute Antworten.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


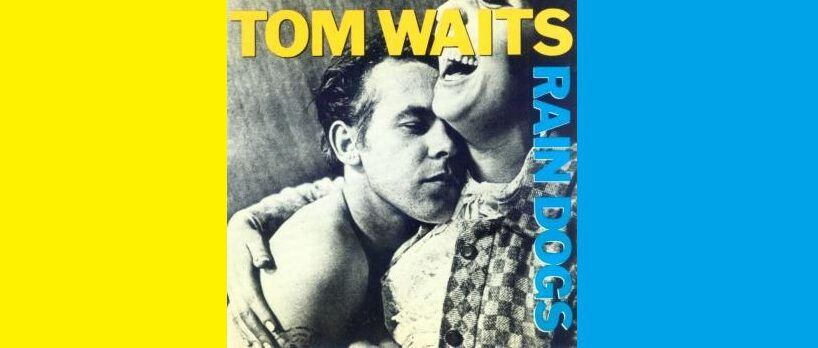

Ihr Kommentar