Intertextualität ist wohl der Fetisch der zeitgenössischen Literaturkritik. Nicht als das archäologische Aufspüren von Textzusammenhängen, wie es lange vor Genettes wegweisendem Palimpseste bereits betrieben wurde, nachweislich schon in den Blütezeiten der Bibliothek von Alexandria. Sondern das Heranziehen von möglichst vielen Zitate und Anspielungen als Qualitätsmerkmal eines Autors für sich. Der Fetisch der Intertextualität ist der Hauptgrund, warum so viele junge Autoren in schlecht verstandener Folge James Joyce der Vorstellung verfallen, eine anspielungsreiche Arbeit glänze schon von alleine und strenge Komposition sei etwas für Spießer und ewig Gestrige. Anspielungen und Zitate sind auch das Hauptargument, das immer wieder herangezogen wird, wenn es darum geht Bob Dylan nun aber wirklich für den Nobelpreis ins Spiel zu bringen oder ihn wenigstens als einen der großen Dichter unserer Zeit anzuerkennen. Bei der Intertextualität endet die Dylan-Apologie dann meist auch schon. Über die innere Form der Werke wird selten detailliert gesprochen oder geschrieben.
Bob Dylan (nicht?) verstehen
Einer, der es in jüngerer Zeit zumindest versucht hat ist Tony Beck. In Understanding Bob Dylan untersucht Beck stellenweise in ergiebiger Form unter anderem Reim- und Rhythmusschemen in Dylans Songs, weist nach, dass Dylan neben den traditionellen Endreimen manches Mal geschickt mit Reimen innerhalb von Zeilen, mit Assonanzen und Alliterationen spielt, was ihn definitiv über manchen Wald- und Wiesenpoeten erhebt und Auge in Auge stellt mit dem ein oder anderen ambitionierteren Hiphopper. Doch auch Beck muss zwischen den Zeilen eingestehen, dass Dylan den seit Baudelaire entwickelten poetischen Verfahrensweisen eigentlich nichts hinzuzufügen hat und zumindest formal die literarische Moderne an Dylan größtenteils vorbeigezogen ist. Einwand: natürlich, es handelt sich um Lieder, die muss man singen können. Einwand gegen den Einwand: Sicher, doch wer Dylan als Dichter würdigen möchte, vielleicht sogar mit Literaturpreisen, der hat sich auf Textebene zu stellen. Dylan dürfte das ziemlich egal sein, und der Qualität der Songs als Songs tut es auch keinen Abbruch. Aber auf der reinen Textebene? Auch beim Versuch nachzuweisen, dass das mehrfach kritisierte Sad Eyed Lady of the Lowlands mehr als „meaningless dribble“ (so die Kritik) sei, glänzt Beck nicht. Nach 30 Seiten Ausarbeitung schließt er:
The words are so vague that they could have multiple – or no – Meanings. And that’s the beauty of the song, we are left to figure for ourselves what these wordassociations mean.
Am Ende belässt es dann auch Beck im Großen und Ganzen bei Hinweisen darauf, aus welchen Traditionen (Der Dichter als Reisender, Geld vs. Liebe, Individualismus vs. Gesellschaft) Dylan schöpft. Gerade dabei legt er aber unabsichtlich auch den Finger auf die nicht gerade geringe Klischeelastigkeit nicht weniger Texte, die sich besonders offenbart wenn man sie des musikalischen Kontext entkleidet. Besonders schmerze dürften Dylan-Fans Becks Gegenüberstellungen von Texten Wordsworths und Yeats sowie Springsteens mit Dylan. Dass hier in Präzision der Wortwahl, in Rhythmik und Sprachmelodie sich doch zwischen His Bobness und The Boss weit mehr Gemeinsamkeiten finden lassen als etwa zwischen Dylan und den englischen Romantikern, unterminiert Becks Stoßrichtung doch ein wenig.
Ovid und die Unterwelt
Das vielleicht lesenswerteste Buch zu Bob Dylans Quellen und seinen Ansprüchen als Songtexter der letzten Jahre kommt von Heinrich Detering. In Die Stimmen aus der Unterwelt legt Detering kenntnisreich dar, wie etwa fast jede einzelne Zeile aus dem oberflächlich so simplen Working Mans Blues #2 von Ovid übernommen, aus Folk-Traditionen kopiert oder von dem unbekannten Südstaatendichter Henry Timrod stibitzt wurde. Analog zeigt Detering für Roll on John, ein später Nekrolog auf John Lennon, dass hier für den Text Robert Fagles Odyssee-Übersetzung die Grundlage legte, mit Einsprengseln aus Beatles-Songs, Gebeten und William Blakes Tygre.
In der Vielstimmigkeit des Zitategestöbers und der Collagenkunst setzt Dylan die Identitätsspiele, die sein Werk und seine Selbstinszenierungen von Beginn an bestimmt haben, auf einem veränderten Schauplatz fort. Zu diesem Schauplatz gehört, wie die amerikanische Musik, die Weltliteratur mitsamt ihren spezifisch amerikanischen Anverwandlungen und Brechungen – und mitsamt Dylans bisherigem eigenen Werk, das in Zitaten und Anspielungen, Echos und Reminiszenzen allgegenwärtig ist und das nun selber eingeht in den Chor der Stimmen.
beschreibt Detering Dylans Projekt im Spätwerk seit „Love and Theft“, und beim Nachvollzug dessen kann man durchaus eine Gänsehaut bekommen. Aber gerade, wer Literatur nicht zum elitären Zitatejagen verkommen lassen möchte sollte sich an die Regel halten „entscheidend ist, was hinten raus kommt“. Und ein Vers wie
A gal named Honey
Took my money
She was passing by
It’s soon after midnight
And the moon is in my eye
taugt nun mal schwerlich zum Anschauungsobjekt für große Literatur, selbst wenn jede einzelne Zeile von Shakespeare, Spenser und aus der Bibel geklaut wäre. Damit soll Dylans Ansinnen nicht in Misskredit gebracht werden. Es handelt sich um ein einmaliges Unterfangen praktischer Musik-, Literatur- und Mythenarchäologie, das in Gänze übrigens nur würdigen kann, wer die Musik gerade nicht abschneidet. In Misskredit gebracht werden soll, wenn Kritik überhaupt in Misskredit bringen kann, die paranoide Literaten-Götterverehrung rund um Dylan, die sich einerseits den Anschein gibt endlich einmal Volkspoesie zu höheren Weihen verhelfen zu wollen, andererseits das mit dem elitärsten denkbaren Mittel versucht, dem sammeln gelehrter Zitate.
Man muss den Nobelpreis nicht vor Bob Dylan retten. Aber Dylan rettet man vielleicht besser vorm Nobelpreis.
Epilog
Entscheidend ist was unten rauskommt. Ich versuche das abschließend anhand eines einfachen Gedichtchens zu demonstrieren:
niedlich bist du anzuschauen
anmutig sind deine wangen
was hilfts? wir müssen vertrauen
du fällst aus träumen ins licht.
wohin ist dein liebster gegangen?– ich widersteh‘ dir auch heute nicht –
immer sind vornan die frauen
gilts edel, herzen zu fangen.
Hierin versammelt finden Sie in mehr oder weniger stark abgewandelter Weise Zitate aus dem Hohelied Salomons, aus Goethes Faust, Stücken Shakespeares, Liedtexten von Ton Steine Scherben, und für die Bodenhaftung – Helene Fischer. Das Gedicht ist nun wirklich nichts besonderes, nach meinem Dafürhalten sogar ziemlich schlecht. Und das liegt nicht an Helene Fischer.
Bücher: Detering, Heinrich: Die Stimmen aus der Unterwelt: Bob Dylans Mysterienspiele. C.H.Beck 2016
Beck, Tony: Understanding Bob Dylan. Selbstverlag 2011/2015
Lesen sie zum Thema auch: Bitte Nicht Bob Dylan!
Ihnen hat dieser Artikel gefallen? Sie möchten die Arbeit der Kolumnisten unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihre Spende:
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
20 comments
sh
Heute wurde nicht der #Literaturnobelpreis #BobDylan verliehen. Der Preis leiht sich Bob Dylan. Darüber wird der Preis nicht hinwegkommen. Dylan bleibt. Nobel wurde das Grab geschaufelt.
Andreas Kern
Habe auf den Kalender geschaut. Ist gar nicht der 1. April…Na gut, vielleicht bekommt ja demnächst Schlagersängerin Nicole (alternativer Vorschlag Udo Lindenberg, obwohl der wäre ja jetzt auch ein Kandidat für die Literatur) den Friedensnobelpreis, Dr. House den für Medizin und Jamie Oliver den für die Wirtschaft…
Andreas Kern
Sehr guter Artikel. Halte Nobelpreis für Dylan für einen Witz. Wenn jetzt schon Songtexte preiswürdig sind, plädiere ich für Stefan Remmler von Trio. Schließlich war Dadaismus auch eine Literaurform…
sh
Das reine Ablehnen dieses Preises macht es sich natürlich einfach, man kuschelt sich kulturkonservativ in das Ideal einer Literatur, die es so rein selten und eines Nobelpreises, den es so nie gegeben hat. Dieser Preis vermischte ja schon immer wie kaum ein anderer künstlerische und außerkünstlerische Kriterien und wird ausdrücklich für eine gewisse Haltung mitvergeben. Und Dylan IST einer der größten Musiker unsrer Zeit. Und wohl auch textlich besser als einige der auch schon ausgezeichneten Pappnasen.
Aber: Mindestens müsste diese Entscheidung den Preis radikal verändern. Man müsste sich ihrer weitreichenden Implikationen bewusst werden. Dass das nicht geschehen wird ist mir das größte Problem.
Andreas Kern
Der letzte Punkt ist absolut richtig: Man müsste die Kriterien des Preises ändern. Es mag kulturkonservativ klingen, aber man sollte schon zwischen Musiktexten und Literatur unterscheiden. Gibt es nicht für das Genre Musik eigene Preise, und hat Mr. Dylan nicht einige davon gewonnen? Man mag über Preisträger wie Naipaul, Jelinek, etc. streiten können, aber das entsprach den Kriterien.
Ansonsten kann man wirklich auf die Idee kommen, dem Papst für seine Kapitalismuskritik den Wirtschaftsnobelpreis zu geben oder Vaclav Klaus, wenn man es eher mit der Marktwirtschaft ohne Attribute hielte. Daher: Die Verleihung des Literaturnobelpreises an einen Singer-Songwriter bleibt für mich fragwürdig.
sh
Das Problem ist ja nicht die Frage nach der Textqualität. Da gäbs vll auch Diskussionsbedarf. Aber so zu tun als könnte man ein Lied einfach durch den Abzug der Musik in Literatur umrechnen zeugt mE auch vor mangelndem Respekt vor Musik als Kunstform. Im Ergebnis bleibt die Verleihung dadurch aber für mich ebenso fragwürdig. Sonntag kommt nochmal was dazu.
derblondehans
… doch, doch, man kann. Man kann Goethe von Schubert und Schubert von Goethe ‚abziehen‘. Oder ist das zu viel Autobahn?
sh
Wenn Schubert Goethe zu Musik setzt ist das fertige Kunstwerk ein eigenständiges Werk. Wenn man davon Goethe abzieht hat man ein dudelndes Klavier und viele Pausen.
derblondehans
… mhm?! Es gibt noch andere Instrumente. Die Violine, ohne Pause, zum Beispiel.
derblondehans
… was Dylans außergewöhlich literarisches Talent angeht (Wikipedia), guckst du, u.a., ‚Hard Rain’s A-Gonna Fall‘ in A.W.s ‚Outside in the distance‘.
sh
das nennen von Titeln, auch das zitieren von Textzeilen ersetzt keine ARBEIT AM TEXT. Gute alte konservative Literaturkritik. Und es drückt sich um das Kernproblem ob man ein Lied einfach durch den Abzug der Musik in Literatur umrechnen kann.
derblondehans
… so richtig kann ich Sie nicht verstehen. Das mag an mir liegen. Ich will gar nicht AM TEXT ARBEITEN, falls Sie das meinen. Das kann ich auch gar nicht. Das hat wohl das Nobelkomitee getan. Aber wenn Sie besser sind, nur zu … Ich bin Techniker.
Hinter ‚Hard Rain’s A-Gonna Fall‘, u.a., verbirgt sich mehr als ‚eine‘ Textzeile. Wenn Sie wollen, ARBEITEN Sie sich daran ab. Lassen Sie uns (mit)lesen!
The Saint
Dylan für Literatur. Martin Chulz für Frieden. Kim Kardashian für Medizin. Macht alles Sinn.
derblondehans
… echt Freunde, er hat ihn bekommen. Fakt. Wie Mubarak Hussein Obama den Friedensnobelpreis. Warum? … the answer, my friend, is blowin‘ in the wind.
Ulf Kubanke
hehe, top Vorlage, Kollege Sören!
ich halte in meiner Parallel-Kolumne dennoch dagegen.
En Garde!
…und wenn die versammelten Kommentatoren zur (gar nicht notwendigen) Rettung des Abendlandes hier schon Schnappatmung und gehobenen Nölertums anheimfallen, müssen selbige dort aufpassen, nicht am Ende nen Herzkasper zu bekommen.






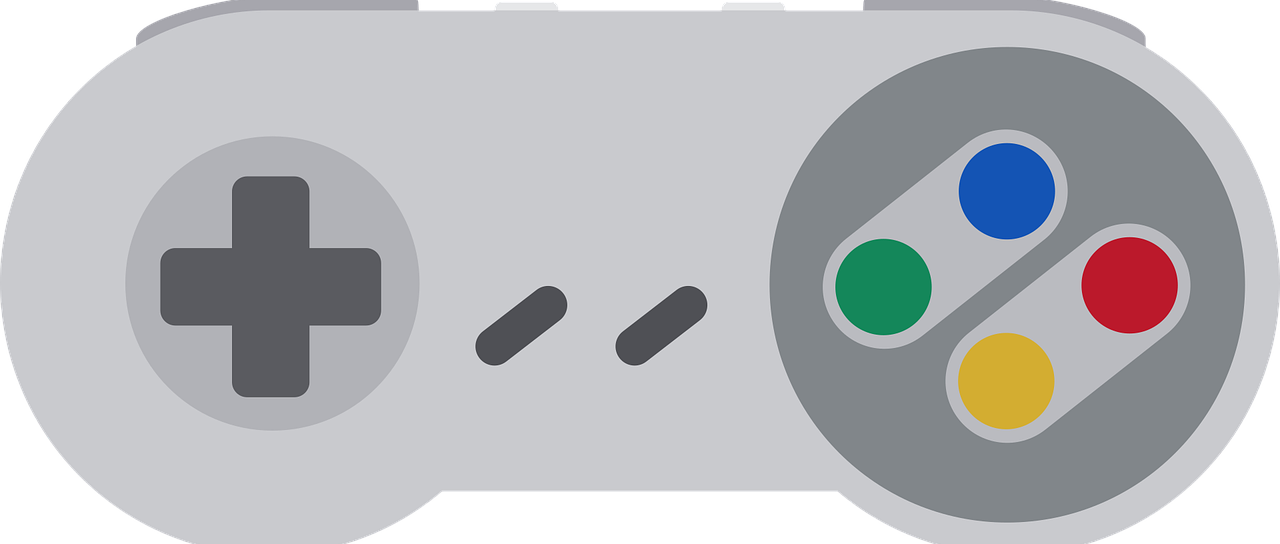




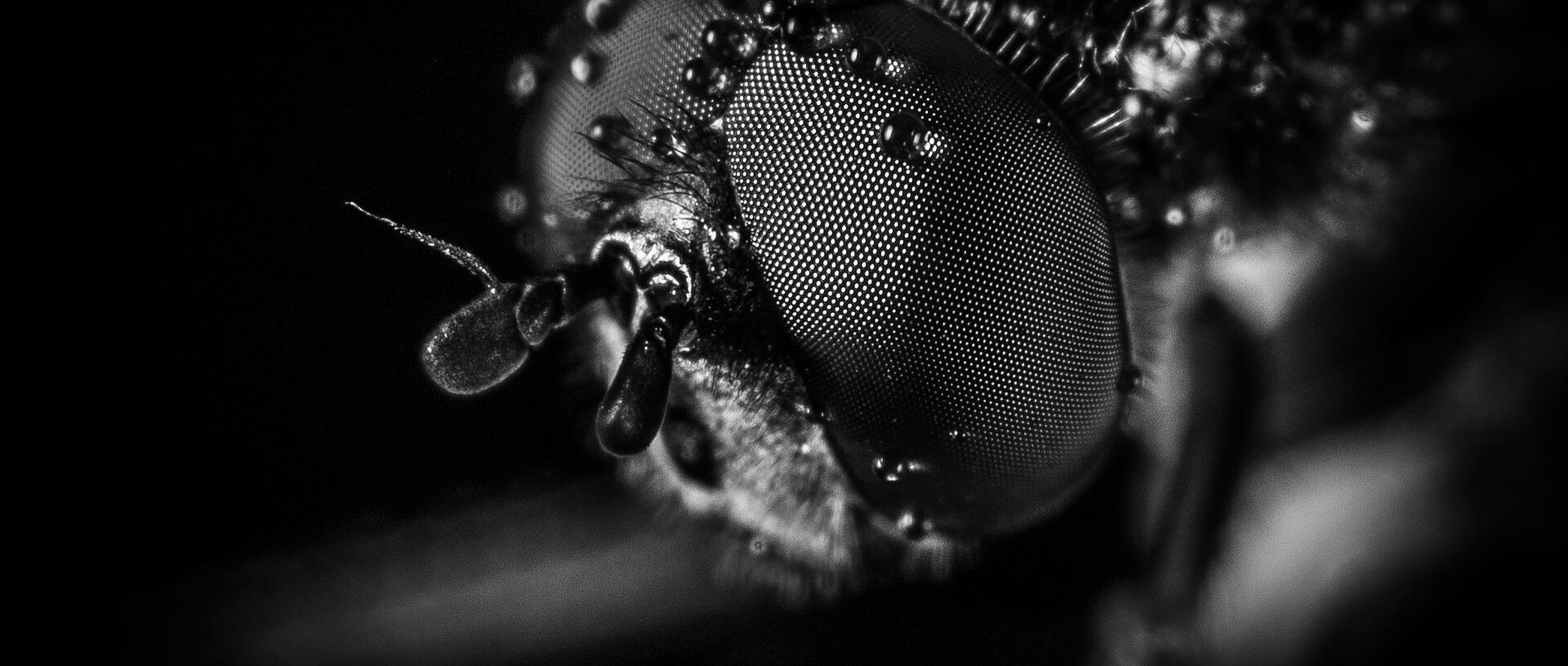









UJ
Habe vorhin im DLF einen Kommentar zum Nobelpreis an Dylan gehört. Man gab sich begeistert und fand, das sei eine tolle Wahl sei, weil
a) Bob Dylan irgendwie selber eine literarische Figur sei (schließlich heißt der Mann doch eigentlich Robert Zimmerman!)
b) Churchill den Preis schließlich auch bekommen habe
c) Man ja auch gönnen können müsse.
Ich hoffe, das Komitee hat sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht…