Berechtigte Parallelen? Die „zweite“ russische Demokratie und „Weimar“
Parallelen zwischen dem postsowjetischen Russland und der Weimarer Republik gehören seit dem Beginn der 1990er Jahre zum ständigen Repertoire der russischen und der westlichen Publizistik. Die Ähnlichkeiten sind auf den ersten Blick in der Tat verblüffend. Wie damals in der Weimarer Republik assoziierte man im postkommunistischen Russland die Demokratie mit dem Zusammenbruch der hegemonialen Stellung der beiden Länder auf dem europäischen Kontinent, mit dem Verlust von Territorien und mit der Entstehung einer neuen Diaspora. Zur nationalen Demütigung gesellten sich in beiden Fällen eine katastrophale Wirtschaftskrise und der Verlust der bis dahin als selbstverständlich geltenden Orientierungen. Nicht zuletzt deshalb wird im Russland-Diskurs der letzten 25 Jahre häufig der Begriff Weimarer Russland verwendet.
Einige grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Konstellationen lässt man allerdings bei diesem Vergleich außer Acht. Deutschland als Verlierer des Ersten Weltkrieges wurde in Versailles einer Reihe militärischer, politischer und wirtschaftlicher Restriktionen unterworfen, die die Entwicklung des Weimarer Staates stark belasteten. Der nach der Auflösung der UdSSR beendete Kalte Krieg kannte hingegen offiziell keine Sieger und Verlierer. Russland übernahm den ständigen Sitz der UdSSR im Sicherheitsrat der UNO und blieb gleichberechtigtes Mitglied im „Konzert der Weltmächte“. Auch militärisch lässt sich Russland als zweitstärkste Nuklearmacht der Welt mit der Weimarer Republik und ihrem Hunderttausend-Mann-Heer nicht gleichsetzen.
All das wurde im Westen in den 1990er Jahren nicht ausreichend gewürdigt, als man der Versuchung erlag, Russland dennoch als Verlierer des Kalten Krieges zu betrachten.
Eine vertane Chance?
Obwohl in Russland zu Beginn der 1990er Jahre noch reformorientierte Kräfte dominierten, wurde das Land nicht ausreichend in die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Strukturen des Westens integriert. Eine einmalige Chance wurde vertan. Noch Mitte 1992 bezeichnete der damalige russische Staatspräsident, Boris Jelzin, die westlichen Länder als „natürliche Verbündete Russlands“. Aber schon bald danach begannen sich die Beziehungen zwischen Moskau und den westlichen Hauptstädten abzukühlen. Die national gesinnten Gruppierungen im Lager der siegreichen russischen Demokraten – der Bezwinger des kommunistischen Putschversuchs vom August 1991 – warfen Anfang der 1990er Jahre den Westmächten, vor allem den USA, immer wieder vor, sie versuchten den Status Russlands als Großmacht zu erschüttern. Eine solche Haltung sei sehr kurzsichtig, sagte damals der ehemalige russische Botschafter in Washington, Wladimir Lukin:
Die NATO – dies war eine amerikanische Reaktion auf das starke und aggressive Russland und auf das schwache und geschlagene Deutschland. Die Fortsetzung der gleichen Strategie in einer Situation, in der Deutschland immer stärker und Russland immer schwächer wird – das ist keine Politik, sondern eine Trägheit des Denkens.
Die Warnungen des damaligen Außenministers Andrej Kosyrew – eines der wichtigsten Exponenten der prowestlichen Orientierung in der politischen Klasse Russlands – an die Adresse der USA waren denjenigen Lukins ähnlich. In einem Vortrag an der amerikanischen Columbia Universitysagte Kosyrew:
Jeder Versuch, den Status Russlands als Großmacht auszuhöhlen, hat mit politischem Realismus nichts zu tun. Aufgrund seiner menschlichen und materiellen Ressourcen und aufgrund seiner geographischen Position bleibt Russland eine Großmacht.
Zugleich rief Kosyrew den Westen dazu auf, die krisengeschüttelte russische Demokratie zu unterstützen: „Der Sieg der Demokratie in Russland wird stabilisierend auf den gesamten eurasischen Raum wirken“, so Kosyrew.
Zum Zankapfel zwischen Ost und West wurde nun in einem immer stärkeren Ausmaß die Frage der neuen sicherheitspolitischen Strukturen in Ostmitteleuropa – dem ehemaligen „Glacis“ der Sowjetunion an der westlichen Peripherie des 1989-1991 aufgelösten Ostblocks. Die seit Beginn der 1990er Jahre geplante Osterweiterung der NATO rief heftige Proteste in Moskau hervor. Der bereits erwähnte Lukin sagte in diesem Zusammenhang: Juristisch gesehen, dürfe die NATO neue Mitglieder aufnehmen und keiner dürfe ihr das verbieten. Politisch gesehen sei dies jedoch nicht haltbar. Es bedeute, dass Russland über Probleme der europäischen Sicherheit nicht mitreden dürfe.
Gab es ein westliches Versprechen, die NATO nicht in Richtung Osten zu erweitern?
Wie verhält es sich in diesem Zusammenhang mit dem angeblichen Versprechen der westlichen Gesprächspartner Moskaus aus dem Jahre 1990, die NATO nicht in Richtung Osten zu erweitern? Auf dieses Versprechen beziehen sich bis heute viele russische Publizisten und Politiker. Oft wird in diesem Zusammenhang die Aussage des amerikanischen Außenministers James Baker zitiert, der am 9. Februar 1990 in Moskau Folgendes sagte:
Wir verstehen, dass es nicht nur für die Sowjetunion, sondern auch für die anderen europäischen Länder wichtig ist, Garantien dafür zu haben, dass – wenn die Vereinigten Staaten ihre Anwesenheit in Deutschland im Rahmen der NATO aufrechterhalten– die Jurisdiktion oder militärische Präsenz der NATO in östlicher Richtung um keinen Zoll ausgedehnt wird.
Anatolij Tschernjajew, der zu den engsten Mitarbeitern Gorbatschows zählte, kommentierte fünf Jahre später (Mai 1995) in einem Interview mit der Deutschen Welle die damaligen Vorgänge folgendermaßen:
Am 9. Februar 1990, als Baker mit Gorbatschow zusammentraf und der Mechanismus ´2+4´ sehr eingehend erörtert wurde, versicherte Baker Gorbatschow, daß die Amerikaner eine Osterweiterung der NATO nicht zulassen würden. Gorbatschow fragte ihn immer wieder danach, und Baker versicherte ihm eindeutig, daß Amerika diesen Standpunkt vertrete … Gentlemen´s Agreements, mündliche Vereinbarungen, hat es also gegeben. Natürlich haben sie keine bindende Kraft, aber es ist ein moralischer Faktor, es ist eine Frage des Vertrauens. Und hätte es in der Politik Gorbatschows kein Vertrauen, kein moralisches Element gegeben, dann hätte es auch keine Vereinigung (Deutschlands) gegeben, dann hätte er sich auf die Vereinigung niemals eingelassen und wäre bei der Denkweise des Kalten Krieges geblieben“.
Auch eine Aussage des Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher, die während einer Tagung der Evangelischen Akademie in Tutzing am 31. Januar 1990 fiel, wird in diesem Zusammenhang oft erwähnt. Genscher rief nämlich die NATO dazu auf, folgende Erklärung abzugeben: „(Die) Ausdehnung des NATO-Territoriums nach Osten, das heißt näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben.
Auch diese Forderung blieb unverbindlich. Zum Bestandteil eines Vertragswerks wurde sie nicht.
Gorbatschow wehrte sich seinerseits gegen seine innerrussischen Kritiker, die meinten, er habe es versäumt, den Verzicht der NATO auf eine Osterweiterung vertraglich abzusichern, und zwar mit folgendem Argument: Eine Osterweiterung der NATO habe 1990 noch keine realistische Option dargestellt, weil der Warschauer Pakt zum damaligen Zeitpunkt noch existiert habe.
Gorbatschows Zustimmung zur Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands in der NATO
Nun aber zurück zu den Zusagen der westlichen Gesprächspartner an Gorbatschow.
Man darf nicht vergessen, wann sie gemacht wurden. Dies war die Zeit, in der Gorbatschow sich zwar mit der Einheit Deutschlands abgefunden hatte (dies tat er bereits Ende Januar 1990), aber die Zugehörigkeit des vereinten Deutschlands zur NATO noch strikt ablehnte. Dies nicht zuletzt deshalb, weil er sich unter dem permanenten Druck der reformfeindlichen Kräfte in den Führungsgremien der Partei und des Militärs befand, die ihm eine allzu große Nachgiebigkeit in der deutschen Frage vorwarfen. So erklärte er z. B. am 18. Mai 1990 im Gespräch mit James Baker, die Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands in der NATO würde eine grundlegende Veränderung des strategischen Gleichgewichts nach sich ziehen und die innersowjetischen Reformen gefährden: „Es wäre das Ende der Perestroika“. Um Gorbatschow umzustimmen, waren einige seiner westlichen Gesprächspartner bereit, ihm mehr zu versprechen, als sie einhalten konnten.
Ende Mai 1990 revidierte Gorbatschow allerdings beim Gipfeltreffen mit dem amerikanischen Präsidenten George Bush in Washington, zur Verblüffung sowohl der amerikanischen als auch der sowjetischen Delegation, seine unnachgiebige Haltung und erklärte, man müsse dem vereinten Deutschland selbst die Entscheidung überlassen, zu welchem Bündnis es gehören wolle. Die Tatsache, dass Gorbatschow letztendlich von seinem kategorischen Nein zur NATO-Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands abrückte, führt Anatolij Tschernjajew darauf zurück, dass der sowjetische Staatschef auf die Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses hoffte, in dem militärische Blöcke ohnehin keine Rolle mehr spielen würden. Dieses „gemeinsame europäische Haus“ ist bekanntlich nicht errichtet worden. Dies war einer der Gründe für die Erosion und schließlich auch für das Scheitern der „zweiten“ russischen Demokratie, die durch die „gelenkte Demokratie“ Wladimir Putins abgelöst wurde.
Post-Weimarer Russland?
Wie lässt sich die „gelenkte Demokratie“ Putins definieren? Kann man sie mit dem System vergleichen, das der 1933 zerstörten „ersten“ deutschen Demokratie folgte, also mit dem NS-Regime? Der amerikanische Politikwissenschaftler Alexander J. Motyl sieht durchaus Ähnlichkeiten zwischen den beiden Systemen. Er schreibt:
In beiden Ländern gaben die Menschen den Befürwortern der Demokratie … die Schuld an allen Übeln. Hypernationalismus und eine Fetischisierung des Staates kompensierten die Frustrationen. Starke Männer ergriffen – auf legalem Wege – die Macht und nutzten die Bereitschaft der Bevölkerung zur Unterwerfung, um ihre diktatorische Herrschaft zu errichten.
Die Partei „Einiges Russland“, auf die sich Putin stützt, ähnelt nach Ansicht Motyls zwar nicht den faschistischen Parteien vor ihrer jeweiligen Machtübernahme, als sie noch auf eine revolutionäre Veränderung des Systems setzten. Ähnlichkeiten bestünden aber aus seiner Sicht zwischen der Partei „Einiges Russland“ und den faschistischen Parteien in der jeweiligen Regime-Phase: „Sehr wohl ähnelt (Einiges Russland) … den Nationalsozialisten oder den italienischen Faschisten nach der Machtergreifung. Denn dann füllten diese ihre Reihen mit Trittbrettfahrern und Karrieristen und glichen kaum noch den militanten Bewegungen, aus denen sie entstanden waren.“
Die Tatsache, dass die Partei „Einiges Russland“ über keine kohärente Ideologie verfügt, dass ihr ideologisches Rüstzeug aus einer Reihe von Versatzstücken besteht, die unverbunden nebeneinander existieren, stellt aus Sicht Motyls ihre Wesensverwandtschaft mit der NSDAP oder mit der Partei der italienischen Faschisten (Partito Nazionale Fascista) nach deren jeweiliger Machtübernahme nicht in Frage: „Faschistische Staaten vertreten keine allumfassende Ideologie, die auf alle Lebensfragen Antwort gibt. Sie wollen wie alle autoritären Staaten die Gesellschaft nur beeinflussen und kontrollieren“.
Vor allem der Charakter des NS-Regimes wird durch solche Aussagen in einer eklatanten Weise verkannt.
So verfügte der Nationalsozialismus, anders als Motyl meint, durchaus über eine allumfassende Ideologie, die in gewisser Hinsicht nach einer noch gründlicheren Veränderung der bestehenden Verhältnisse strebte, als dies bei den Kommunisten der Fall war. Die NSDAP wollte die Gesellschaft nicht „nur beeinflussen und kontrollieren“, sondern grundlegend verändern. Anders als Motyl suggeriert, verlor die NSDAP nach der „Machtergreifung“ keineswegs ihren früheren revolutionären Elan. Im Gegenteil: Erst der Machtbesitz verlieh ihr die Möglichkeit, ihr rassenpolitisches Programm mit voller Wucht zu verwirklichen. Es begann nun eine Reihe von Vernichtungsfeldzügen, zu deren Opfern im Laufe der Jahre immer größere Menschengruppen zählten, darunter – psychisch Kranke, polnische Intellektuelle, sowjetische Kriegsgefangene, Sinti und Roma, slawische Völker in den besetzten Gebieten, in erster Linie aber die Juden, die für die nationalsozialistischen Ideologen das Böse an sich verkörperten und deshalb gänzlich eliminiert werden sollten.
Die Tatsache, dass das NS-Regime sich ununterbrochen radikalisierte, wird von Motyl verkannt. Er schreibt:
Gewalt und Massenmobilisierung (sind) durchaus konstitutive Merkmale faschistischer Bewegungen, insbesondere revolutionärer. In etablierten politischen Ordnungen, und seien sie noch so repressiv, können Gewalt und Massenmobilisierung dagegen nur sporadisch eine Rolle spielen, denn sie gefährden die herrschende Ordnung.
Die These von einer „nur sporadischen“ Anwendung von Gewalt in den „etablierten“ faschistischen Staaten hat mit der Wirklichkeit des NS-Staates nichts gemein. Hier wurde der Terror im Laufe der Jahre immer systematischer und radikaler. Den Gipfel seiner Radikalität erreichte das Regime kurz vor seinem Zusammenbruch. Als Verehrer von Richard Wagner versuchte Hitler den Untergang des Dritten Reiches als eine Art Götterdämmerung zu inszenieren. Da er in seinem Erscheinen auf der politischen Bühne die Erfüllung der deutschen Geschichte sah, sollte nach seinem Ableben auch die deutsche Geschichte an ihr Ende gelangen.
Solche Endkampfszenarien sind der „gelenkten Demokratie“ Putins nicht eigen. Auch das Streben der Faschisten und der Nationalsozialisten nach der Erschaffung eines „neuen Menschen“ und einer neuen, nie dagewesenen Gesellschaft ist den Anhängern der „gelenkten Demokratie“ eher fremd. Ihr Programm ist nicht revolutionär, sondern vor allem restauratorisch, wobei der Machterhalt wohl ihr wichtigstes Ziel darstellt. Nicht zuletzt aus diesem Grund neigen sie nicht dazu, in der Alternative „Alles oder Nichts“ zu denken, wie dies für das NS-Regime charakteristisch war. Zwar handelte es sich bei der russischen Annexion der Krim oder beim Vorgehen der Kreml-Führung in der Ost-Ukraine um sehr riskante, ja abenteuerliche Schritte. Die entschlossene Haltung des Westens (Sanktionen) veranlasste die Kreml-Führung indes dazu, auf die Verwirklichung des im Frühjahr 2014 wohl geplanten „Neurussland-Projekts“, also auf die Ausdehnung der Moskauer Einflusssphäre auf den gesamten Südosten der Ukraine, zu verzichten. Dafür erntete Putin heftige Kritik von den radikal-nationalistischen Gruppierungen im Lande.
Im rechtsradikalen Spektrum Russlands gibt es zwar durchaus Kräfte, die von einer gänzlichen Bezwingung der westlichen „Sieger des Kalten Krieges“, von einer Art „Endkampf“ träumen. Zu ihren bekanntesten Exponenten gehört der „Neoeurasier“ Alexander Dugin. Dennoch ist es Dugin, trotz seiner wiederholten Anbiederungsversuche an Putin, nicht gelungen, den Rang eines Chefideologen des Kremls zu erreichen.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


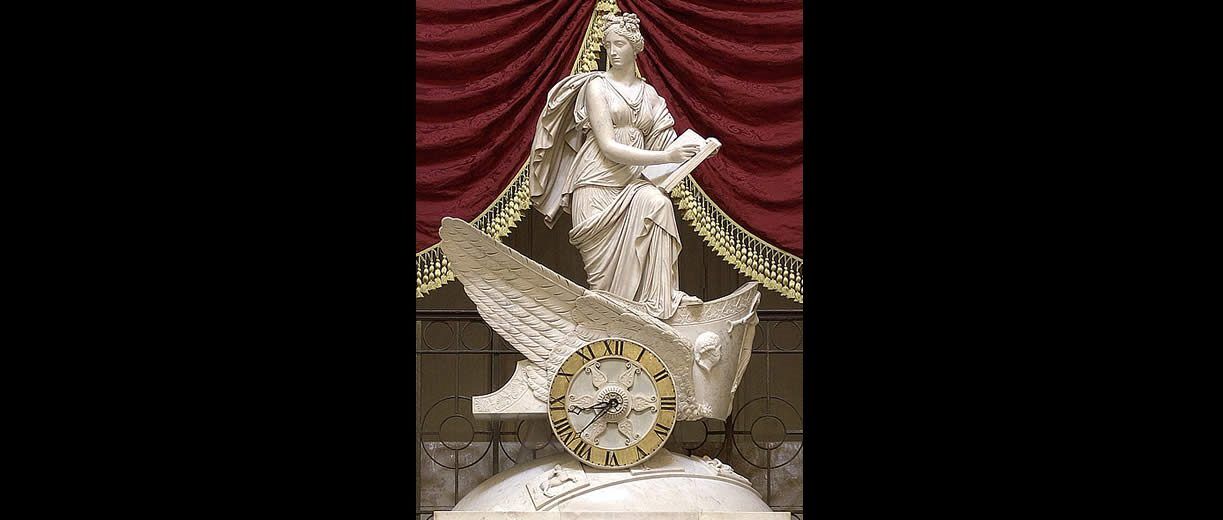

Heiko Heinisch
Danke für diesen guten Artikel.
Eine Anmerkung: Auch die Massenmobilisierung spielte nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten keineswegs eine nur sporadische Rolle. Sie war vielmehr ein konstitutives Element des NS-Staates.