Seit geraumer Zeit versucht der Moskauer Schriftsteller Viktor Jerofejew den westlichen Lesern das Phänomen „Russland“ zu erklären und die Mythen über Russland, die im Westen angeblich kursieren, zu entzaubern. Er tat dies auch vor kurzem in seinem F.A.Z.-Artikel „Märchenheld mit Rambo-Komplex“ (12. März 2016), der durch folgende apodiktisch formulierte These eingeleitet wurde: „Russland war niemals und wird niemals Europa sein, wir ähneln niemandem“. Die Devise der Zarin Katharina II. vom Jahre 1767: „Russland ist eine europäische Macht“ hält Jerofejew anscheinend nicht für überzeugend.
Das „Prinzip des Patriotismus“ im Ost-West-Vergleich
Um zu zeigen, wie grundlegend sich die russische Mentalität von der „europäischen“ unterscheide, zitierte Jerofejew in einem früheren F.A.Z.-Artikel vom 26. Mai 2014 folgende Aussage des irischen Schriftstellers James Joyce, die er für die Versinnbildlichung einer angeblich typisch westlichen Haltung hält: „Man sagt mir, stirb für Irland. Ich aber sage, soll Irland doch für mich sterben!“. Diese Sätze werden von Jerofejew folgendermaßen kommentiert:
Man kann sich kaum vorstellen, dass ein gewöhnlicher Russe so etwas im 21. Jahrhundert über sein Land sagen würde, denn das widerspricht dem russischen Prinzip des Patriotismus und des Dienstes an der Heimat.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass Jerofejew diese Thesen ausgerechnet in dem Jahr formulierte, in dem Europa an den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges – der „Urkatastrophe“ des 20. Jahrhunderts – erinnerte, dessen Beginn seinerzeit von unzähligen Europäern euphorisch begrüßt wurde. Sie handelten damals keineswegs nach dem oben zitierten Grundsatz von James Joyce, sondern eher nach dem „Prinzip des Patriotismus“, das Jerofejew als eine vor allem für die Russen typische Haltung betrachtet. Dabei darf man nicht vergessen, dass die zerstörerischen Erfahrungen des Ersten Weltkrieges keineswegs zur Eindämmung der patriotischen bzw. nationalistischen Emotionen im westlichen Teil des „alten Kontinents“ führten. Im Gegenteil. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sollten sie sich zusätzlich vertiefen. Über die damals im Westen verbreitete Neigung zur Verklärung der eigenen Nation schrieb der russische Exilhistoriker Georgij Fedotow 1931 Folgendes:
Das Vaterland scheint für die Mehrheit der heutigen Europäer die einzige Religion, der einzige moralische Imperativ zu sein, der sie vor der individualistischen Zersetzung rettet. Die Größe des Vaterlandes rechtfertigt jede Sünde, verwandelt jede Niedertracht ins Heldentum“
Erst die verheerenden Erfahrungen des „Zweiten Dreißigjährigen Krieges“ (1914-1945) sollten in Europa zu einem Paradigmenwechsel führen – zur Abkehr von einer grenzenlosen Verklärung des nationalen „sacro egoismo“.
Und wie verhielt es sich im gleichen Zeitraum (also in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts) mit dem „Prinzip des Patriotismus und des Dienstes an der Heimat“ in Russland selbst? Prägte es wirklich die Haltung der russischen Gesellschaft im Sinne der vorhin zitierten Aussage Jerofejews? Wohl kaum. Für den politisch aktivsten Teil der russischen Bildungsschicht – für die Intelligenzija – spielte das nationale Prestige des eigenen Staates, nicht zuletzt aufgrund ihrer radikalen Ablehnung des zarischen Regimes, so gut wie keine Rolle. Die außenpolitischen Rückschläge der Zarenmonarchie wurden von manchen politischen Gruppierungen im Lande sogar begrüßt. Dies zeigte sich insbesondere während des russisch-japanischen Krieges von 1904-1905. Der Ahnherr der russischen Sozialdemokratie, Georgij Plechanow, schrieb damals:
Darauf läuft ja gerade die tiefe Tragik aller russischen Uniformträger hinaus, dass zurzeit ´den Feind besiegen´ nichts anderes bedeutet, als der ´eigenen Gesellschaft eine Niederlage beibringen´.
Erst nach der Niederlage des Zarenreiches im russisch-japanischen Krieg fand in den Reihen der russischen Intelligenzija eine Art nationale Renaissance statt. Mit diesem Vorgang war auch die Tatsache verbunden, dass viele Vertreter der Intelligenzija nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, ähnlich wie die Bildungsschichten Deutschlands, Frankreichs oder Großbritanniens, von einem patriotischen Taumel erfasst wurden. Defätistische Stimmungen stellten damals innerhalb der politischen Klasse Russlands eher ein Randphänomen dar, und beschränkten sich lediglich auf die Bolschewiki und einige andere linksradikale Gruppierungen. Auf die russischen Unterschichten hatte sich diese nationale Wende der Eliten indes nicht erstreckt. Der Erste Weltkrieg wurde von ihnen nicht als „Vaterländischer Krieg“ erlebt. Dies ungeachtet der Tatsache, dass Russland nach dem Sturz des Zaren im Februar/März 1917 zu dem „von allen Krieg führenden Ländern freiesten Land der Welt“ wurde (Lenin). Die Mehrheit der russischen Soldaten, bei denen es sich im Wesentlichen um „Bauern in Uniform“ handelte, war nicht an der Verteidigung der „ersten“ russischen Demokratie vor ihren außenpolitischen Gegnern, sondern vor allem an der Abrechnung mit ihren innenpolitischen Gegnern, mit den Gutsbesitzern, interessiert:
„Die Volksschichten … weigerten sich plötzlich das Land zu verteidigen. Im dritten Jahr des Weltkrieges verlor das Volk die Überzeugung von der Notwendigkeit der Existenz Russlands“, so der bereits erwähnte Georgij Fedotow.
Ganz anders sollte es sich später mit dem im Juni 1941 ausgebrochenen deutsch-sowjetischen Krieg verhalten. Damals handelte die Mehrheit der Russen in der Tat nach dem „Prinzip des Patriotismus“, das Jerofejew als eine „typisch russische“ Einstellung betrachtet. Der russische Patriotismus wurde damals zu der wohl wichtigsten Kraft, an der Hitlers „Griff nach der Weltmacht“ zerbrechen sollte.
Dessen ungeachtet ist der Versuch Jerofejews, das „Prinzip des Patriotismus und des Dienstes an der Heimat“ zu einem unwandelbaren Bestandteil des russischen Nationalcharakters zu erklären, wenig überzeugend. Er verkennt die Komplexität und Widersprüchlichkeit der geschichtlichen Entwicklung Russlands und trägt zur Verbreitung neuer Russland-Mythen bei, statt diese zu entzaubern.
Gehört Russland zu Europa?
Nicht anders verhält es sich mit einigen weiteren Thesen, die Jerofejew in seinem jüngsten F.A.Z. Artikel vom 12. März 2016 vertritt. Er schreibt:
Der Westen fragt jetzt, warum Russland nach irgendwelchen eigenen Gesetzen lebt und die Gesetze der zivilisierten Welt missachtet.
Diese Frage zeige, so Jerofejew, dass der Westen die Lektion „Was ist Russland?“ nicht gelernt habe. Worin soll aber diese Lektion nach Ansicht des Autors bestehen? Jerofejews Antwort lautet:
Russland glaubt fest an die Einzigartigkeit seines Zaubermärchens, in dem von Gott auserwählte Menschen leben, die sich für unvergleichlich … besser halten als diese seelenlosen Europäer.
Erneut wird ein sehr komplexes Phänomen, nämlich die „Einstellung Russlands zum Westen“, stark vereinfacht und die heutige Dämonisierung des Westens, die die „gelenkte Demokratie“ Putins aus Angst vor den mit Europa assoziierten demokratischen Werten betreibt, auf frühere Epochen der russischen Geschichte ausgedehnt. Denn der Glaube an die „Einzigartigkeit“ bzw. an die „unvergleichliche“ Überlegenheit Russlands gegenüber den „seelenlosen Europäern“ stellt, vor allem seit der petrinischen Umwälzung zu Beginn des 18. Jahrhunderts, keineswegs den roten Faden der russischen Geschichte dar.
„Anbetungswürdige Literatur“ und „heilige Steine“
Peters Versuch, Russlands „Sonderweg“ zu verlassen und die Kluft zwischen Ost und West zu überwinden hatte in Russland zwar zahlreiche Kritiker, aber auch viele Bewunderer auf den Plan gerufen. Letztere waren sich darüber im Klaren, dass das vorpetrinische Russland dringend kulturelle Anregungen von außen benötigte, um seine immer tiefer werdende kulturelle Stagnation zu überwinden. Und woher konnten diese Impulse sonst kommen, wenn nicht aus dem Westen? Intuitiv habe Peter I. durch die Wiederherstellung der Einheit der europäischen Welt den für die russische Kultur fruchtbarsten Entwicklungsweg gewählt, sagt der russische Kulturhistoriker Wladimir Weidlé. Die großen kulturellen Leistungen des Petersburger Russlands im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts seien Folge der petrinischen Umwälzung gewesen, so Weidlé. Eine Abwendung von Europa sei für Russland unmöglich, weil es infolge seiner Christianisierung zum unverzichtbaren Bestandteil der europäischen Kultur geworden sei, setzt Weidlé seine Ausführungen fort. Aber auch für den Westen könne der Verlust Russlands unabsehbare Folgen haben. Denn Russland verkörpere nach dem Untergang von Byzanz die Tradition des östlichen Christentums, von dem der Westen immer wieder Impulse für seine Erneuerung erhalte.
Und in der Tat. Von der Überwindung der Kluft zwischen Ost und West, die Peter der Große vollzogen hatte, sollte nicht nur Russland, sondern auch der Westen profitieren. Auch Russland begann nämlich Impulse auszusenden, die wiederum auf die westliche Kultur belebend wirkten. Friedrich Nietzsche bezeichnete z. B. Fjodor Dostojewski als den „einzigen Psychologen, von dem (er) etwas zu lernen hatte“ und Thomas Mann sprach von der „anbetungswürdigen … heiligen russischen Literatur“.
Nicht anders wurde übrigens auch die westliche Kultur von manchen russischen Autoren definiert, sogar von solchen, die ansonsten zu den scharfen Kritikern des Westens zählten. So sprachen etwa sowohl der slawophile Religionsphilosoph Alexei Chomjakow als auch Fjodor Dostojewski von den anbetungswürdigen Schätzen der westlichen Kultur, von den „heiligen Steinen“ des Westens.
Russlands „europäische Sehnsucht“
Die bolschewistische Revolution hatte diesen Prozess der gegenseitigen Befruchtung jäh unterbrochen und schottete Russland für Jahrzehnte vom Westen ab. Um so erstaunlicher waren die Prozesse, die sich auf dem Kontinent in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre anbahnten. Die zwei Teile Europas, die siebzig Jahre lang voneinander getrennt gewesen waren, begannen wieder zusammenzuwachsen. Ein Teil der russischen Eliten wurde nun von der Sehnsucht erfasst, nach Europa zurückzukehren. Und es wäre völlig verfehlt, diese Sehnsucht lediglich als „romantische Schwärmerei“ abzutun, wie dies gelegentlich geschieht. Denn sie hatte ganz konkrete politische Folgen. Das „politische Wunder“ der friedlichen Revolutionen von 1989, die Überwindung der europäischen Spaltung und die deutsche Einheit wären ohne diese „Sehnsucht“ und ohne den Verzicht des Reformflügels in der Gorbatschow-Equipe auf die „Breschnew-Doktrin“, die der von Gorbatschow lancierten Idee des „gemeinsamen europäischen Hauses“ eklatant widersprach, undenkbar gewesen.
All das stellt die These Jerofejews „Russland war niemals und wird niemals Europa sein“, massiv in Frage.
Russische „Europäer“ vs. „Nationalpatrioten“ – eine immer noch offene Kontroverse
Zwar ist die Euphorie der Jahre 1989-91 längst verflogen, zwar werden die russischen „Europäer“, denen der „alte Kontinent“ die friedliche Überwindung seiner Jahrzehnte langen Spaltung im Wesentlichen verdankt, im heutigen vom „patriotischen Tsunami“ (Nowaja gaseta) erfassten Russland nicht selten als „Vaterlandsverräter“ diffamiert. Dessen ungeachtet ist das letzte Wort in dem seit drei Jahrhunderten dauernden Streit zwischen den prowestlich orientierten russischen Reformern und ihren russozentrischen Kritikern immer noch nicht gesprochen. Dieser Sachverhalt wird von Jerofejew kaum beachtet. Der Jetztzustand, in dem es den Nationalpatrioten gelang, die russischen „Europäer“ weitgehend zu marginalisieren, prägt beinahe gänzlich seine Argumentation. Dass es in der Geschichte der letzten Jahrhunderte bereits Perioden gab, in denen sich das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Kontrahenten ganz anders gestaltete, wird von Viktor Jerofejew kaum in Betracht gezogen, ebenso wenig wie die Möglichkeit, dass sich der aktuelle Ist-Zustand in absehbarer Zukunft auch wieder ändern kann. Russland hat die Welt schon oft überrascht.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


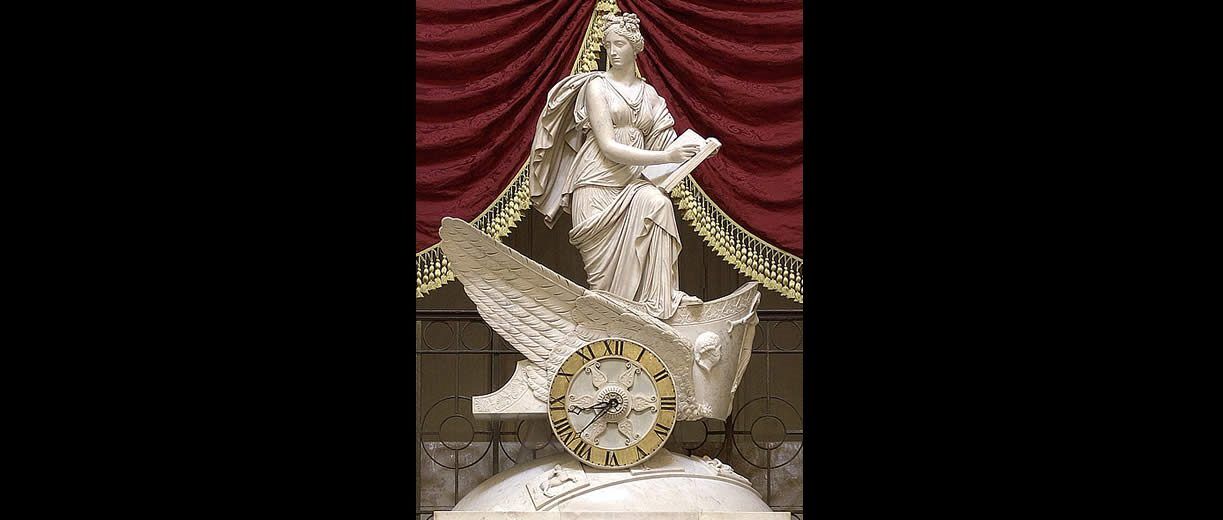

Ihr Kommentar