Teil 1 eines Zweiteilers über sprachliche Schönheit. Nächsten Sonntag: Schönheit, wo man sie kaum erwartet.
Das Lesen des (vor) letzten Rushdie machte mich regelrecht traurig. Das bringt mich dazu, einen Mangel zu formulieren, den ich in neuerer Literatur, so wahr es sein mag dass diese im Schnitt ein deutlich höheres Niveau hält als vor 100 Jahren, regelmäßig empfinde. Denn mit schmerzhafter Deutlichkeit zeigte sich auch in Zwei Jahre, acht Monate und achtundzwanzig Nächte wieder (wie auch in den Shortlist-Rezensionen), dass Schriftsteller es heute kaum mehr wagen, schöne Sätze oder Satzgefüge zu schreiben (in der Folge der Einfachheit halber allesamt unter der Bezeichnung „schöne Sätze“ gefasst). Selbst die Größten unserer Zeit – und Rushdie ist sicher unter den Großen noch einer der Größten, obschon ihm spätestens seit Fury kaum mehr Überdurchschnittliches, und zudem einiges Schwaches, geriet – suchen die ästhetische Wirkung allein in den Strukturen, während die Sprache mehr und mehr zum reinen Medium der Informationsvermittlung gerinnt.
Dann lieber den Koran!?
Während auf struktureller Ebene das vormoderne „What happens next“ (Rushdies Prägung) verfemt wird, gerät die Sprache im Kleinen immer mehr gerade zu seinem Sklaven. Im Falle des (vor) letzten Rushdie springt das so schmerzhaft ins Auge, weil der einzige Satz, der ein wenig klingt, schwingt, der in seinem Fluss die Information transzendiert, und nicht so auch in einer Amtsbroschüre stehen könnte, ausgerechnet ein Zitat aus dem Koran ist: „Und Wir senden aus den Regenwolken Wasser in Strömen hernieder, auf dass Wir damit Korn und Kraut hervorbringen mögen und üppige Gärten“ (Es liegt nicht an der Übersetzung, ich habe die englische Version natürlich gegengelesen).
Niemals sollte die Literatur so weit kommen, dass man versucht ist, einen großen Meister beiseite zu legen und aus ästhetischen Gründen stattdessen ein religiöses Werk in die Hand zu nehmen.
Schönheit. Eine Umkreisung
Aber was sind „Schöne Sätze“? Während die Komposition im Großen sich gewissenhaft analysieren und so vielleicht auch von Autorenseite besser planen lässt, was die Affinität der zeitgenössischen Meister einer durch und durch professionalisierten Literatur womöglich erklärt, lässt sich die Schönheit einzelner Sätze und Passagen wohl eher umkreisend festmachen. Schöne Sätze, das sind solche, die klanglich-strukturell nicht im reinen Informationsgehalt aufgehen und die dennoch dem Text Relevantes hinzufügen, ohne das er rückblickend nicht mehr zu denken wäre. Schöne Sätze spürt man, doch man kann sich vergegenwärtigen, warum man sie spürt. Schöne Sätze schaffen Texte, die nicht überfliegbar sind. Die man nicht schnell- oder querlesen kann, die Emotion und Geist gleichermaßen ans Werk fesseln. Schön, das heißt nicht „angenehm“. Schönes kann weh tun, aber in einer Weise, die auch an den Schmerz fesselt. Kafka etwa schafft in seiner extrem reibungsreichen Sprache Transzendenz. Coelho in seinem Gesalbader nicht. Zentral vielleicht: Das von Proust ausgemachte Charakteristikum aller großen Kunst, Bekanntes in nie da gewesener Weise zu verknüpfen und die Einsicht zu evozieren: So habe ich das noch nie gesehen. Aber: Genau so hat man es doch schon immer sehen müssen!
Schöne Sätze, ländlich-rustikal:
Einmal waren die Pflaumen reif und die Äpfel reif und hell auf den Hügeln der Mittag und Drachen am Himmel und drunterher sind an langen Fäden die Kinder gerannt; diesen Tag hat es auch gegeben. (Peter Kurzeck, Das schwarze Buch)
Schöne Sätze, schwelgerisch-opulent:
Heute früh haben wir die letzte Wolke gesehen; in den Falten eines hellbraunen nahen Bergknäuls zur Rechten stieg eine schlanke lockige Nebelsäule auf, dehnte morgenselig in den kühlen Schatten silberbreite Ricsenschultern, reckte sich über den harten Gipfel mit goldenem Wildlingshaupt – ach, und frischer blauer Frühwind zog an uns, die Kleider bogen sich in raschen kurzen Schwüngen um alle. Und der Hund Aemilianus stand wie aus Marmor kalt und sicher und wartete höflich und verächtlich, bis ich begann, schweigend nach Süden zu schreiten. (Arno Schmidt, Enthymesis)
Schöne Sätze, rhythmisch sanft-elegant:
Of the coconut trees that bent into it and watched, with coconut eyes, the boats slide by. Upstream in the mornings. Downstream in the evenings. And the dull, sullen sound of the boatmen’s bamboo poles as they thudded against (Arundathi Roy, The God of Small Things)
Echte Bilder und überraschende Verbindungen
Zwei Aspekte, wie der Virtuose Schönheit schafft, fallen ins Auge. Die Verwendung echter Metaphern im Sinne sprachlicher Bilder. Und die syntaktisch unerwartete Kombination von Gedanken oder Bildern. Beides sind Tretminen, da die Grenze zum Kitsch und zur nur prätentiös geschraubten Sprache rasch überschritten ist. Ein Tanz auf der Klinge, den moderne Erfolgsschriftsteller naheliegender Weise immer seltener wagen, der auch kaum zu lehren ist und im industriellen Literaturbetrieb zwangsläufig auszusterben droht.
Und damit kommen wir zurück zum (vor) letzten Rushdie, der praktisch nur noch auf Vergleiche setzt, um Gesagtes gewissermaßen ornamental zu illustrieren. Welch langen Weg der Anbiederung an den Massengeschmack ist Rushdie dabei seit seinen ersten Welterfolgen gegangen, in denen sich zumindest noch bildreiche Passagen finden wie:
The gardens were deep in mist, through which the butterfly clouds were swirling, one mist intersecting another. This remote region had always been renowned for its lepidoptera, for these miraculous squadrons that filled the air by day and night, butterflies with the gift of chameleons, whose wings changed colour as they settled on vermilion flowers, ochre curtains, obsidian goblets or amber finger-rings. (The Satanic Verses)
Oder klangvolle Lautmalereien:
”To be born again,” sang Gibreel Farishta tumbling from the heavens, “first you have to die. Hoji! Hoji! To land upon the bosomy earth, first one needs to fly. Tat-taa! Taka-thun! How to ever smile again, if first you won’t cry? How to win the darling’s love, mister, without a sigh? Baba, if you want to get born again . . .”
Der Verlust der Schönheit bei Rushdie ist dann auch der Grund, warum ich mich hier durchgehend der Schreibweise vom (vor-)letzten Rushdie bemüßigt habe. War der Auto bisher trotz einiger Aussetzer einer, dessen neueste Werke ich mir immer ungelesen besorgen musste, ist das nun vorbei. Der Vorletzte ist für mich der Letzte, vor-erst.
Schattenseite der Professionalisierung
Literatur wird sich, so keine starke Erschütterung den Markt vollends auf den Kopf stellt, weiter in die Richtung des rein Gefälligen entwickeln. Die Professionalisierung hat zum Effekt, dass heute in wenigen Tagen soviel im Großen und Ganzen Gelungenes produziert wird wie vor 100 Jahren nicht in einer Dekade. Aber vor dem Meisterwerk, das die reine Faktenvermittlung aus fiktiven Welten auch sprachlich transzendiert, stehen mächtige Kräfte. Das schlechthin Große, wenn es überhaupt eine Chance hat, wird nur in den abgelegensten Nischen gedeihen. Vielleicht ist es kein Zufall, dass die Meisterwerke des vergangenen halben Jahrhunderts meist in Regionen erblühten, in denen sich zwar die Literatur im westlich-aufklärerischen Sinne, noch nicht aber ein durchorganisierter Literaturmarkt etabliert hatten. Und ebenso, wie die großen Romanciers unserer Zeit, insbesondere auch Rushdie, die eigentümliche Tendenz entwickelt haben, ihre unumstrittenen Meisterwerke sowohl in der Sprachqualität als auch hinsichtlich der formalen Geschlossenheit nach in jungen Jahren zu schaffen, ehe Markt und Gefallsucht ihren Stil glatt bügeln. In dieses Muster fallen unter anderem Marquez, Llosa, Pamuk, Roy sowie mit einer etwas länger anhaltenden Hochphase auch Pynchon. Das scheint mir ein durchaus neues Phänomen. Bis in die klassische Moderne hinein wuchsen Autoren an oder zerbrachen mit ihrem Werk, so sie bis ins höhere Alter lebten…
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



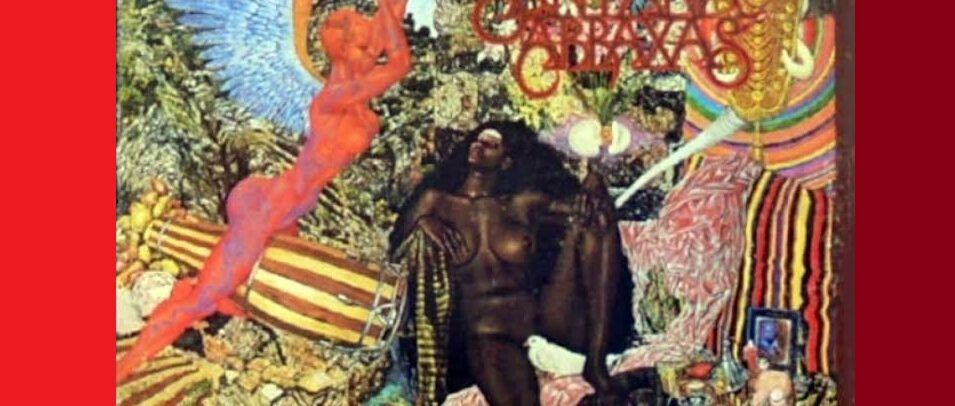
Ihr Kommentar