Nachdem ich in einem älteren Text die Hilfestellung „Show, don’t tell“ für Schreibende und Schreiblernende verteidigt habe, muss ich mich heute einmal der dunklen Seite des Diskurses um diese hilfreiche Handreichung widmen. Jenen Denkbefreiten in den sozialen Medien, die „Show, don’t tell“ tatsächlich so auffassen wie dessen verblendetste Gegner: als eine eherne Regel, die es stets zu befolgen gilt. Und die zudem ein sehr eingeschränktes Verständnis davon haben, wie man schreibend „zeigen“ kann. Nebenbei: Es fasziniert mich, wie nah stilistisch die Autorinnen und Autoren auf beiden Seiten des Grabens beieinanderliegen. Dort diskutieren nicht Meister des reduzierten Hard boiled gegen herausragende Prosa-Poeten wie sagen wir Robert Walser oder Adelheid Duvanel, sondern Autorinnen und Autoren, deren Texte sich in einem 10% Korridor um eine gedachte Mitte bewegen, die das Ideal der massenpublikumstauglichen modernen Unterhaltungsliteratur ausmacht. Ist es einem also vor allem um Literatur als Kunstform zu tun und nicht als Warenform, könnte man diese Debatten auch größtenteils ignorieren. Aber sie lassen sich ja schon allein aufgrund der Lautstärke kaum ignorieren und machen es aus Selbstverteidigungsgründen notwendig, einige Dinge dazu zu sagen, damit man sich dann wieder mit Anderem beschäftigen kann und im Zweifel auf den Text zum Thema verweisen.
Lustige bis traurige Beispiele
Ein paar lustige bis traurige Beispiele: Einmal hat mir ein Autor das Folgende dazu erklärt, wie modernes Schreiben auszusehen habe:
„Keine Metaphern, keine Bilder, keine „Poesie.“ Keine Sätze die länger als zwölf Wörter sind. Reduziert, verknappt, verdichtet – ich bin Minimalist. Der Autor sollte sich nicht zuletzt aus Ego-Gründen aus seinen Texten herausziehen, das schenkt den Figuren mehr Kraft, mehr Wirkung“. “
Auch wenn die Phrase ‚Show, don’t tell‘ nicht fällt, merkt man doch deutlich, dass hinter dieser Herangehensweise die radikale Auslegung dieser Philosophie steht. Ich habe mich damals damit auseinandergesetzt, indem ich aufgezeigt habe, wie wenig der Autor sich an die eigenen Regeln hält (weil sie nicht einzuhalten sind):
„Eigentlich möchte ich angesichts der starken Empirie, die gegen diesen Unsinn spricht gar nicht zu pedantisch sein. Dass jemand bestimmte Texte nicht mag und seine eigenen nach einem bestimmten Muster strickt ist ja noch ganz unproblematisch. Aber hier wird nicht nur aus der eigenen Vorliebe unreflektiert eine Regel gestrickt, auch das eigene Schreiben geschieht wohl relativ unreflektiert. In den Romanen des Autors, dessen neuestes Werk, genauer dessen erste Seite, ich mir dazu mal genauer angeschaut habe. Die reicht, um zu zeigen: Der Mann weiß nicht was er tut. Denn der längste Satz auf dieser Seite ist immerhin 21 Worte lang, die nächstlängsten 19 und 18. Die folgenden Bilder kommen mindestens vor: „übersät von Brandlöchern“ „nackter Beton“ „Regale… vollgestopft“.
Zugegeben, all das sind keine originellen Bilder, sie sind nicht vom Autor geschaffen sondern mehr oder weniger dem kollektiven Gedächtnis entlehnt. Als Bilder geschaffen wurden sie irgendwann dennoch. Man sät Getreide, nicht Brandlöcher. Regale sind ganz selten im Sinne des Wortes vollgestopft worden, und die Nacktheit des Betons ist natürlich eine bildliche Übertragung vom menschlichen Körper. Bilder: wir benutzen sie so unbedacht, wir erkennen sie kaum noch. Und manch herausragender Autor hat die Fähigkeit, stimmige neue zu schaffen.
Die Pedanterie erlaube ich mir nicht, weil ich finde, dass die erste Seite des Textes des Kollegen schlecht ist. Sie ist sogar gut. Der Stil ist dem trockenen, reduzierten, düsteren Setting adäquat. Ich gehe davon aus, er ist auch den Charakteren und der gesamten Szenerie des Romanes adäquat. Die wechselnde Satzlänge zwischen lakonischen Statements und den beiden ausgreifenden Aufzählungen ergibt einen stimmigen Rhythmuswechsel, da ist also auch die „Poesie“…“
Kürzlich las ich in einer größeren Facebook-Gruppe von Schreibenden, darunter auch professionelle, vor allem englischsprachige AutorInnen („professionell“ in diesem Fall verstanden als „verdienen ihr Geld wahrscheinlich vor allem mit Literatur“), man solle auf keinen Fall einen Text etwa mit einer Beschreibung des Wetters, der Landschaft, etc. beginnen. Dazu gab es einige Ablehnung, aber auch viel Zustimmung. Natürlich beginnen einige der herausragenden Texte in der internationalen Literatur durch die Jahrhunderte mit solchen wunderschönen Beschreibungen, die eine Stimmung setzen, eine Szene vorbereiten und ja, manche literarische Meisterwerke leben zu 90% davon, diese Stimmung durch den ganzen Text zu tragen. Auch hier gehe ich davon aus, dass die schreibende Person „Show, don’t tell“ im Hinterkopf hatte und zugleich zeigte, dass sie vom „Zeigen“ keine Ahnung hat.
Gerade erst vor einigen Tagen las ich dann von einer Autorin, die berichtete, dass sie sich mit ihrer Lektorin um die folgende Passage heftig streiten müsse:
„Averill remained in Jayden’s room, listening to the familiar sounds of a house at night. She could hear the hum of the refrigerator, the swoosh of the ceiling fans, and the floorboards creaking as they relaxed in the cool of the night. Through the open window she heard the flap of bat wings, the sigh of trees in the breeze, and the hoot of owls on the hunt.“
Die Lektorin erkläre nämlich:
“…you can’t hear bat wings, trees don’t sigh and a few other things.”
Herrje! Zugegeben, hier geht es vordergründig weniger um eine radikale Auslegung von „Show, don’t tell“, als darum, dass anscheinend jemand Lektorin geworden ist, die das Konzept von Bild und Metapher nicht verstanden hat. Aber ich denke im Hintergrund schwingt doch ein schlechtes Verständnis von „Show, don’t tell“ mit, nämlich ein Zurückscheuen von allem Poetischen, hin zu einer möglichst nüchtern-faktischen Darstellung von Geschehnissen. Das ist natürlich, gerade wenn man „Show, don’t tell“ ernst nehmen würde, grober Unfug. Denn eine Passage wie die obige zeigt sehr viel mehr als die bereinigte Szene, die vielleicht so klingen könnte:
“Averill remained in Jayden’s room. She heard noises. The refrigerator, the ceiling fans, the floorboards creaking. Outside bats flew. A breeze moved tha branches of the trees.”
Legion derweil sind in Literatur-Social-Media-Gruppen Aussagen wie „Thomas Mann geht gar nicht. Der hat keine Ahnung von „Show, don’t Tell“. Oder „Lese gerade ein altes Buch von Rushdie. Kann es sein, dass man in den 80ern Show, don’t Tell“ noch nicht so beherzigt hat?“
Zeigendes Erzählen
Folgendes soll der erste wichtige Merksatz dieses Textes sein: Es gibt zeigendes Erzählen. Der kluge Gedanke hinter „Show, don’t tell“, und die Situationen, aus denen er erwachsen sein mag, und in denen es Sinn macht, daran beim Schreibenlernen zu erinnern, ist gerade der, dass man weg will von allzu trockenen und gleichzeitig wenig gegenständlichen Statements über eine fiktive Welt. „Er war ein schöner Mann.“ „Sie zeigte sich immer sehr klug in Gesprächen“ „Der Korridor sah gruselig aus“ – besonders, wenn es nicht weiter qualifiziert wird. Der klassischste aller „Show, don’t tell“-Ratschläge wäre nun, zB den Mann mit Figuren interagieren zu lassen, die auf seine Schönheit reagieren, statt es einfach so als Statement runterzuschreiben. Wenn man es geschickt macht, muss man vielleicht überhaupt nichts mehr über das Aussehen der Figur sagen, alles, was wir wissen müssen, erfahren wir aus Interaktionen. Aber das ist natürlich nicht der einzige Weg. Je nach Textsorte könnte ich stattdessen bei meiner Beschreibung auch stark ins Detail gehen. „Mit kristallenen Augen, in denen sich der Himmel spiegelte, sah er mich an. Sein matt-rötliches Haar wehte im sanften nächtlichen Sommerwind wie die Krone eines japanischen Ahorns, und das Licht des Mondes spiegelte sich darauf…“, und so weiter und so fort. Es geht um Bilder, es geht um ein Gefangen-werden durch den Text. Es geht beim literarischen Schreiben immer um mehr als reine Informationsvermittlung. Und die Wege dahin sind je nach Textsorte sehr unterschiedlich. Garcia Marquez zeigt im Sinne des „Show, don’t Tell“ Verständnis heutiger durchschnittlicher Unterhaltungsromans fast gar nichts. Sein Tonfall ist eher der eines weitschweifigen Märchenerzählers; aber es gibt kaum bildhaftere Romane als „Hundert Jahre Einsamkeit“. Und will irgendwer behaupten, dass Passagen wie diese von Grazia Deledda nicht „zeigen“?
“Die Straße führte bis zum Dorf ständig bergauf, und er wanderte langsam auf ihr dahin, weil er im vorigen Jahr das Sumpffieber gehabt und eine große Schwäche in den Beinen zurückbehalten hatte. Hin und wieder blieb er stehen und blickte auf das Gut zurück, das leuchtendgrün zwischen den beiden Feigenhecken ruhte; und die Hütte dort oben, die schwarz zwischen dem Blaugrün des Schilfrohrs und dem Weiß des Felsgesteins nistete, erschien ihm wie ein Nest – ein wirkliches Vogelnest. Jedesmal, wenn er fortging, betrachtete er sie so, halb zärtlich und halb traurig, ganz wie ein Vogel, der in die Ferne zieht (…)
Klein und schwarz schreitet Efix in die strahlende Helle hinein. Die schrägen Sonnenstrahlen fluten leuchtend über das Land; jede Binse trägt ein Silbergespinst, aus jedem Wolfsmilchgebüsch steigt ein Vogelruf; und dort winkt auch schon der grün und weiß gescheckte, von Schatten und Sonnenstreifen durchfurchte Kegel des Galteberges, und an seinem Fuße ruht das kleine Dorf, das nur aus Schutt und Trümmern zu bestehen scheint: aus den Resten der alten Römerstadt (…).”
Virginia Woolf gilt zurecht als eine Meisterin des filmischen Erzählens, obwohl man vielleicht durchaus richtiger sagen müsste, dass der Film sich mit seinen Techniken an von Woolf und anderen geprägten modernen Romanen orientiert hat (ich denke, das ließe sich durchaus belegen, denn das als Meilenstein des modernen Films geltende „Citizen Kane“ hat definitiv seine größte Stärke darin, unchronologisches Erzählen, Schnitt- und Blendverfahren, die der Roman längst kannte, mit Jahrzehnten Verspätung auf die Leinwand zu bringen). Und doch würde jemand, der ein enges Verständnis von „Show, don’t tell“ hat, wahrscheinlich Woolf heute vorwerfen, die ganze Zeit nur zu erzählen, und eben nicht zu zeigen. Dabei ist Woolfs ganzes Erzählen „Zeigen“, wie eingangs gesagt: Es gibt zeigendes Erzählen. Das enge Verständnis von „Show, don’t tell“ ist ein sehr stark am Film geschultes, oder zumindest eines, das sich für sehr stark am modernen Film geschult hält. Nach einem weiteren Exkurs werde ich mich noch der Frage widmen, ob der moderne Film sich eigentlich tatsächlich an „Show, don’t tell“ im engen Sinne hält.
Zeigender Dialog
Zuerst aber Merksatz 2: Es gibt auch zeigende Dialoge. Nun wird die „Show, don’t tell“-Crowd des engeren Verständnisses wegen erklären: Ja, das sagen wir doch die ganze Zeit. Dialog, Dialog, Dialog. Aber nein, was ihr meist meint, sind diese immer gleich klingenden „Tough Guy“- und häufiger nun auch „Tough Girl“-Dialoge, in denen die Worte wie Ping Pong-Bälle hin und her fliegen, kaum mal eine Figur über mehr als eine, im äußersten Fall zwei Zeilen spricht. Dialoge, wie man sie ursprünglich vielleicht aus verschiedenen Varianten des Krimis Noir kannte, wie sie Tarantino groß gemacht hat, und wie sie nun, schon als Verfallsprodukt mit „Snarkyness“ und Ironie gewürzt durch jene Parade lebender Toter geistern, als die das Marvel Cinematic Universe und all seine Nachahmer und Konkurrenten in den Filmpalästen herumspuken. „So muss das sein“, sagen die engstirnigen „Show, don’t tell“-Befolger, denn dass einer wie bei Dostojewski oder Thomas Mann über zwei Seiten schwätzt, bis der andere eine ebenso geschliffene Gegenrede produziert, das sei unrealistisch. „Realistisch“ dagegen ist, wenn jeder redet wie in einem Tarantino-Film, wenn „ähm“ nur als stilistisches Mittel hier und da einmal fällt und niemand jemals einen Monolog hält, zu dem andere nur nicken. Nein, beides, wie überhaupt alle literarischen Dialoge, sind natürlich eine gewollte Stilisierung, die man gut machen kann, die in ein Szenario passen kann, oder eben nicht. Wahrhaft realistische Dialoge hat es in der Literatur wahrscheinlich noch nie gegeben. Hört euren Mitmenschen mal wirklich zu. Das Gestammel wäre absolut unlesbar. Gesucht wird eine gelungene Stilisierung für das jeweilige Szenario, für die jeweilige Stimmung, die vermittelt werden soll, die zu den Figuren passt und so weiter.
Und gibt es denn zeigendere Dialoge als die Mannscher und Dostojewskischer Prägung? Wo jede Figur ihre eigene Stimme hat, wo sich die Ideen durch die Rede ausdrücken, wo Figuren so gewaltig erstehen, dass wir Gesicht und Körperbau von Settembrini, von Naphta, von Aljoscha, von Dimitri niemals vergessen werden? Und das nicht, weil die Autoren sie so detailliert beschrieben hätten, sondern weil sie durch ihr Auftreten und dabei besonders ihr Sprechen wachsen. Das kann durchaus gegen die ursprüngliche Beschreibung geschehen. Oder hättet ihr euch recht erinnert, dass Naphta ein eher schwächlicher kleiner Typ ist, hinfällig, gebrechlich? Seht ihr nicht, wie ich, angesichts der Reden, die der schwingt, eher eine Figur vor euch, die an Tuskernini aus Darkwing Duck erinnert? Und wird Naphta nicht gleich noch plastischer, wenn das beschriebene Bild und die Gewalt seiner Rede nebeneinander stehen? Gott, wie wenig sagen mir dagegen die 08-15 Dialoge der engstirnigsten „Show, don’t tell“-Romane über Figuren. Wie bildlos sind viele dieser neueren Unterhaltungskrimis und -Thriller, die ganz eng am Film geschult sein wollen. Und von denen kurz nach dem Zuschlagen des Buches doch wieder nur Leere bleibt. Aber, was wäre ein Film ohne Bilder?
Sind Filme „Show, don’t tell“?
Ich denke, das radikale „Show, don’t tell“ hält sich zugute, dass es vom filmischen Erzählen herkommt und dass man in der heutigen Zeit nur noch filmisch erzählen könne. Die Passagen zu Virginia Woolf oben sollten das zumindest schon in Frage gestellt haben. Dabei stimmt es durchaus, dass man vom Film als Schreibender viel lernen kann. Ich habe mich für meine Schreibkurse an der Volkshochschule in den vergangenen Jahren viel mit Drehbuchschreiben beschäftigt, weil SchülerInnen eben auch immer wieder wissen wollen, wie das mit dem ganz klassischen Spannungsaufbau in der Unterhaltungskunst geht, wie man diese Geschichten erzählt, die vielleicht in erster Linie totale Page-Turner sind. Das ist oftmals schwerer zu unterrichten als Metapher, Leitmotiv, als überhaupt das so notwendige Befreien von der Angst vor der Poesie, die die moderne Welt den Schreibenden aufdrängt. Es gibt kaum einen besseren Werktypus als das Drehbuch, um sich für grundlegende Techniken dahingehend zu orientieren. Ich habe in den vergangenen Corona-Jahren über 1000 Filme geschaut und parallel dazu zahlreiche Drehbücher gelesen und beides für sich und in Bezug aufeinander analysiert. Ich kann also mit relativ großer Sicherheit sagen, dass ich zumindest besser als die meisten, die online filmisches Erzählen wie ein Dogma hochhalten, über tatsächliches filmisches Erzählen Bescheid weiß. Denn fast alles, was in Online-Schreibgruppen über den Inhalt von Drehbüchern steht, ist nachweislich falsch. Und ich denke, es ist gar nicht so verrückt, wie man im ersten Moment meinen könnte, zu fragen: Praktizieren Filme denn tatsächlich radikales „Show, don’t tell“ im Sinne der hier kritisierten engen Variante?
Im ersten Moment wird man meinen: Natürlich. Der Film hat ja nur die Bilder, die Figuren, die auch als Bilder zu uns kommen, die Dialoge. Die einzigen Momente, in denen der Film klassisch erzählen könnte, wären Voice-Over, und in den meisten Fällen (nicht in allen) verweist exzessives Voice-Over tatsächlich auf erzählerische Schwächen des Films. Aber Moment, wir sagen das so selbstverständlich: Erzählerische Schwächen. Warum sagen wir nicht zeigerische Schwächen? Nun, wenn ich vom Film mit Bezug zur Literatur oder vom Film als Literatur reden möchte, wenn ich also aus dem Film Hilfen für das literarische Schreiben ziehen oder sogar einfach selbst einen Film schreiben möchte, dann kann ich mir natürlich nicht nur das fertige Produkt anschauen. Klar, Filme wie z.B. „Blade Runner“, „The Yellow Handkerchief“ oder „Passengers“ haben tolle Bilder. Aber was meint ihr, wie diese Bilder im Drehbuch aussehen? Hier ist z.B. die erste Szene aus dem für starke (visuelle) Bilder bekannten „Passengers“:
„A million suns shine in the dark. A starship cuts through the night: a gleaming white cruiser. Galleries of windows. Flying decks and observation domes. On the hull: EXCELSIOR – A HomeStead Company Starship. The ship flashes through a nebula. Space-dust sparkles as it whips over the hull, betraying the ship’s dizzying speed. The nebula boils in the ship’s wake. The Excelsior rockets on, spotless and beautiful as a daydream.“
Das ist nun durchaus schön geschrieben, aber es ist doch ganz klassische Erzählkunst. So ähnlich hätte Thomas Mann, ein Feindbild der radikalen „Show, don’t tell“-Crowd, es auch machen können. Und klar! Wie sollen Bilder, zurück in Text übersetzt, denn sonst aussehen? Meint ihr, all die schönen Bilder, die in den Filmen zu sehen sind, werden im Drehbuch rein passiv durch Reaktionen der Figuren oder so dargestellt, und dann müssen RegisseurInnen und Kamerateam sich das irgendwie zusammenimaginieren? Nein, ein gutes Drehbuch hat viel Tempo, tatsächlich oft (aber wieder nicht notwendig und immer) diese kurzen Ping-Pong-Dialoge und immer wieder beschreibende Passagen, die die Szene abstecken, die eine Stimmung skizzieren, die Handlungen wiedergeben, Figuren beschreiben (!) und die durchaus auch das Innenleben (!!!) der Protagonisten nach außen kehren. Und das wiederum regelmäßig in den besseren Drehbüchern gar nicht so nüchtern, wie man es meinen mag, wenn man seine Weisheiten zum filmischen Erzählen nur aus dritter Hand von schlechten Hemingway-Epigonen gelernt hat. Nicht wie die Regieanweisungen im Theater, sondern bildreich, poetisch, oft wunderschön. Ja, einige Drehbücher, die ich gelesen habe, etwa das zu „Girl on the Train“, das zu „Hugo Capret“, waren mit die stärksten literarischen Texte, die ich in den vergangenen Jahren zu sehen bekam. Anders als der eher mittelmäßige Film ist das Drehbuch zu „Hugo Capret“ ein einziges Poem in Prosa, ein wunderschöner, bildlicher, rasanter Großstadttext, durch den man nur so fliegt (die größte Schwäche des Films ist dann auch, aus seinem knapp 90 Minuten Drehbuch einen deutlich über zwei Stunden dauernden Film gemacht zu haben):
„Hugo turns away from the dial and moves through the tunnels behind the clock. A serpentine maze of passageways. Behind the walls. Hugo’s secret world. He moves quickly up and down spiral staircases … ducking through tiny openings … swerving in and out of dark passages … up and down, back and forth… Like an elaborate game of Chutes and Ladders.
He finally stops. Peers through another clock dial into a different part of the station.
He sees…
A TOY BOOTH.
Bedraggled and struggling. A counter filled with windup toys, dolls and little games.
GEORGES, a grim old man with a white goatee, sits at the counter of the booth. “
Und wie auch nicht! Das deutsche „Dichten“ sagt es tatsächlich sehr bildhaft: Es gibt kaum einen stärkeren Weg, einen Text dicht zu verfassen, als ihn zu dichten. Das Drehbuch hat ein Ziel: Die Lesenden, meist irgendwelche gestressten Angestellten von Agenturen und Filmstudios, sollen von der ersten Seite so gepackt werden, dass sie den Text nicht gleich wieder weglegen, sondern bis zur letzten Seite mit dem gleichen Enthusiasmus dranbleiben. Denkt ihr wirklich, das sei mit nüchternen Regieanweisungen, wie man sie eher in Theaterstücken findet, zu leisten? Ein gutes Drehbuch, das ist Tempo, das ist Rhythmus, das ist vielmehr Poesie, als man es von wahrscheinlich 99% selbst der als sprachlich extravagant geltenden Prosatexte heute sagen kann.
Und „show don’t tell“ ist eine Hilfestellung, um schwache Texte zu verbessern oder überhaupt mal eine Idee davon zu bekommen, wie das mit dem literarischen Schreiben funktionieren kann. Es ist keine heilige Regel, und es gibt so viel „Zeigendes“, das nicht Dialog oder kurzer Satz ist. Das engstirnige Beharren auf „Show, don’t tell“ ist genauso unangebracht wie das Ressentiment gegen die Hilfestellung.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.




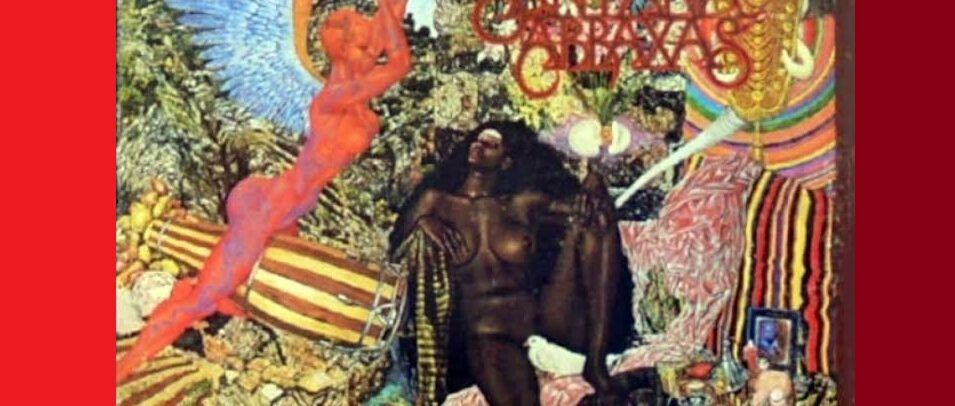
Anna Maria
Vielen Dank für diese prägnante Analyse und vor allem für die literarische Einordnung. Nachdem mich eine Buchkritik wegen ihres Show-don‘t-tell-Mantras wieder einmal genervt hat, bin ich froh, auf diese Kolumne gestoßen zu sein, die mir aus der Seele spricht