Es ist sinnvoll, ehe man eine Buchkritik schreibt, sich erst einmal klarzumachen, was das Buch eigentlich will. Das Buch, nicht der Autor. Was der gewollt haben mag interessiert uns wenig. Was für ein Buch ist es? Woraufhin ist es angelegt? Einen Text sollte man, zumindest im ersten Schritt, an dem in ihm selbst deutlich werdenden Ansprüchen messen. Herunter gebrochen: „Der mit dem Wolf tanzt“ kann man Stereotype und Indianerkitsch auf auch immanent textkritischer Ebene vorwerfen, dem in allem hoffnungslos überzeichneten Lucky Luke wohl eher nicht.
Was ist das für ein Buch?
Was für ein Buch ist Joy Chants heute wohl weit gehend vergessenes und im deutschen Sprachraum selten sonderlich wahrgenommenes Der Mond der brennenden Bäume („The Grey Mane of Morning“)?
Ein Jugendbuch, denke ich (besser vielleicht passt der englische Begriff „young adult fiction“). Das legt schon die dauernde Andeutung aber kaum explizite Ausgestaltung von Sexualität, ebenso wie die nie als Selbstzweck auftretende und überhaupt moderate Gewalt nahe, ferner der übersichtliche Aufbau der Erzählung und die Klarheit zahlreicher Kontraste. Ein beinahe prototypisches Buch über kulturelle Zusammenstöße, über das Verhältnis von Kolonisatoren und Kolonisierten, insbesondere auch zwischen sesshaften und nomadischen Zivilisationen. Ein Buch das dabei in den letzten 500 Jahren akkumulierte Stereotype mustergültig, vielleicht schon zu mustergültig, zu unterlaufen versucht. Zuletzt auch ein Entwicklungsroman, der mehrere Charaktere dabei begleitet wie sie ihre Rolle in der Welt zu finden suchen.
Der Mond der brennenden Bäume erzählt die Geschichte des nomadischen Stammes der Alnei, Teil des größeren losen Verbundes der Khentorei, der im Sommer den Wilden Pferden folgt und Winters wie viele andere Stämme nach der Stätte der „Goldenen“ kampiert. Die Wilden Pferde, Davlenei genannt, erinnern dabei äußerlich stark an Einhörner, haben aber sonst zum Glück mehr mit gewöhnlichen Wildpferden gemein als mit dem mythisch überhöhten Christussymbol, das das Cover von Der Mond der brennenden Bäume ziert. Im Fokus des Buches stehen Mor’anh, Sohn des Anführers der Alnei und dessen Freund Hran, sowie Mor’anhs Schwester und Auserkorene Nai sowie zeitweise einige Protagonisten der (gar nicht so) Goldenen. Den Goldenen sind alle Khentorei tributpflichtig, und im Zuge einer solchen Tributzahlung wird Nai, nicht ganz in Übereinkunft mit den bestehenden Regeln aber auch nicht in eklatantem Bruch dieser, in die Stadt Malé entführt.
Behutsam entwickelter Plot
Was für manch anderen Autor der dichte Plot einer spannungsgeladenen Abenteuergeschichte wäre, wird von Chant sehr vorsichtig, manch einer würde sagen, träge, entwickelt. Ausgiebig beleuchtet werden im ersten Teil die Gewohnheiten der Khentorei, das Zusammenspiel patriarchaler Führungsstrukturen und matri-linearer Erbschaft etwa, was zum Beispiel dazu führt, dass Frauen nicht nur recht aktiv in der Partnerwahl agieren, sondern dass diese auch Kinder aus zuvor bestehender Schwangerschaft niemals ablehnen würden: Die Frau schenkt das Kind.
Geschichtliche Hintergründe werden derweil nur ganz rudimentär im Sinne einer „Orature“ ausgebreitet, weshalb der Leser unter anderem niemals erfährt, wie es überhaupt zur Abhängigkeit der Khentorei von den Goldenen kommen konnte, wo diese im Gegensatz zum historischen Kolonialismus auf dem amerikanischen Kontinent doch weder über militärische noch über strategische Überlegenheit zu verfügen, noch je verfügt zu haben scheinen.
Für die stimmige Gestaltung der Khentorei selbst ist die mündliche Überlieferung ein geschickter Kunstgriff, für die stimmige Gestaltung von Welt und Narrativ eher nicht. Schwer einsichtig beispielsweise, warum es nicht schon viel früher zum Aufstand gekommen sein soll, der gegen Ende von Der Mond der brennenden Bäume die Goldenen mit Leichtigkeit hinwegfegt.
Klischees vermeiden, in Klischees stolpern
Überhaupt tut sich der Roman bei aller guten Absicht schwer damit, eine glaubwürdige (proto-) koloniale Situation zu simulieren. Das liegt vor allem daran, dass Chant einerseits bemüht ist von allen historischen Vorbildern ausreichend Abstand zu wahren und nicht in den Strudel aus aufrechterhaltenen und gebrochenen Stereotypen zu geraten, die solche Erzählungen oft in sich aufsaugen. Andererseits kann Chant sich aus guten Gründen, nämlich um nicht in Belanglosigkeit zu verfallen, von diesen Vorbildern auch nicht zu weit entfernen.
So wird in Der Mond der brennenden Bäume dann das kluge Charaktergeflecht, bei dem, was positive hervorzuheben ist, weniger klare Fronten als ganz unterschiedliche Menschen die auf Basis ihrer jeweiligen Vorstellungen von der Welt handeln im Mittelpunkt stehen, harsch kontrastiert von naturromantisch-kitschigen Passagen wie der Folgenden:
„He was a horseman. Dismounted, distance and even direction and confused him … It was the mastery of horses that had made his people free of the Plain. The Davlenei made and their lives possible, and lackim them they lacked all“ (120)
Und die gesamte Stammesstruktur bis hin zum halberblichen Häuptlingstum erinnert schon sehr stark an Vorstellungen, wie sie sich der eher schlecht informierte Europäer gemeinhin von „Indianern“ macht.
Auch die subtil entwickelten und dabei seltenst bewerteten Unterschied zwischen Alnei und Goldenen sowie den später hinzutretenden Bewohnern der südlichen Städte werden von Zeit zu Zeit ohne Not in geradezu holzschnittartigen Dialogen wie diesem unnötig konkretisiert:
„Lord Moran, say no more! And Jemaluth takes pride in being the city government by the loss of virtue! We are shamed.‘ … ‚I do not speak to shame you. Your city has made the world wider for me. The tribe too can be merciless. There is a girl in my tribe … She is almost an outcast in our midst, because she is afraid to live the life of a woman. There is no place for hor. Yet is it her fault?“
Allerdings: Liest man Der Mond der brennenden Bäume als Jugendbuch, mag das seine Berechtigung haben. Obwohl ich mir nicht sicher bin ob man für junge Leser wirklich die wichtigsten Lehren eines Romanes noch einmal explizit aus buchstabieren muss. Man neigt, auch und gerade als Autor, wohl gern dazu junge Menschen zu unterschätzen.
Große Herausforderungen warten noch
Abseits dieser Kritikpunkte ist Der Mond der brennenden Bäume eine durchaus begeisternde Leseerfahrung, für jugendliche Leser wie für Leser, die sich einfach ein wenig abseits ausgetretene Fantastik-Pfade bewegen wollen, gleichermaßen. Sehr viel geschickter etwa als bei Martin oder Sapkowski, die im Großen und Ganzen klassische Tropen auflisten und mit viel Tamtam und beinahe wie in Erwartung eines Schulterklopfers brechen, unterläuft Chant mehrfach liebgewonnene Erwartungshaltungen. Läuft etwa auf den ersten 20 bis 30 Seiten des Buches alles auf einen großen Kampf zwischen Alnei und Goldenen hinaus, will dieser dann einfach nicht kommen und stattdessen präsentieren sich die Gesellschaften beider Zivilisationen als innerlich konfliktgeladen, wobei jede Nachteile und Vorzüge offenbart. Und gegen Mitte des Romanes taucht mit den Städten eine dritte Partei in der Erzählung auf, gegen die sich in den meisten derartigen Geschichten die ursprünglichen Gegner verbunden würden. Stattdessen kommt es zu einem Handelsabkommen zwischen Alnei und den Städten, das zahlreiche friedliche Kontakte zu knüpfen verspricht – ausgerechnet im Angesicht des kurzfristigen Zweckes, zum Kampf gegen die Goldenen aufzurüsten. Und mehr: Das Bündnis scheint geeignet die Khentor für immer ihren bisherigen Lebensstil zu entreißen und als neue Macht in der unermesslich großen Welt zu etablieren, von der wir mit Mor’anhs Augen nur einen winzigen Ausschnitt gesehen haben (der uns trotzdem gewaltig erscheint: Diesen perspektivischen Trick führt Chant genial aus). Und der Endkampf, der auch Nai zu Hran zurückführt? Der ist nicht mehr als ein kurzes einseitiges Gemetzel: Die wahren Herausforderungen, so Der Mond der brennenden Bäume, warten, nachdem der Leser die Buchdeckel schließt.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


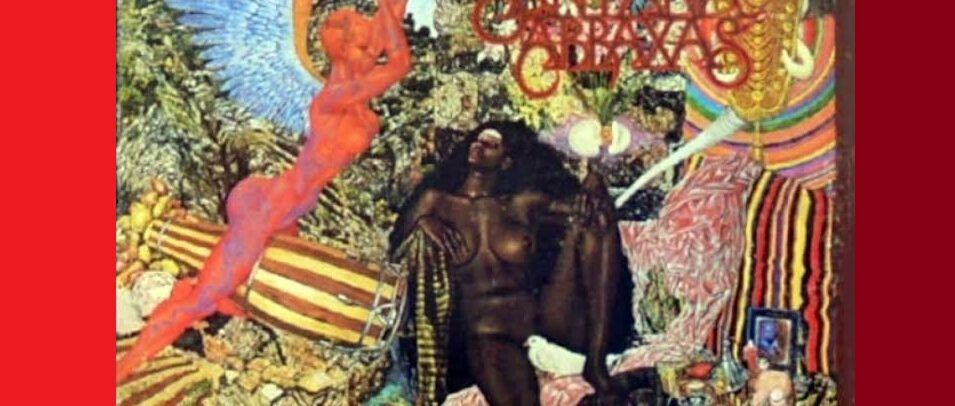

Ihr Kommentar