Ein „Totalitarismuskritiker“?
Die erste Einordnung, die ich nach dem Tode von Imre Kertész zu hören bekam erfolgte im Kulturprogramm des SWR 2. Hier wurden die dauernden Angriffe, denen der Autor vor allem in Ungarn ausgesetzt war mit dem universellen Anspruch des Werkes begründet: Kertész habe nämlich nicht „nur“ über den Holocaust geschrieben, sondern seine Romane zielten auf die Struktur des Totalitarismus als Ganzes. Das ist, so sehr Kertész selbst in späten Interviews einer solchen Interpretation Nahrung gab, eine merkwürdige Akzentuierung. Wäre Kertész Schaffen tatsächlich auf eine solch abstrakte Allgemeinheit zu reduzieren, es wäre nichts Besonderes. Aus persönlichen wie geschichtsphilosophischen Gründen hat Kertész Werk allerdings natürlich einen ganz expliziten historischen Ort: Den der Shoa. Es kennt das besondere der Vernichtung um der Vernichtung Willen genau. In die Tiefe dieses Besonderen zu dringen macht Texte wie Roman eines Schicksallosen aus und verleiht ihnen allgemeine Bedeutung, nicht relativierender „Antitotalitarismus“ und ganz viel Freiheitspathos. Entsprechend wurde Kertész dann eben auch nicht dafür angefeindet, dass er totalitäre Staatssysteme in aller Welt kritisiert hätte, sondern weil seine Literatur den Finger auf die Verdrängung der Shoah im Osten und natürlich auch auf die frühe und enthusiastische Beteiligung der ungarischen Rechten am Vernichtungsprojekt legte.
Das linke Unbehagen
Dennoch war Kertész auch unter Linken nicht gut gelitten. Dass er so nüchtern und kalt über Buchenwald schrieb wie man über einen Tag am Strand schreiben könnte, verzieh man ihm nicht. Sowas kann doch, gerade vor dem Hintergrund des oft widergekäuten sogenannten „Diktum“ Adornos, es sei „barbarisch nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben“ erst recht nicht angehen. In ihrer adornitischen Blindheit ist die Linke da allerdings nicht allein. Dass man dem ewigen Pessimisten und Antideutschen Adorno, diesem Miesmacher erster Güteklasse, der den wieder gut Gewordenen nicht mal ihre herrlich tiefsinnige Lyrik gönnen möchte (die man ja auch gering schätzt, aber aus dem viel besseren Grund, dass sich damit kein Geld verdienen lässt), bei jeder Gelegenheit den Celan und eben auch den Kertész entgegenschleudert, das hat schon eine gewisse Tradition. Als habe Adorno diesen Spruch einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt, als sei er nicht der so resignative, wie trotzdem zu überwindende Kulminationspunkt einer Schreiberfahrung vor dem Hintergrund des Bankrotts des liberalen wie linken Humanismus, die sich auf die kritische Philosophie ebenso erstreckt wie auf Lyrik und Prosa: „Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward“, schreibt Adorno in der Negativen Dialektik. Und vor allem: Als hätten nicht Celan und Kertész ebenso mit Adorno diese Erfahrungen in all ihrer Brutalität geteilt. Weshalb dann auch Celan nicht nur sein an Rilke orientiertes frühes Schaffen sondern selbst noch die Todesfuge durch die Komposition der ungleich spröderen Engführung de facto verwarf, weshalb Kertész davon sprach, man müsse eine neue, „atonale“ Sprache finden – der Bezug auf die Frühformen der Neuen Musik ist darin kein Zufall, wie sogar die Wikipedia weiß, Adornos Philosophie der neuen Musik wird als explizites Vorbild genannt – und weshalb auch Adorno ja sein „Gedicht“ allen „Dikten“ zum Trotz verfasste: Als wichtiger Mitarbeiter an Thomas Manns Doktor Faustus nämlich einen der ganz großen Romane der deutschen Nachkriegsliteratur und vielleicht der einzige, der nicht auf Verdrängung und Wieder-Gutwertung aus ist.1
„Atonale Sprache“ und Kafka
In wieweit Kertész nun jene „atonale“ Sprache gefunden hat und inwieweit sie dem Angestrebten literarisch gerecht wird, mag ich mich hier nicht aufschwingen zu beurteilen. In einem Essay von 2013 hat Magnus Klaue einige zentrale Merkmale der literarischen Form des Kertészschen Werks herausgearbeitet und hierbei besonders eine enge Verwandtschaft zu Kafka betont, die mir bei der Erstlektüre vor etwa 10 Jahren zugegebenermaßen vollständig entgangen sein muss (und ich gebe gern zu, kein Kertesz-Experte zu sein, sondern mir in der letzten Woche vieles neu angelesen zu haben). Darauf gestoßen springt sie allerdings bei der Relektüre – nicht mal in erster Line des Schicksallosen, besonders auch späterer Texte – geradezu gewaltsam ins Auge.
Tatsächlich ist es ein Buch über die antizipatorische Phantasie der literarischen Moderne. Bis in idiomatische Nuancen hinein adaptiert es den reflektiert naiven Duktus der Prosa Kafkas, die es aufs Neue an einem Gegenstand entstehen lässt, der nicht der Kafkas und doch, wie man erst beim Lesen von Kertész merkt, schon seiner gewesen ist. Um eine Autobiographie zu sein, ist das Buch zu artifiziell, um als Fiktion durchzugehen, zu autobiographisch; das musste eine Leserschaft verstören, für die »Opferliteratur« entweder eine Lebensbeichte oder pädagogische Prosa zu sein hatte.
Sehr deutlich an Kafkas Process etwa klingen die ersten Seiten von Kertész Der Spurensucher an. Das Gespräch eines nach Deutschland zurückkehrenden Holocaust Überlebenden, mit einem deutschen „Hermann“ (dessen „schwieriger“ Familienname ebenso im Dunkeln bleibt wie jener von Josef K), entwickelt sich dort aus Hermanns Perspektive rasch zu einer Verhörsituation, in der dieser glaubt sich rechtfertigen, verteidigen gar zu müssen für Anklagen, die doch nie ausgesprochen wurden (und schon Kafkas Prozess zielte ja auf diese Art intersubjektiver Fremd- und Selbstbeurteilung, nicht einfach auf den „totalitären“ Staat gegen den sich das „Opfer“ als eindeutig „gut“ positioniert und dem man sich ausgeliefert sieht).
Der Spurensucher
Überhaupt, Der Spurensucher. Das ist ein kleines Büchlein, das man leicht zur Hand nimmt und um so beschwerter wieder fort legt. Ein unbekannter Überlebender, manch einer liest den Protagonisten von Roman eines Schicksallosen heraus, kehrt darin nach Buchenwald und ins nahe Städtchen Z. zurück, um irgendetwas zu finden. Doch die Dinge „sprechen“ nicht zu ihm. Und die Welt ist feindlich, gerade weil sie so freundlich ist. Kafka ist hier vielleicht deutlicher anwesend als im Roman eines Schicksallosen, ein doppelter Process läuft ab. Als Abgesandter einer anonymen richtenden Instanz (klingt im Abgesandten das prophetische „Gesandter“ an?) scheint der Unbekannte Hermann entgegen zu treten, einem schwachen Abglanz von K, der mehrfach bemüht ist „seine Verteidigung“ vorzutragen, obwohl er nicht „darum gebeten“ wurde. Doch auch der Gesandte sieht sich Anklagen ausgesetzt, sein Gleiten von einer Position relativer Stärke am Anfang zu jener der fast fühllosen Resignation gegen Ende erinnert ein wenig an den Landvermesser des Schloss‘. „’Ob ich friere?‘ … Aber die Frage war ihm eine Warnung: Er musste besser aufpassen, jede Regung von ihm wurde registriert“ (S.32f) merkt der Abgesandte schon früh gegenüber seiner Frau auf, und später:
Der Fremde ließ das Blatt aus der Hand sinken; verstohlen blickt er auf dem ganzen Bahnsteig umher – dann besann er sich bestürzt: wie?! Er suchte doch nicht vielleicht nach seinen Anklägern…? (S.124)
Dem vorangegangen sind die ernüchternden Erfahrungen mit der touristisch inszenierten Vergangenheitsbewältigung in Buchenwald, und einer fröhlich besser-menschlichen Attitüde, der man auch in den 90ern schon die Worte in den Mund legen möchte die Ebehard Jäckel zum 5. Jahrestag des Holocaust-Mahnmals in Berlin sprach: „Es gibt Länder in Europa, die uns um dieses Denkmal beneiden.“ Gerade die Belanglosigkeit all dessen, was sich dem Spurensucher enthüllt, die Erfahrung, dass es überhaupt keine Spuren gibt die ihn betreffen, sind es, die nicht nur den Ort seiner Gefangenschaft, Zwangsarbeit und geplanten Vernichtung ihm verdächtig machen, sondern auch ihn ängstigen, sich wieder verdächtig zu machen:
Tatsächlich: was wollte er eigentlich? Er war still, drei Augenpaare musterten sich schweigend. Er sah sich um: Der Hof war leer, außer diesen beiden Männern war niemand anwesend; er konnte sich ihnen noch verdächtig machen. Wer weiß, was hier noch alles mit ihm passieren konnte: Sie konnten ihn hinauswerfen, oder sie konnten ihn hier behalten, ihn anbinden, zwischen den Kühen während sie die Polizei riefen. Ihn anbinden und ihn dann vergessen, er bleibt hier, seine Beine wachsen in den morastigen Boden, er schlägt Wurzeln, dringt tiefer ein, immer tiefer, bis er tief in der Erde auf Skelette trifft, die er brüderlich umschlingt; bis sich die Ruhe der Fossilien über sein Antlitz breitet und seine zu Mineralien erstarrten Wirbel ihn hier verewigen, gegenüber diesen wie gestaltlose Leichen wirkenden ewigen Schollen und dem am Rande des Horizontes wie die bewegungslose und auch ewig unerreichbare Hoffnung erahnbaren blauen Gebirgszug. (120)
So weit, was ich Kertész und seinen Nachrufern fragmentarisches nach zu rufen habe. Vieles ließe sich bestimmt hinzufügen, einiges korrigieren. Geschehen wird das größtenteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn es wird ja so viel Neues zu berichten sein, und der ein oder andere aktuellere Nachruf wird auch bald schon wieder verfasst werden wollen…
1 Wer übrigens mal einen Pessimisten mit einem Optimisten diskutieren sehen möchte der lese Thomas Manns Briefwechsel mit Adorno bezüglich dieses Romans. Manch einen wird es verwundern, wer da in welcher Rolle auftritt.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


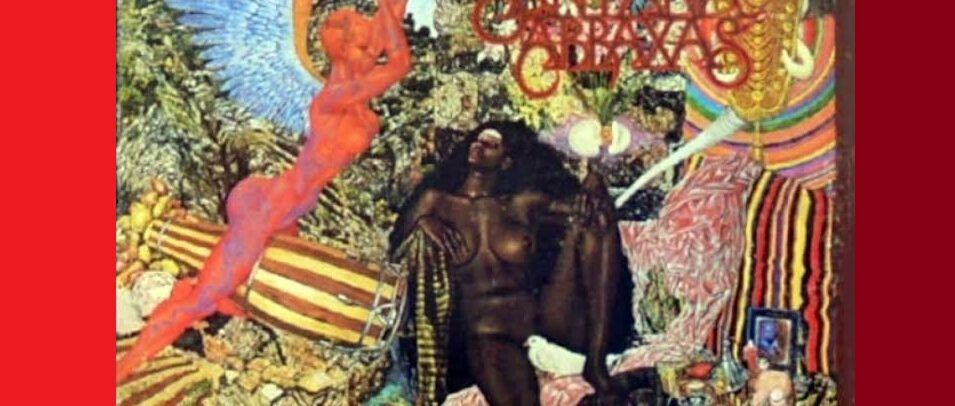

Ihr Kommentar