Felix Phillip Ingold ist ein verdienter Kritiker. Als einer der wenigen Fachwissenschaftler etwa machte er sich die Trennung in den über jeden Zweifel erhabenen Autoren Dostojewski und den tagespolitischen und tagebuchschreiben Antisemiten nicht zueigen und trug so zu einem unverklärten Blick auf den vielleicht bedeutendsten russischen Schriftstellers bei. Als Dichter hat Ingold ein durchaus lesenswertes, umfangreiches Werk vorgelegt. Und Ingold ist auch einer jener Literaturwissenschaftler, die die Niederungen der Kritik nicht scheuen, die nicht stur beackern, was ihnen der Zeitgeist an Schriftstücken vorwirft. In populär geschriebenen Zeitungsartikeln versucht er, mit zu definieren, welche Literatur eigentlich der Beschäftigung würdig sei.
Vor allem Strohmänner (und Frauen)
Doch in seinem gewaltigen Rundumschlag gegen Verfall von Alltags- und Literatursprache liegt Ingold falsch. Seine Beispiele verhunzter Kommunikation sind heftig aufgebauschte Strohmänner, die man abseits quasi mündlicher Formate wie Messengern kaum im Schriftdeutschen auffinden wird. Und die Idee, solcherart falsche Alltagsgrammatik sei nicht wie stets durch die Jahrhunderte hindurch Ausweis informeller Lockerheit, was heute nun mal erstmals in größerem Maße aufgezeichnet wird, sondern Ausweis falschen Denkens, müsste streng genommen alle Sprachen treffen, die nicht das Verhältnis der Sprachelemente zueinander und zum Repräsentierten in gleicher Form regelten wie das Deutsche. Ganz schön überheblich, vielleicht aber einfach nicht zu Ende gedacht.
Bedeutend aber ist Ingold als Literaturwisschenaftler, und als solcher moniert er,
„dass die Literatursprache zunehmend der Alltagssprache angenähert wird oder dass, umgekehrt, die Alltagssprache als Literatursprache praktiziert wird.“
Das gelte
„nun nicht mehr bloss für Rollenprosa (wie sie in direkter und historisierender Rede seit je eingesetzt wird), sondern auch – oftmals kaum noch davon zu unterscheiden – für den Stil heutigen Erzählens insgesamt.“
Sind dem Kritiker die Autoren Joyce, Faulkner oder Llosa ein Begriff? Hat Ingold die gesamte literarische Moderne verschlafen? Tatsächlich ist, was im NZZ-Artikel als junges Verfallssymptom abgewatscht wird, eine der zentralen Entwicklungen, die Literatur auf Höhe der Zeit seit der vorletzten Jahrhundertwende ausmachen. Und dabei gerade jene Sprachwerke, die wohl auch Ingold kaum einer allgemeinen literarischen Entkunstung zuschlagen dürfte. Sondern Werke, die in zuvor nie da gewesenem Selbstbewusstsein von der Komposition bis in die stilistischen Details hinein in ihrer sprachlichen Realisierung geplant werden, wobei, der Erfahrung gemäß, dass dem klassischen Erzählen a la Dickens oder Dostojewski eine gefährliche Tendenz innewohnt, die Wohlgeordnetheit der Welt erst zu konstruieren und damit zugleich zu verkitschen, der Übergang der Rollenprosa in Gedankenströme und Erzählerrede eines der zentralen und folgerichtigsten Kunstmittel darstellte, mit denen versucht wurde, der Ausformung des Erzählens in einer immer chaotischeren Welt beizukommen.
Die gesamte Moderne verwerfen?
Nun könnte Ingold – und warum nicht? – natürlich mit einem Schlag die gesamte Moderne verwerfen. Doch dafür bedürfte es guter Argumente, vielleicht des ein oder anderen Zitates und selbst im Rahmen nur eines Zeitungsartikels wenigstens der Andeutung einer noch zu leistenden Stil- und Kompositionskritik. Ingold aber zitiert nicht. Er macht es sich einfach und klammert die Tradition, die doch begründet was er kritisiert und der auch das eigene dichterische Gesamtwerk angehört, von der verhängnisvollen Postmoderne aus. Und führt dann sechs alles andere als postmoderne Autoren als Beispiel für das Verhängnis an, ohne auf sie einzugehen, nämlich:
„weithin belobigte Erzählwerke von Juli Zeh, Bodo Kirchhoff, Alex Capus oder Hanns-Josef Ortheil“, sowie „Autoren wie Knausgard oder Houellebecq“, deren globaler Erfolg zeige „wie machtvoll sich dieser Stil, der die Stillosigkeit zum Prinzip erhebt, bereits durchgesetzt hat“
Hier handelt es sich nichtmal um eine Frage unterschiedlicher Interpretation. Ingold liegt einfach falsch.
Man zeige mir im Werk des Traditionalisten Kirchhoff, der immer noch versucht Goethe 1.0 auf einem Tablett zum Laufen zu bekommen, auch nur einen grammatikalisch „falschen“ Satz, der sich nicht sauber aus der Erzählung begründen lässt. Ausgerechnet Kirchhoff, dem doch vor allem vorzuwerfen ist, dass sein wie aus dem frühen 19. Jahrhundert direkt ins 21. geworfener Stil sich seltenst ganz mit den Sujets seiner Romane verträgt. Juli Zeh auf der anderen Seite hätte einen kritischeren Blick ja verdient. Aber doch nicht für umgangssprachliches Schreiben! Ja würde diese Autorin doch einmal Mut zur Einfachheit beweisen. Ließe sie doch Halbwüchsige nicht daherreden wie erimitierte Philosophieprofessoren nach dem zweiten Schlaganfall. Zeh, lieber Herr Ingold, hat massenhaft Stil. Nur nicht immer den besten. Sie ist das schlechtest denkbare Beispiel für das Herüberwuchern der Alltagssprache in die Literatur. Vielmehr eines für die Katastrophen, die zwanghafte Abgrenzung vom Alltäglichen (Hauptsächliche Quelle zahlreicher Stilblüten von Musil über Jahnn bis Grass) beschwören kann. Capus derweil schreibt doch übersauber (belanglos) während Knausgard? Ach, plage sich wer anders mit Knausgard…
Die „Kunst aus Sätzen“?
Und Houellebecq? Dieser Antimodernist mit doppeltem Boden, der in Lyrik wie Prosa klarstes, wenn auch nur in der Prosa unprätentiöses Französisch schreibt, dessen Romane in solch gradliniger, geradezu klassischer Schlichtheit daherzukommen scheinen, dass sie von Reaktionären aller Länder aufs Podest gehoben werden, und die so geschickt „postmodern“ konstruiert sind, dass diese Verehrung die Reaktionäre noch jedes Mal in den Hintern beißt? Ausgerechnet dieser schnodderige Ästhet, der all seine Schönheit im Inneren literarischer Arbeiten verschließt, soll die These vom sprachlichen Verfall belegen? Wie umgangssprachlich plauderte doch gegen Houellebecq Dostojewski (natürlich: auch das ist bei Zweiterem ein – gelungenes – Stilmittel).
Ingold macht den gleichen Fehler, dem kürzlich ein anderer Sprachkritiker im Literaturmagazin Tell-Review erlag, dessen Anliegen, Literaturkritik wieder stärker stilistisch zu fokussieren durchaus zu unterstützen ist. Nämlich: Literatur als die Kunst zu betrachten, die „aus Sätzen“ besteht. Und dann „falschen“ oder unkünstlerischen Satzgebrauch anzustreichen wie ein gelangweilter Deutschlehrer. Literatur aber ist sowenig die Kunst die aus Sätzen besteht, wie die die aus Worten oder was auch immer. Wenn man denn auf Banalitäten steht, muss man sagen: Literatur ist Kunst aus (bzw. in) Sprache. So wenig ein Gemälde aus Pinselstrichen, Häusern oder Menschen gemacht ist, so wenig lässt Literatur sich vom Gesamtwerk absehend auf Sätze zurückführen. Faulkners Absolom, Absolom etwa besteht aus vielen (nach Ingold: falschen?) Sätzen und Fragmenten. Redewendungen, Ausrufen, Gedankenfetzen. Fünf Seiten aus dem Werk würde man vielleicht einen interessanten Rhythmus, einen Fluss, attestieren, als große Kunst loben würde man sie wohl nicht. Erst wenn die Perspektiven immer produktiver ineinander fließen, das Gesamtbild des Werkes sich auftut, setzt der Genuss ein, das Staunen, die Gänsehaut. Und auch die Ehrfurcht angesichts jedes Satzes, jedes Wortes: Das passt. Und nur so, in der jeweiligen Schau des Ganzen und der Teile im Verhältnis dazu, lässt sich die literarische Spreu vom Weizen trennen. Ingolds ahistorische, vom Werk absehende Sprachkritik zeugt eher vom Tod der Kritik, als dass sie den Verfall der Literatur nachweisen würde.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


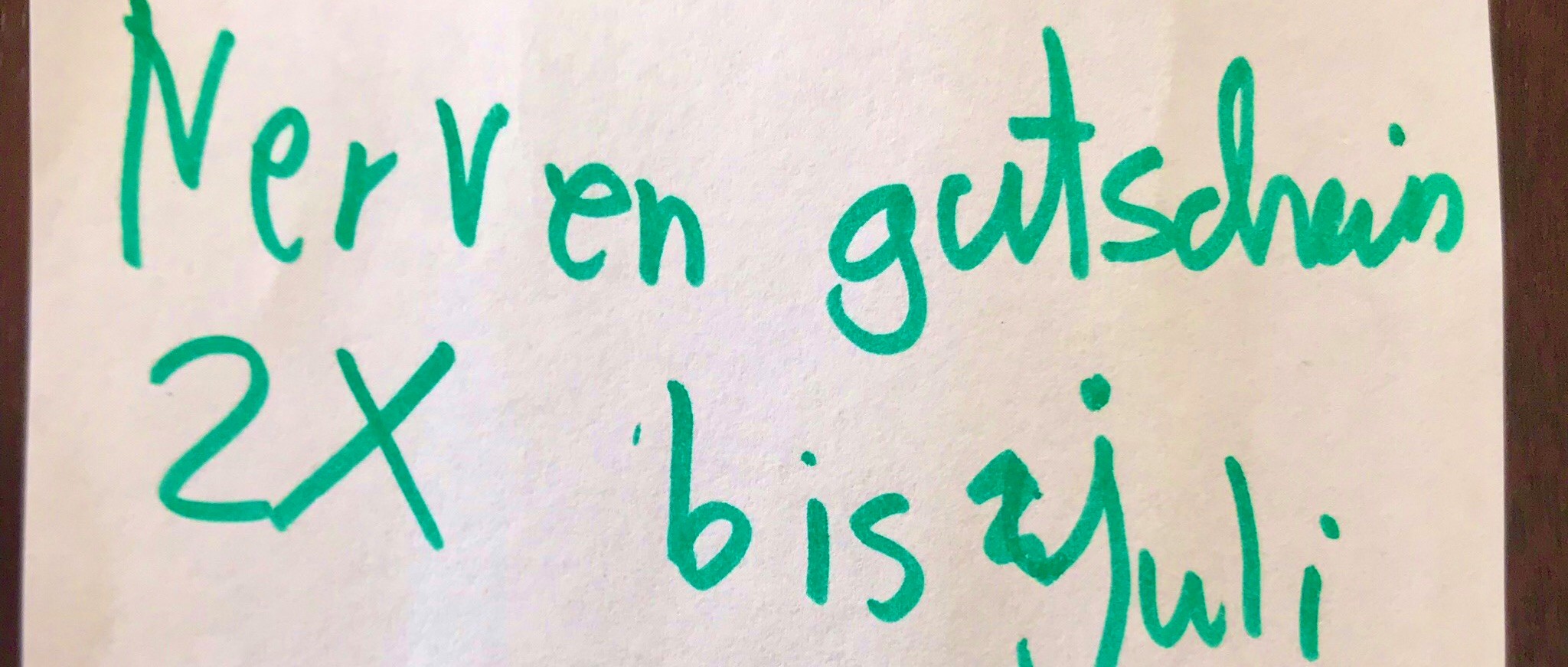

Klausi
Würde mich interessieren, wie Ingold seinen Vorwurf an Houellebecq begründet. Ausgerechnet Heuellebecq, der wie Zeh seinen Protagonisten ganze philosophische und literaturhistorische Abhandlungen in den Mund legt. Wahrschienlich gefallen ihm die gelegentlichen Porno-Ausflüge. nicht. Sehr empfehlenswert übrigens und stilistisch wohl auch einen Ingold zufriedenstellend: „Gold in den Straßen“ der viel zu unbekannten Lilian Loke.