Wer ist normal, wer krank? Wer ist Opfer, wer Täter? In der Vergangenheit wurde manches abweichende Verhalten als krank betrachtet, etwa Homosexualität, das heute selbstverständlich als Teil des normalen Spektrums gilt. Dass sich das geändert hat, ist gut. Es ging um Entstigmatisierung der Betroffenen, um Entpathologisierung abweichenden Verhaltens. In den letzten Jahrzehnten ist aber auch eine gegenläufige Bewegung zu verzeichnen. Immer mehr Menschen werden als psychisch krank, als Opfer oder als diskriminiert eingestuft.
Der Psychologe Nick Haslam beobachtet eine Einengung des Begriffs des Normalen. In dem Aufsatz „Concept Creep: Psychology’s Expanding Concepts of Harm and Pathology“ beschreibt er, wie sich den letzten Jahrzehnten in sechs Bereichen Konzepte so verändert haben, dass immer mehr Menschen als Opfer oder als krank gelten. Er stellt sich die Frage, woher diese „semantische Inflation“ psychologischer Kategorien kommt und welche Folgen sich daraus für unsere Gesellschaft ergeben. Denn wenn sich Konzepte ändern, hat das eine Rückwirkung auf Menschen, die diese Konzepte nutzen, um ihr eigenes Verhalten oder Empfinden einzuordnen, zu bewerten und ggf. zu verändern.
Haslam beschreibt zwei Arten der Ausweitung. Von vertikaler Expansion spricht er, wenn eine Definition weniger stringent genutzt wird, man also eine Krankheit schon bei einer leichteren Symptomatik diagnostiziert als früher üblich. Als horizontale Expansion bezeichnet er die Ausweitung eines Phänomens auf neue Gebiete. Während beispielsweise früher nur Drogenabhängige als Süchtige galten, wird heute auch von Spielsucht, Sexsucht, Computersucht, usw. gesprochen.
Misshandlung bzw. Missbrauch
Früher war Misshandlung eine Form der Körperverletzung. Heute wird der Begriff sehr viel weiter gefasst. Er setzt nicht mehr voraus, dass jemand körperlich misshandelt wird. Auch wenn mir kein Haar gekrümmt wird, kann ich emotional misshandelt, also beschimpft, eingeschüchtert, bedroht, abgelehnt, runtergemacht, vereinnahmt oder mit emotionaler Kälte behandelt werden. Und diese Misshandlung wird nicht mehr nur als Phänomen zwischen Erwachsenem und Kind gesehen, sondern auch zwischen zwei Erwachsenen. Hinzugekommen ist auch der Aspekt der Vernachlässigung (neglect as abuse). Misshandlung umfasst somit nicht nur aktives negatives Verhalten, sondern auch die Unterlassung fürsorglichen Verhaltens.
Die Idee des emotionalen Missbrauchs bringt ein deutlich höheres Maß an Subjektivität mit sich. Von außen betrachtet lässt sich ein konkretes Verhalten oft schwer als eindeutig positiv oder negativ einstufen. Ist eine Mutter beschützend oder besitzergreifend? Ist sie aggressiv oder streng? Versucht sie ihrem Kind Manieren beizubringen oder ist sie emotional kalt und abweisend? Weil sich diese Fragen nicht einfach beantworten lassen, ist man bei der Feststellung eines Missbrauchs auf die subjektive Einschätzung des Kindes (oder früheren Kindes) angewiesen. Ob es missbraucht wurde, entscheidet sich an der Beantwortung der Frage, ob es sich von seinen Eltern schlecht behandelt oder nicht geliebt fühlte.
Ähnlich viel Interpretationsspielraum ergibt sich bei der Kategorie der Vernachlässigung. Fängt sie schon an, wenn das Kind sich das Pausenbrot selbst schmieren muss, oder erst, wenn tagelang keine Essen im Kühlschrank ist? Wenn das Kinderzimmer wie eine Müllhalde aussieht, oder erst, wenn die ganze Wohnung verdreckt ist. Wenn das Kind morgens zum Spielen rausgeschickt wird und die Eltern sich bis zum Abend keine Sorgen machen, weil sie ihm Freiheit zugestehen und Selbständigkeit fördern wollen? Oder erst, wenn sie dies nur tun, um ihre Ruhe zu haben.
Bullying
Nicht nur Erwachsene können zu Kindern gemein sein. Auch Kinder können ihren Altersgenossen gegenüber ziemlich fies sein. Für solches Verhalten wurde der Begriff „Bullying“ eingeführt (im Deutschen wird oft auch „Mobbing“ verwendet). Das Phänomen hat in den Sozialwissenschaften eine steile Karriere gemacht. Haslam weist darauf hin, dass Forschung zum Thema im Zeitraum von 1990 bis 2010 explodiert ist. Die Zahl der Zitierungen hat sich verhundertfacht. Von Bullying wird gesprochen, wenn ein Machtgefälle vorliegt, die Aggressoren also älter, stärker, in der Überzahl sind, und wenn das Verhalten wiederholt und über einen längeren Zeitraum erfolgt. Die Ausweitung des Konzepts des Bullyings erfolgte zum einen in Gestalt des Cyber-Bullying in den virtuellen Raum hinein, zum anderen in die Sphäre der Erwachsenen, insbesondere am Arbeitsplatz. Zudem werden inzwischen auch passive Verhaltensweisen wie das Ausschließen, bzw. Nicht-Einbeziehen und Ignorieren einer Person als Bullying gewertet. Eine vertikale Expansion des Begriffs erfolgte dadurch, dass die zwei ursprünglich zentralen Kriterien des Machtgefälles und der Wiederholung nicht mehr als unbedingt notwendig erachtet werden. Als Bullying wird mitunter schon ein einzelner Vorfall gewertet, etwa das Onlinestellen eines peinlichen Fotos oder einer Beleidigung, und dies auch, wenn der Täter ein Einzelner ist, der nicht aus einer Position der Überlegenheit heraus handelt bzw. dessen Überlegenheit sich nur an seinem Status, seiner Beliebtheit oder seines ausgeprägteren Selbstbewusstseins festmacht. In der ursprünglichen Definition spielte es eine wichtige Rolle, dass das Opfer keine Chance hatte, sich zu wehren. Wenn kein deutliches Machtgefälle da war, ging man davon aus, dass Kinder lernen können, mit solchen Situationen umzugehen und Möglichkeiten haben, sich zu wehren, die Opferrolle also schnell wieder zu verlassen. Auch das Kriterium der Absichtlichkeit wurde relativiert. Entscheidend ist heute nicht die vorhandene oder nicht vorhandene böse Absicht, sondern die subjektive Wahrnehmung des Opfers, das sich gemobbt fühlt. Dies kann etwa der Fall sein, wenn jemand wiederholte Kritik seines Vorgesetzten als belastend und die an ihn gestellten Anforderungen bei der Arbeit als zu hoch betrachtet.
Trauma
Der Begriff Trauma bezog sich ursprünglich auf eine schädliche Krafteinwirkung auf das Gehirn. So benutzen wir auch heute noch den Begriff des Schleudertraumas. Mittlerweile wird er außerhalb der Notfallmedizin aber fast nur noch mit Bezug auf psychische Belastungen verwendet, die durch ein „traumatisches“ Ereignis ausgelöst werden. Nach dieser ersten Ausweitung von der Verletzung des Gehirns auf die Verletzung der Psyche folgten im Reich des Psychischen immer weitere Anwendungsfälle. Zunächst bezog dich der Begriff auf Ereignisse, die außerhalb des Bereichs üblicher Vorkommnisse liegen und für fast jeden Menschen eine starke psychische Belastung darstellen würden. Mittlerweile hat jedoch auch hier das subjektive Empfinden des Opfers eine zentrale Bedeutung erlangt, so dass heute eine Vielzahl von Erlebnissen als traumatisch betrachtet werden können, die keineswegs gleich schlimm erscheinen: Flugzeugabsturz, Ehekrise, Jobverlust, Krieg, Spott der Mitschüler, die Geburt eines Kindes, Folter, Vergewaltigung, Durchfallen bei einer Prüfung, usw. Zudem wird nicht mehr vorausgesetzt, dass man selbst direkt betroffen ist. Demnach kann auch, was Angehörigen oder Freunden passiert, was man nicht selbst erleidet, sondern beobachten muss oder auch nur etwas, wovon man erfährt, zu Traumatisierung führen. Ebenso Ereignisse, die der Betroffene selbst nicht notwendig als belastend empfindet, etwa nicht altersgerechte sexuelle Erfahrungen.
Psychische Störung
Wie viele psychische Krankheiten gibt es überhaupt? Und welche? Man erfährt es im Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). Die erste Ausgabe von 1952 kannte 106 Diagnosen. Im DSM-II von 1986 waren es schon 186. Heute sind es im DSM-V 374, aus denen der Arzt zu wählen hat, wenn er einen Patienten diagnostizieren möchte. Diese Vielzahl hat damit zu tun, dass man früher gröber klassifiziert hat. Sie hat aber auch damit zu tun, dass heute Menschen psychische Störungen attestiert werden, die man früher nicht als krank bezeichnet hätte. So kamen beispielsweise Störungen der geschlechtlichen Identität, extreme Schüchternheit, Anorgasmie und verschiedene Essstörungen hinzu. Und auch eine vertikale Expansion ist in den Diagnoserichtlinien zu erkennen. So kann etwa heute als Depression diagnostiziert werden, was man früher schlicht als Trauer betrachtete. Scharfe Kritik an diesen erheblichen Ausweitungen kommt unter anderem von dem emeritierten Psychiatrieprofessor Allen Frances, der maßgeblich an der vorletzten Ausgabe des DSM mitgewirkt hatte und nun zur Rettung des Normalen aufruft. „Wir hatten schon bei DSM 4 eine diagnostische Inflation psychischer Krankheiten. Mit DSM 5 haben wir eine Hyperinflation. DSM 5 wird Millionen von neuen Patienten schaffen, die man wahrscheinlich besser sich selber überlassen würde“, sagt er in einem Interview. Insbesondere bei Depression, Autismus und ADS sieht er eine Explosion der Diagnosen. Diese Entwicklung zeigt sich auch deutlich in der Statistik. Die durch psychische Krankheiten ausgelösten Krankheitstage haben sich in Deutschland den letzten 40 Jahren verfünffacht – eine Entwicklung, die sich nicht einfach mit der Behauptung erklären lässt, Arbeit werde immer stressiger.
Sucht
Sucht fällt zwar auch in den Bereich der psychischen Erkrankungen, wird aber von Haslam noch einmal gesondert betrachtet. Als süchtig galten ursprünglich Menschen, die in einer körperlichen Abhängigkeit von einer psychoaktiven Substanz waren. Durch die Gewöhnung braucht ein Süchtiger tendenziell größer werdende Dosen. Wenn er die Droge nicht mehr nimmt, leidet er unter Entzugserscheinungen. Die wesentliche Ausweitung des Suchtbegriffs besteht darin, dass heute nicht mehr nur Substanzabhängigkeit als Sucht gewertet wird. Hinzugekommen sind Phänomene wie Internetsucht („Die neue Abhängigkeit. Internetsucht: Woran Sie erkennen, dass Sie krank sind“), Spielsucht („Wir meinen, dass Spielsucht eine fortschreitende Krankheit ist, die niemals geheilt, aber zum Stillstand gebracht werden kann.“), Social Media-Sucht („Sucht nach Sozialen Netzwerken. Gefährlicher als Alkohol und Zigaretten“), Bräunungssucht („Tanorexie – Bräunungssucht verbreitet sich in Deutschland. Erschreckend: Jeder vierte Solariumbesucher ist seelisch gestört.“), Kaufsucht („Sehen, kaufen, bereuen – Schätzungen zufolge sind bis zu acht Prozent der Bevölkerung krankhaft kaufsüchtig.“) Arbeitssucht („Arbeitssucht ist eine ganz besondere Droge: Von der Gesellschaft honoriert, aber lebensgefährlich“) oder Sexsucht („Sexsucht-Test: Bist du oder dein Partner gefährdet?“). Eine Ausweitung in vertikaler Richtung erfolgte durch das Konzept milder Abhängigkeit (soft addiction). Gemeint sind schlechte Angewohnheiten, die Geld, Zeit oder Energie kosten, aber nicht mit einem unwiderstehlichen Drang und dem Gefühl der Abhängigkeit einhergehen.
Vorurteile
In der Sozialpsychologie beobachtet Haslam eine starke Ausweitung im Bereich der Vorurteile. Die Vorurteilsforschung ist ein wichtiges Betätigungsgebiet von Sozialforschern. Es geht um Rassismus, Sexismus, Schwulenfeindlichkeit, Judenfeindlichkeit usw., also negative, vorurteilsbelastete, feindliche Haltungen gegenüber bestimmten Personengruppen. Entscheidend war immer, dass jemand anderen gegenüber feindlich gesinnt ist. Heute ist das aber immer öfter nicht mehr ein notwendiges Kriterium. Man kann jetzt auch Rassist sein kann, ohne sich dessen bewusst zu sein und ohne diese Einstellung (offen) zum Ausdruck zu bringen. Es reicht, wenn man beispielsweise sagt, die heutige Gesellschaft sei nicht rassistisch, oder Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsmaßnahmen ablehnt. Von aversivem Rassismus wird gesprochen, wenn man sagt, nichts gegen Schwarze zu haben, aber angibt, sich in Umgebungen mit vielen Schwarzen unwohl oder unsicher zu fühlen. Von implizitem Rassismus, wenn man ethnische Minderheiten indirekt mit bestimmten negativen Eigenschaften oder Verhaltensweisen in Verbindung bringt. Die Problematik eines solchen Konzepts von „impliziten Rassismus“ kommt in einem Zitat des schwarzen Bürgerrechtlers Jesse Jackson gut zum Ausdruck: “There is nothing more painful to me at this stage in my life than to walk down the street and hear footsteps and start thinking about robbery. Then look around and see somebody White and feel relieved.” Jackson ist kein Rassist, und ein Weißer, der in der gleichen Situation, ebenfalls Erleichterung empfindet, ist es ebenfalls nicht notwendig.
Wie beim Missbrauch hat auch bei der Diskussion um Vorurteile und Diskriminierung in den letzten Jahren die Opferperspektive an Bedeutung gewonnen. Dies kommt u.a. in der Idee der „Mikroaggression“ zum Ausdruck. Als Mikroaggression kann es beispielsweise gewertet werden, wenn man sich einen (ausländischen) Namen nicht merken kann oder ihn wiederholt falsch ausspricht, wenn man Witze erzählt, in denen Minderheiten vorkommen, oder wenn man sich darüber wundert, dass jemand gut deutsch spricht. Oder wenn man, wie Martin Luther King, sagt, Menschen sollten nach ihrem Charakter und nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden – ein Zitat, auf das sich Konservative gerne berufen, die Affirmative Action-Maßnahmen ablehnen. Entscheidend ist, dass das Verhalten von jemandem als feindlich empfunden wird, obwohl der „Täter“ oft der Auffassung ist, keine böse Absicht verfolgt zu haben, und vielleicht sogar nett sein wollte.
Auffällig ist hier auch die Übernahme des psychiatrischen Begriffs der Phobie. Wir sprechen heute alltäglich von Homophobie, Transphobie, Xenophobie, Islamophobie. Gelegentlich hört man auch Wortbildungen wie Gerontophobie. Während in medizinischer Hinsicht Phobien jedoch Ängste sind, ist hier weniger irrationale Angst, sondern eher ablehnende und abwertende Haltung gemeint. Bzw. es wird den Betroffenen unterstellt, Angst zu haben und krank zu sein, ihr Verhalten und ihre Meinung wird pathologisiert (statt kritisiert).
Opferkultur
In allen sechs von Nick Haslam untersuchten Bereichen haben wir es mit einer Ausweitung der Zahl von Menschen zu tun, die sich durch Leiden, Verletzlichkeit und Unschuld definieren und in Selbst- und/oder Fremdwahrnehmung als Opfer, krank oder beides und somit als schutz- oder therapiebedürftig oder beides gelten.
Die vielfachen Erweiterungen der Definitionen haben zum einen dazu geführt, dass Missbrauch, Bullying, psychische Krankheit, Traumatisierung, Sucht und Diskriminierung heute viel häufiger vorzukommen scheinen als früher. Zum anderen wird dadurch eine Kultur gestärkt, in der die Rolle des Opfers, positiv gesagt, immer weniger stigmatisierend ist, negativ gesagt, immer attraktiver geworden ist. Das ist gefährlich. Es mag hart klingen, aber das Sich-Einrichten und Verharren in einer identitätsstiftenden Opferrolle ist fatal. Es wird aber sehr viel leichter, wenn diese Rolle durch eine Diagnose formell aufgewertet und durch Ausweitung der Konzepte so weit verbreitet wird, dass man sich zumindest nicht allein zu fühlen braucht.
Wo es aber viele Opfer gibt, muss es auch viele Täter geben, denen eine Tendenz zu Missbrauch, Mobbing, Beleidigung, Aggressivität, Diskriminierung zugeschrieben wird. Hier tut sich ein riesiges Betätigungsfeld für die auf, die Opfer und Täter betreuen, analysieren, therapieren, kontrollieren und so in immer größerem Umfang die soziale Interaktion regulieren.
Schützer und Schutzbedürftige
Während eine Unterscheidung in Gut und Böse noch den Kampf des Einen gegen das Andere impliziert, also beide gleichermaßen aktiv sind, bleibt beim moralischen Weltbild, das wesentlich in Opfer und Täter einteilt, für die Opferrolle nur der passive Part. Als „anerkannte“ Opfer müssen sie sich mit dem Gefühl der Machtlosigkeit arrangieren und werden von der Verantwortung entbunden, aus eigener Kraft oder überhaupt wieder auf die Beine zu kommen. Nutznießer ist die neue therapeutische Klasse. Sie ist darauf angewiesen, dass es genug Menschen gibt, die die Opferrolle übernehmen. Je weiter die Definitionen, desto mehr Menschen fallen darunter und desto leichter ist es, die Rolle zu akzeptieren und in ihr zu verharren.
Laut Haslam ist die gewachsene Sensibilität für Leiden aller Art daher zumindest ambivalent. Sie mag zum einen Ausdruck sein für weniger Härte, geringere Toleranz gegenüber aggressivem Verhalten und mehr Mitgefühl in der Gesellschaft. Sie führt aber zu neuen Ungleichheiten durch die höhere Akzeptanz passiver Rollen, die Pathologisierung normalen Verhaltens und den wachsenden Einfluss der therapeutischen Klasse.
Eine negative Kehrseite hat die Entwicklung auch für all jene, die tatsächlich im früher üblichen, engeren Sinn Missbrauchsopfer, traumatisiert, diskriminiert oder psychisch krank sind. Sie drohen in der Masse der neuen Opfer unterzugehen und mitunter sogar als „komplizierte Fälle“ ins therapeutische Abseits zu geraten.
Allgemeine Verunsicherung
Auch in Hinblick auf die „Täter“ ist die Entwicklung problematisch. Ihr Verhalten wird weniger toleriert, stärker verfolgt und bestraft. Das ist in Ordnung, wenn es sich tatsächlich um schändliches und schädliches Tun handelt. Es ist aber ein Problem, wenn dadurch jede spöttische Bemerkung und jeder Streich zu einem Verbrechen oder verletzendem und sozial schädlichem Verhalten erklärt wird. Dies führt zu Verunsicherung, Selbstzensur und einem Klima der Unterdrückung freier Meinungsäußerung. Die soziale Dynamik innerhalb einer Schulklasse oder einer Abteilung in einer Firma wird zu einem streng zu überwachenden Risiko, die beteiligten Individuen zu potenziellen Tätern und Opfern, deren Verhalten permanent reguliert werden muss, damit niemand tatsächlich oder vermeintlich Schaden nimmt. Sehr viel mehr Menschen müssen mit Anschuldigungen leben, die sie oft zu Recht für ungerechtfertigt halten.
Die Inflation der Verletzlichkeit betrifft letztlich uns alle. Menschen werden zunehmend verunsichert im Umgang mit anderen, deren subjektive Verletzlichkeit sie nicht kennen. Insbesondere Kindern wird unter einem solchen Regime die Möglichkeit genommen, Erfahrungen zu machen, die nicht immer positiv sind, und die Fähigkeiten zu entwickeln, mit solchen Herausforderungen fertig zu werden. Und damit auch das Selbstbewusstsein zu erlangen, das sich erst entwickelt, wenn man selbst eine Lösung findet und nicht passiver „Nutznießer“ einer therapeutischen, pädagogischen oder disziplinarischen Intervention wird, auf die aus der Opferrolle heraus eine Anspruch erwächst, die diese Rolle aber auch verfestigt.
+++
Lesen Sie auch: Gesunde Ernährung als Schulfach?
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


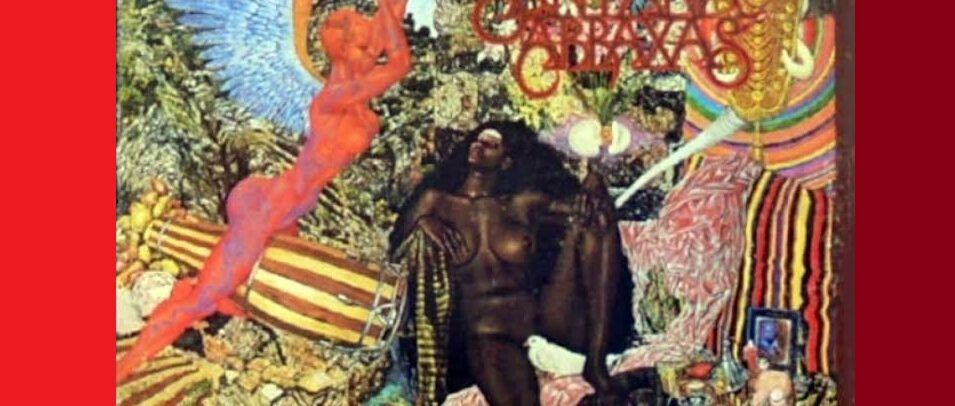

The Saint
Mein Kenntnisse der Psychologie sind vernachlässigbar, daher nur eine Frage: Wenn ich die hübsche Blondine an der Bar frage, ob sie mit mir schlafen will, und sie das ablehnt, eine Stunde aber mit Max, dem Yogalehrer, eine Nummer in seinem Auto schiebt, und ich mich dann subjektiv sehr verletzt fühle, bin ich dann nicht auch ein Opfer?