„Die Autorenintention zentral für die Beurteilung eines Werkes zu setzen ist ein romantisches Residuum der Genieästhetik “ – so stand es zugegeben etwas sperrig, und eigentlich eher nebenbei, in meiner Kolumne über Politische Korrektheit in der Literatur. Bei einigen Lesern stieß das auf Unverständnis, besonders mit Blick auf die Frage, ob man einen Text nachträglich umschreiben dürfe. Wer, wenn nicht der Autor, ist denn verantwortlich für sein Werk? Bestimmt, wann es fertig, abgeschlossen ist? Schaut auf das Geschaffene und sagt „es ist gut?“
Hermine schwarz, Dumbledore schwul?
Das dürfte auch insgesamt der beherrschende Blick auf Autorenschaft sein, gerade bei Genreliteratur (und deren Fans machen heute den Großteil der aktiv über Literatur diskutierenden aus, was ich durchaus anerkennend verstanden wissen möchte) geht man noch einen Schritt weiter. Hier hat der Autor auch zur Interpretation das letzte Wort. So nahm man Harry Potter-Autorin JK Rowling die nachträgliche Erklärung, Dumbledore sei schwul, größtenteils kritiklos ab, obwohl sich dazu in keinem der Bücher eine hinreichend klare Stelle finden lässt. Ein Fehler: In Büchern steht nur was in Büchern steht. Etwa auch, wie hier im Januar ausgeführt, nicht, dass Hermine Granger schwarz oder weiß ist, sondern nur, dass eine Hautfarbe nie festgeschrieben wurde. Ebenso wenig wie Dumbledores sexuelle Orientierung. „Der Tod des Autors“ unter diesen heute vielleicht überstrapazierten Begriff fasste Roland Barthes die Entwicklungen, grob gesagt, die in der Literaturwissenschaft auf das hinführten, was heute eigentlich wenigstens heuristischer Gemeinplatz sein sollte – dass man zur Interpretation eines Textes den Text heranzuziehen hat und sonst erst einmal nichts.
Ich möchte einen Schritt weitergehen und dazu anregen auch zur Beurteilung der Abgeschlossenheit und der Güte eines Werkes den Autor und dessen autorisierte Fassungen beiseite zu lassen. Denn „das Buch ist besser als die Verfilmung“, „die vom Nachlassverwalter vollendete Fassung ist schlechter als das fragmentarische Original“, oder „eine gekürzte Hörbuchfassung kann nur verlieren“ – das sind durchaus Glaubenssätze, von denen sich auch die professionelle Literaturkritik ungern verabschiedet. Hat man sie doch von der Wiege auf als Ausweis geistiger Überlegenheit schätzen gelernt.
Beispiel Harry Potter: Film besser als Buch!
Bleiben wir noch einen Moment beim wohl meistgelesenen Romanwerk nicht nur der Gegenwart sondern aller Zeiten. Ich denke auch viele Fans werden nicht widersprechen, dass die Harry Potter Romane ab dem Feuerkelch massiv an Qualität einbüßten. Die Bände werden länger, konfuser, stilistisch schwächer – man darf davon ausgehen, dass sich kein Lektor mehr an die Erfolgsautorin herantraute. Über den unsäglichen Schlussband wollen wir gar nicht erst reden.
Doch schon der Halbblutprinz wirkte schrecklich schlecht balanciert, das Fortdauern des Internatsalltags im Angesicht der Machtübernahme Voldemorts (immerhin, wenn auch nie überzeugend, so eine Art Zauberhitler) teils unfreiwillig komisch, und die ellenlangen Passagen über Kindheit und Jugend des dunklen Lords wie eine hastig noch hingeschluderte Hintergrundsstory, die man besser vorsichtig schon in vorangegangenen Büchern entwickelt hätte. Der Film dagegen? Der ist ein Feuerwerk an spannender Handlung, schafft es in knapp 3 Stunden – dabei Zauberhitlers Kindheit eindringlich in wenigen Bilder kondensierend – tatsächlich eine wirklich bedrohliche Artsphäre aufzubauen, und selbst noch die letzlich so irrelevante Identität des Halbblutprinzen, eine der größten Enttäuschungen des sechsten Buches, präsentiert Alan Rinkman als schneidig hingeworfene Antiklimax mit einigem Stil.
Man sage was man will, der Film ist weitaus besser als das Buch. Denn er ist, soweit das mit dem Material der Vorlage eben möglich war, sauber und geschickt auf den Höhepunkt hin komponiert.
Beispiel Der Schwimmer: miserabel umgesetzt
Ein anderes Beispiel: Der Schwimmer ist eine Shortstory von John Cheever, die mit Burt Lancaster in der Hauptrolle verfilmt wurde. Der erfolgreiche Geschäftsmann Ned Merryl beschließt darin, schwimmend von Pool zu Pool den Weg von einer kleinen Party bei Freunden durch den edlen Vorort zu seinem Haus zurück zu nehmen – Conrads Herz der Finsternis gibt für die zuerst doch so schlicht erscheinende Erzählung eine mögliche Blaupause ab. Frühbürgerliches Entdeckerstreben angewandt auf einen Mikrokosmos spätbürgerlicher Dekadenz. Unterwegs schält sich Lebenslüge um Lebenslüge von Neds nach seiner Frau benanntem „Lucinda Strom“, endlich langt er an seinem verlassenen Haus an – Frau und Kinder kehrten Ned schon vor langer Zeit den Rücken.
Ein so einfacher wie hervorragender Stoff, den Cheever weit weniger überzeugend präsentiert als es bis heute überschwängliche Kritiken glauben machen. Das liegt vor allem an der Erzählsituation, die, obschon nicht allwissend, dem Leser Einblicke in Ned unbewusstes erlaubt, und so die Pointe des Textes beinah schon im ersten Drittel ausplaudert.
„Was he losing his memory, had his gift for concealing painful facts let him forget that he had sold his house, that his children were in trouble, and that his friend had been ill?“
Auch harmoniert die Erzählperspektiven nicht sonderlich mit der psychologisch-sozialen Symbolik der Erzählung. Der Schwimmer beginnt wie der Film als realistisch wirkendes Werk, dessen Fassade nach und nach bröckelt und Blicke auf psychische Untiefen frei gibt. Die etwa von Michael Chabon hoch gelobte Symbolik:
„This progress Cheever figures through a careful manipulation of the marks of seasonal change — the leaves on trees, the wheeling of the constellations — so that as we read the story we feel time passing, before our eyes; feel Neddy losing heart, growing weary, getting old“
drängt relativ früh eine Lesart des Textes als reine Parabel auf Alter und Kontrollverlust auf. Der Verfilmung gelingt dagegen in beiden Aspekten ein prekärer Tanz auf der Rasierklinge – bis zuletzt bleibt eine rein psychologische oder parabelhafte Deutung ebenso möglich wie eine „realistische“ – die aufgrund des psychischen Verfalls des Hauptcharakters zusehends ins Fantastische spielt. Wäre da nicht das verkrampfte Schauspiel Burt Lancasters, auch hier wäre der Film dem Text deutlich vorzuziehen. So harrt das gelungene Kunstwerk aus dem Schwimmerstoff, so blasphemisch das klingen mag, noch seiner Schöpfung.
Manns Zauberberg lässt sich verbessern!
Apropos Blasphemie: Thomas Manns Zauberberg ist, so großartig in der Idee und so stark in den Dialogen er sein mag, kompositorisch ein unglaublich schwacher Roman und bleibt meilenweit hinter den Buddenbrooks zurück, worin die einzelnen Charaktere fast wie Melodien durch das Textgeflecht geführt werden. Besonders stört am Zauberberg die Reihenstruktur, mit der die Charaktere vorgestellt und beiseite geschafft werden. Erst Castorp und Ziemßen, dann Settembrini, später Naphta, zuletzt, um bald schon einen unschönen Tod zu sterben, Mynheer Peeperkorn. Die Simplizität der Struktur wird der Komplexität der Parallelwelt des Sanatoriums einfach nicht gerecht, besonders Peeperkorn steckt wie ein hastig noch dazu erfundener Fremdkörper im Buch. Die um die Hälfte gekürzte Hörspielbearbeitung des Bayrischen Rundfunks schwächt diesen Kontrast klug ab. Allein schon dadurch, dass alle Charaktere sich auf weniger Raum entfalten müssen. Doch auch künstlerisch hätte sich das Peeperkorn-Problem lösen lassen, etwa vielleicht, indem dieser, sei es als Person, sei es nur als Idee – denn die unförmig fleischgewordene Idee des völkisch-ästhetizistischen Überschwangs ist Peeperkorn ja – sich bereits früher im Buch angekündigt hätte. In Worten Clawdia Chauchats vielleicht, vielleicht als deutlich werdende Leerstelle in den Bedürfnissen anderer Zauberberg-Patienten nach einer Führerfigur, die ihre noch unartikulierten apokalyptischen Träume bündelt.
Authentizität ist Fetisch
Was folgt nun aus alldem? Nicht, dass, wie man es schon dem Barthesschen Satz vom Tod des Autors zu Unrecht vorgeworfen hat, der Autor als irrelevant in der Kunstproduktion zu gelten hat. Nicht, dass das Material wichtiger wäre als die Gestaltung, oder dass Kunst eigentlich der Ausfluss eines gesellschaftlichen Systems oder eines kollektiven Unterbewussten wäre und überhaupt das ganze Dasein eine künstlerische lebensweltliche Ursuppe und dergleichen. Nein, vielmehr, dass heueristisch gesprochen auch für die qualitative Beurteilung eines Kunstwerkes das Werk selbst allein entscheidend ist.
Dass also, um ein letztes Beispiel zu bemühren, die wahre Intention (TM) James Joyce‘ hinter den jeweiligen absichtlichen und unabsichtlichen Abweichungen vom Standard-Englischen in Finnegans Wake irrelevant ist. Um zu entscheiden ob Penguins The Restored Finnegans Wake mit seiner neuen, und deutlich konservativeren Interpunktion gelungener ist als Joyce‘ Ausgabe letzter Hand oder gar die Übertragung von Dieter Stündel, genügt es, die Texte zu vergleichen. Anhand derer lässt sich diskutieren. Authentizität ist ein Fetisch, und hat in einer Debatte über Literatur nichts zu suchen.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

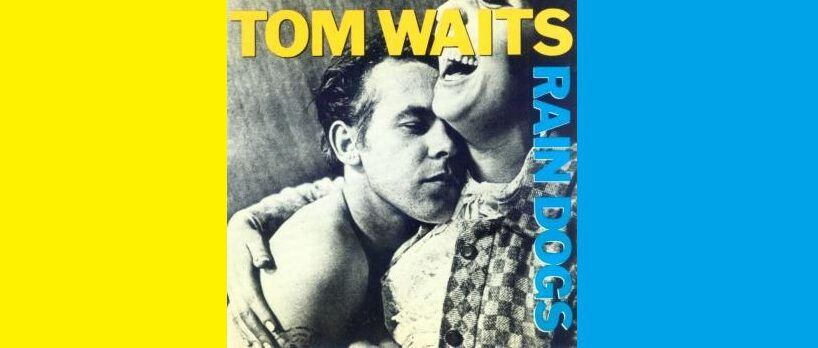


Ihr Kommentar