Manchmal erwischt es einen aus der Kalten. Irgendein zitternder, ewig ängstlicher Teil des Hirns rechnet ja stets mit dem Schlimmsten und ahnt voraus. Er stört, aber er meint’s ja nur gut. Er will dem Schmerz, sollte er denn kommen, durch Antizipation wenigstens die erste Kraft nehmen.
Prince: Ein Phänomen, ein Wunder!
Was soll ich sagen? Bei Prince hat mein Schmerzwellenbrecher vollkommen versagt. Es ist das erste mal, dass mich der Tod eines Rockstars wirklich traurig stimmt. Ich sah es nicht kommen, ich hab es nicht befürchtet. Ich war fest überzeugt, ihn im Alter als Wiedergänger John Lee Hooker’s stampfen und bluesen zu sehen. Blues und Jazz, das waren seine Eltern, da kam er her, da würde er, des war ich gewiss, wieder hin sich verjüngen. Sogar sein Gesicht hatte bereits begonnen, sich in die genregerechte Sorte Leder zu verwandeln. Tiefnarbig und glatt zugleich, sie wissen schon… Tja. Nixda Blueser. Einfach gestorben. Oj weh! Was für ein Verlust!
Der kleine Kerl war für mich ein Phänomen, ein Wunder. Ein Vorbild, ein Ideal, ein unfassbarer Springquell aus dem immer neue Einfälle sprudelten. Ihn trieb nicht die gewöhnliche Angst des Künstlers, eines Tages aufzuwachen und leergeschrieben zu sein; ihn trieb die Angst, nicht alle Einfälle umsetzen zu können. Er arbeitete und schuf unentwegt. Vielleicht starb er deshalb so früh und plötzlich; er hat seine Lebenszeit einfach ohne Schlafenszeit abgespult.
Und was er alles konnte! Er war omnipotent. Komponieren, arrangieren, gitarrieren, eigentlich alle Instrumente spielen, also richtig gut spielen… lustige, traurige und doppeldeutige Texte schreiben, tanzen wie ein Faun und unglaublich gut singen, schreien und überhaupt so ziemlich jeden Laut ausstossen, den Stimmbänder formen können. Und er hatte dieses Ohr für Klänge. Viele seiner Songs erkennt man als erstes am Klang, anstatt, wie üblich, an Melodie, Harmonie und Rythmus. Sign o’ the times, anybody?
Soviel Meisterschaft entmutigt
Ja, und sein Timing! Allein schon das Timing! Soviel Meisterschaft entmutigt. Zum Glück habe ich mit der Zeit herausbringen können, was er nicht konnte. Er konnte nicht denken und war anfällig für esoterisches Geraffel. Geschenkt. Ausserdem brauchte er immer gute Leute um sich, um wirklich gut zu sein. Aus sich heraus sich ganz nach oben zu bequemen, das war ihm nicht möglich. Leute wie Clare Fisher oder Wendy & Lisa haben ihn zu Höchstem angestachelt, ihn inspiriert, ihn komplettiert. Auf sich gestellt lieferte er Dutzendware. Immer noch besser, als das, was einem Normalsterblichen einfällt, aber nicht sein bestes.
Deshalb hat er seit gut 15 Jahren nur noch gesiecht. Gesochen? Geseicht? Musikalisch, meine ich. Nun ist er tot. Und mitten im April gegangen. Typisch. Wenn der Natur ihr immergleiches Knospen einfällt, fällt ihm, dem stets was Neues einfiel, zu sterben ein. Sexy Motherfucker, der! So was blödes! Was für ein grandioser, genialer Musiker! Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts teilen sich Prokofjew und Ellington. Die zweite…Nunja. Im Tode feilscht man nicht. Sagen wir fünfundzwanzig Prozent gehören Prince.
All good things they say, never last –
And love, it isn’t love until it’s past.
+++
Lesen Sie auch: Bewerbungen und andere verpasste Chancen I
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
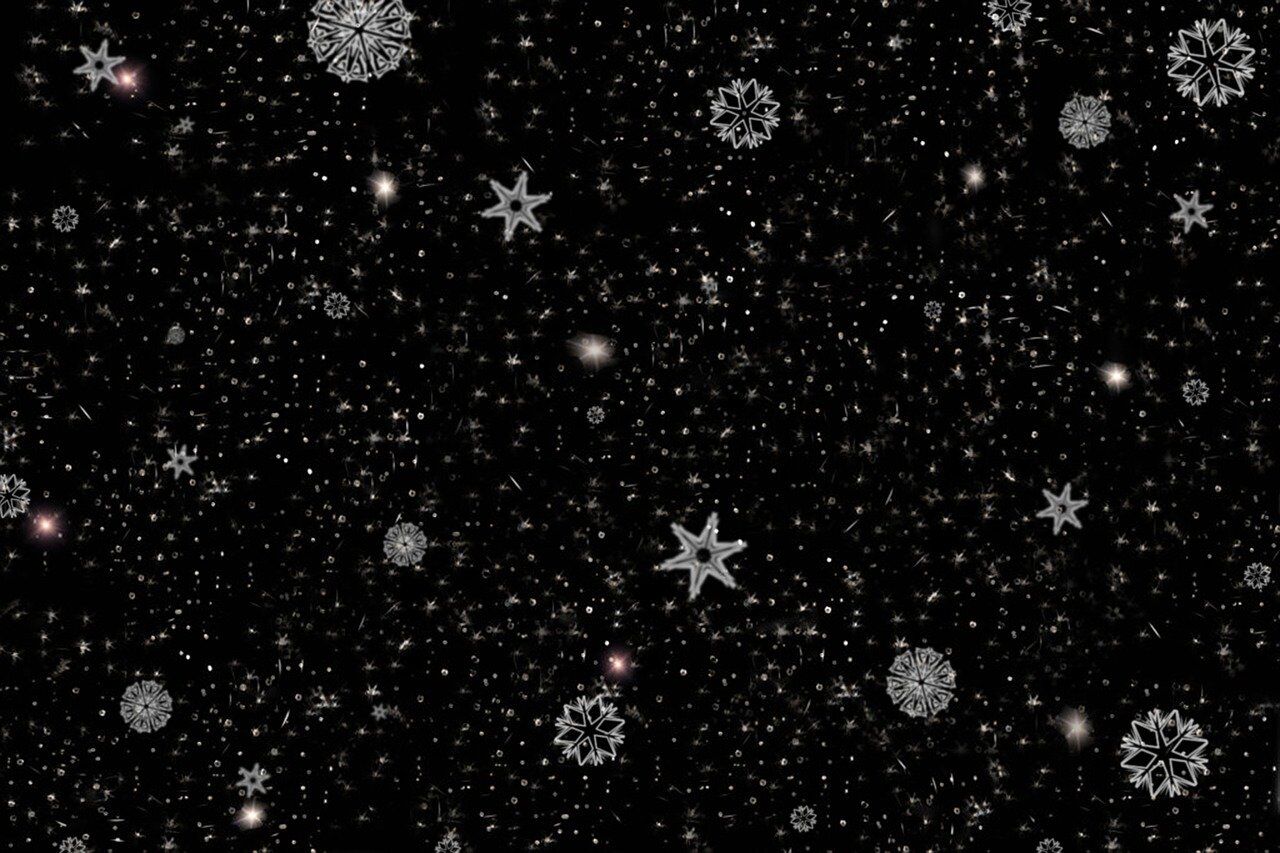



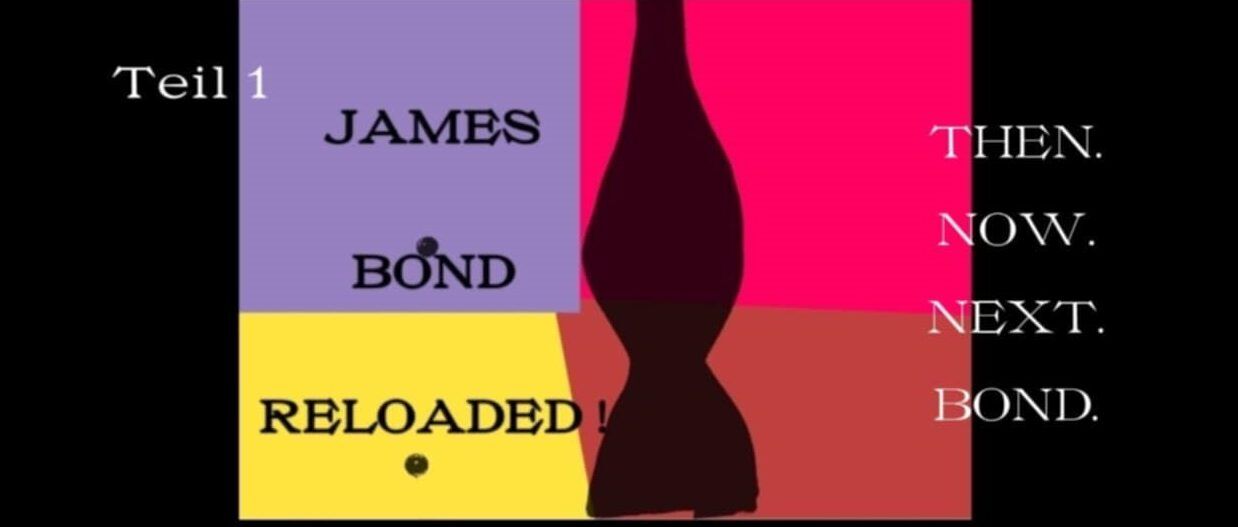










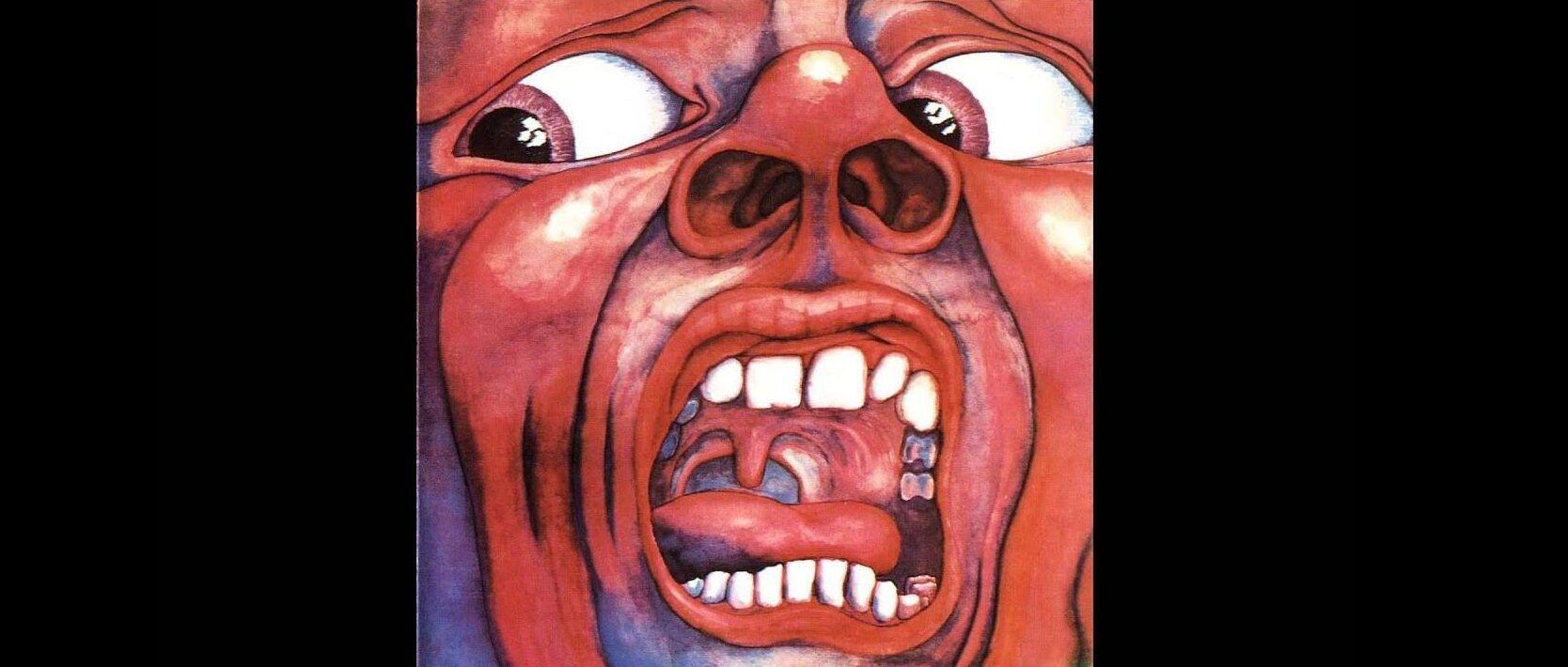






Leave a Reply