Das gespaltene Russland
Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Nationalstaat als Krönung der Schöpfung angesehen, und der Verteidigung der nationalen Interessen wurde absolute Priorität eingeräumt. Der russische Exilhistoriker Georgij Fedotow schrieb 1931 Folgendes über dieses Denken:
Das Vaterland scheint für die Mehrheit der heutigen Europäer die einzige Religion, der einzige moralische Imperativ zu sein, der von der individualistischen Zersetzung rettet. Die Größe des Vaterlandes rechtfertigt jede Sünde, verwandelt jede Niedertracht ins Heldentum.
Dieses Denken verwandelte Europa in ein Pulverfass, das schon zweimal – 1914 und 1939 – explodierte. Erst die Trümmer, die der Zweite Weltkrieg in Europa hinterlassen hatte, führten hier zu einem Paradigmenwechsel. Der bis dahin sakralisierte Nationalstaat wurde zumindest teilweise entthront.
Nicht zuletzt deshalb wirkt die Diktion der heutigen russischen Verfechter der sogenannten „imperialen Revanche“ mit der von ihnen zu einer Art Heiligtum erhobenen russischen Nationalidee so gespenstisch. Hier melden sich Stimmen aus einer Welt zu Wort, die wie Atlantis bereits versunken zu sein schien. Gibt es noch Hoffnung, dass Russland und der Westen in absehbarer Zeit wieder eine gemeinsame Sprache finden würden, wie dies z.B. zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Fall gewesen war, als Thomas Mann noch von der „heiligen russischen Literatur“ sprach?
Ich habe diese Hoffnung noch nicht verloren. Und zwar deshalb, weil Russland nicht nur über nationalistisch-imperiale, sondern auch über freiheitliche Traditionen verfügt. Zwar haftet den russischen Verfechtern dieser letzteren Orientierung, die sich für die „Rückkehr des Landes nach Europa“ einsetzen, das Image der ewigen Verlierer an. Letztendlich stellte es sich aber immer wieder heraus, dass ihre Ziele keineswegs so utopisch waren, wie dies auf den ersten Blick zu sein schien.
Auf einige dieser russischen Kritiker des nationalistisch-imperialen Denkens, die ihre Landsleute dazu aufriefen, sich von der imperialen Bürde zu befreien, möchte ich jetzt eingehen.
Beginnen möchte ich mit dem bereits erwähnten Georgij Fedotow.
Georgij Fedotows antiimperialer Aufruf
Ausgerechnet im Jahre 1947, als Stalin es vermochte, die imperialen Positionen Russlands in einem bis dahin ungekannten Ausmaß zu festigen (dafür verzeihen viele russische Nationalisten dem Kreml-Diktator sowohl die Hungerkatastrophe der 1930er Jahre als auch den Großen Terror) – also ausgerechnet in dieser Konstellation – stellte Fedotow in seinem Aufsatz „Das Schicksal der Imperien“ folgende Prognose über die Entwicklung Russlands nach dem Zusammenbruch des bolschewistischen Regimes auf: In der Zeit, in der sich die Aufmerksamkeit der Russen in erster Linie auf die Abrechnung mit ihren eigenen Henkern richten werde, werde die Mehrheit der nichtrussischen Völker der UdSSR den Austritt aus der Sowjetföderation fordern, den ihnen die sowjetische Verfassung auch garantiere. Dies werde wahrscheinlich einen Bürgerkrieg auslösen, der das Land in zwei beinahe gleich große Teile aufteilen werde – den russischen und den nichtrussischen. Sollten die Russen diesen Bürgerkrieg gewinnen und versuchen, die Völker des Imperiums gewaltsam an sich zu binden, werde dieser Sieg nicht von Dauer sein. Bei Russland würde es sich dann um das letzte Imperium der Erde handeln, und es würde zum Objekt des Hasses aller nach Freiheit strebenden Völker werden. Was die Russen selbst anbetrifft, so würde ihr Versuch, den imperialen Charakter des Landes mit Gewalt zu bewahren, jede Hoffnung auf die innere Befreiung Russlands zerstören:
Ein Staat, der die Hälfte seines Territoriums durch Terror unterdrückt, kann nicht in seiner anderen Hälfte die Freiheit sichern
Aus all diesen Gründen plädiert Fedotow für die Befreiung Russlands von der imperialen Last. Er schreibt:
Der Verlust des Imperiums stellt eine sittliche Reinigung dar, die Befreiung Russlands von einer schrecklichen Bürde, die sein geistiges Antlitz entstellte. Von den militärischen und polizeilichen Sorgen befreit, wird sich Russland seinen inneren Problemen widmen können, vor allem dem Aufbau … einer freien, sozialen und demokratischen Gesellschaftsordnung.
Mit seinem antiimperialen Plädoyer vertrat Fedotow eher eine Außenseiterposition in der russischen Emigration. Sogar für den Philosophen Fjodor Stepun, der, ähnlich wie Fedotow, dem demokratischen Spektrum des russischen Exils angehörte, war der Verzicht auf das Imperium im Sinne Fedotows nicht denkbar
Die Kontroverse um den russischen Messianismus in der sowjetischen Dissidentenbewegung
Dennoch blieb der antiimperiale Aufruf Fedotows keineswegs ungehört. 23 Jahre nach der Veröffentlichung des Aufsatzes „Das Schicksal der Imperien“ konnte man im innerrussischen Diskurs erneut Stimmen vernehmen, die mit einer ähnlichen Vehemenz für den Verzicht Russlands auf seine imperiale Bürde plädierten, wie dies Fedotow getan hatte. In diesem Sinne äußerten sich z. B. einige Vertreter der sowjetischen Dissidentenbewegung, die sich 1970 in der Pariser Exilzeitschrift „Westnik RSChD“ im Artikelzyklus „Metanoia“ (Buße) zu Wort meldeten. Einer der Autoren des Zyklus, der unter dem Pseudonym V. Gorskij schrieb, wiederholte beinahe wortwörtlich die Argumente Fedotows. Man weiß inzwischen, dass es sich bei Gorskij um den Kultur- und Kunsthistoriker Jewgenij Barabanow handelte. Gorskij bzw. Barabanow sagt den unvermeidlichen Zerfall des Sowjetreiches voraus, da es in erster Linie durch den repressiven Apparat des kommunistischen Regimes zusammengehalten werde und dann schreibt er wörtlich:
Nicht nur die osteuropäischen Satelliten, sondern auch das Baltikum, die Ukraine, der Kaukasus und die Völker Zentralasiens werden ihr Recht auf Austritt (aus dem Imperium) zu verwirklichen suchen…. Der Zerfall des Imperiums stellt für Russland weder einen erniedrigenden noch einen unnatürlichen Vorgang dar. Ohne seine Kolonien wird Russland weder ärmer noch politisch unbedeutender. Nach der Befreiung von der Bürde einer Besatzungsmacht wird sich Russland seinen wirklichen Problemen widmen können: dem Aufbau einer freien und demokratischen Gesellschaft.
V. Gorskij, setzt sich allerdings nicht nur mit der imperialen Versuchung Russlands auseinander, sondern auch mit dem russischen Messianismus, mit dem Glauben an die Auserwähltheit der russischen Nation.
Diesen zu Beginn der Neuzeit formulierten Glauben hätten auch die slavophilen Denker geerbt, die das einfache russische Volk als Verkörperung der christlichen Tugenden betrachteten, so Gorskij. Sie seien davon überzeugt gewesen, dass dieses Volk eine gottlose, unchristliche Staatsmacht niemals akzeptieren würde.
All diese Vorstellungen seien, so Gorskij, durch die Ereignisse von 1917 in erschütternder Weise widerlegt worden.
Gorskij hält die „sozialistische Wahl“, die große Teile der Nation 1917 getroffen hatten, für einen bewussten Verzicht auf die Bürde der Freiheit. Mit diesem Verzicht auf Freiheit war nach Ansicht Gorskijs auch der sowjetische Expansionismus verbunden, der nicht nur von den Herrschenden, sondern auch von beträchtlichen Teilen der Bevölkerung mitgetragen wurde:
Das Volk mit einer Sklavenmentalität will auch andere Völker ihrer Freiheit berauben.
Um die Folgen der 1917 begonnenen Katastrophe zu überwinden, müsse sich Russland von der messianischen Versuchung befreien, so lautet das Fazit des Autors. Nicht die imperiale Größe, sondern der Kampf um Freiheit und geistige Werte sollte das Land in erster Linie inspirieren.
Der Sammelband „Stimmen aus dem Untergrund“ als Reaktion auf den „Metanoia“-Zyklus von 1970
Der Ruf nach Buße und nach der Abkehr vom russischen Sendungsgedanken rief im sowjetischen Dissens höchst unterschiedliche Reaktionen hervor. Der u.a. von Alexander Solschenizyn 1974 herausgegebene Sammelband „Stimmen aus dem Untergrund“ (Iz pod glyb) stellte nicht zuletzt eine Antwort auf den „Metanoia“-Zyklus dar.
Mit Entrüstung weist Solschenizyn folgende These Gorskijs zurück:
Als das russische Volk 1917 seine gotteslästerliche Auflehnung begann, wusste es, dass die Verwirklichung der sozialistischen Religion nur auf dem Wege des Despotismus möglich sei.
Woher konnte das Volk dies wissen, fragt Solschenizyn. Habe es etwa über ein ausgeprägtes politisches Bewusstsein verfügt?
Mit anderen Worten Solschenizyn spricht die russischen Soldaten, Arbeiter und Bauern, zumindest in dieser seiner Replik auf Gorskij, von jeder politischen Verantwortung frei, sie werden von ihm nachträglich quasi entmündigt.
Die Tatsache, dass die „Westnik“-Autoren im russischen Sendungsgedanken eine der Ursachen für die Katastrophe von 1917 sahen, entlarvte sie in den Augen von Solschenizyn als Fremdlinge, die mit Russland nichts gemein hätten und die versuchten, das russische Nationalbewusstsein zu untergraben.
Der Diskurs zwischen den Autoren des Sammelbandes „Stimmen aus dem Untergrund“ und den Autoren des Zyklus „Metanoia“ beschränkte sich nur auf eine kleine Schar der sowjetischen „Andersdenkenden“ und schien keine Auswirkungen auf die sowjetische Gesellschaft als solche zu haben. Die bolschewistische Gesinnungsdiktatur kannte, wenn man von den innerparteilichen Auseinandersetzungen der 1920er Jahre absieht, keine Diskurse, sondern nur Monologe der herrschenden Partei, genauer gesagt der Parteiführung.
Als in den 1960er Jahren die sowjetische Bürgerrechtsbewegung entstand, hielten viele Beobachter die Bestrebungen dieser kleinen Schar von Nonkonformisten für eine reine Donquichotterie. Die Bürgerrechtler selbst dachten damals ähnlich. Ihr oft zitierter Trinkspruch lautete bekanntlich: „Trinken wir auf den Erfolg unserer aussichtslosen Sache“.
All das sollte sich nach dem Beginn der Perestroika grundlegend ändern.
Die Erosion der kommunistischen Idee und Russlands „europäische Sehnsucht“
In der russischen Öffentlichkeit entbrannte Ende der 1980er Jahre ein harter Kampf um die Nachfolge der diskreditierten kommunistischen Idee. Er wurde mit einer solchen Schärfe geführt, dass man ihm in Moskau sogar die Bezeichnung der „geistige Bürgerkrieg“ verlieh. Bei diesem Kampf um die geistige Hegemonie im Lande hatten die russischen Nationalisten, die nach einer neuen ideologischen Klammer für das nun erodierende Sowjetreich suchten, mächtige Konkurrenten. Dies waren die prowestlich orientierten Reformer, die Russland, wie sie sagten, „nach Europa zurückführen“ wollten. Nicht der hegemonialen Stellung Russlands in Europa und in der Welt, sondern seiner demokratischen Erneuerung maßen sie die absolute Priorität bei. Damit verstießen sie aber nach Ansicht der Nationalisten gegen die fundamentalen Interessen des Landes. Einer der führenden Ideologen des nationalen Lagers, Alexander Prochanow, schrieb 1990:
Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes, ja in der Weltgeschichte, sehen wir, wie eine Macht nicht infolge von außenpolitischen Rückschlägen oder von Naturkatastrophen zerfällt, sondern infolge der zielstrebigen Handlungen ihrer Führer.
Trotz ihres leidenschaftlichen Engagements für die sogenannten russischen Interessen vermochten indes die militanten Nationalisten keine überragenden Erfolge zu erzielen. Die Mehrheit der Bevölkerung hat ihnen eine Abfuhr erteilt. Dies zeigte sich besonders deutlich bei den russischen Präsidentschaftswahlen vom 12. Juni 1991, bei denen Boris Jelzin auf Anhieb mehr als 57 Prozent der Stimmen erhielt. Eine Nation, die in den Augen vieler Beobachter als die imperiale Nation par excellence gilt, wählte also zu ihrem ersten demokratisch legitimierten Staatsoberhaupt einen Politiker, der sich damals vom imperialen Gedanken expressis verbis distanzierte. Die Hegemonialstrukturen des Sowjetreiches erhielten nun einen Riss an der empfindlichsten Stelle – im Zentrum. Von diesem Schlag konnten sie sich nicht mehr erholen.
Die russischen Demokraten wurden in der letzten Phase der Perestroika zum wichtigsten Verbündeten der nach Eigenständigkeit strebenden Völker an den Rändern des Imperiums. Nach den blutigen Ereignissen in Vilnius und in Riga im Januar 1991, als die sowjetischen Dogmatiker mit Gewalt das Rad der Geschichte zurückdrehen wollten, gingen Hunderttausende von Moskauern auf die Straßen, um dagegen zu protestieren.
Im April 1991 richtete der bekannte polnische Publizist Józef Kuśmierek an Boris Jelzin einen offenen Brief, der folgende Worte enthielt:
Sie sind für die Polen der erste russische Politiker, der im Namen Russlands und nicht im Namen des russischen Imperiums spricht… Sie symbolisieren für mich ein Russland, das ich als Pole nicht fürchten muss.
Die Rückbesinnung auf den russischen „Sonderweg“
Nach dem Scheitern des Putschversuchs der kommunistischen Dogmatiker im August 1991 schien das wichtigste Hindernis, das der Rückkehr Russlands nach Europa im Wege stand, beseitigt. Dennoch erwies sich die Befreiung des Landes von dem etwa 70jährigen totalitären Erbe alsbald als ein äußerst schwieriges Unterfangen. Abgesehen davon muss man noch Folgendes hervorheben:
Als Boris Jelzin und seine Gesinnungsgenossen im August 1991 das imperiale Zentrum und die Diktatur der KPdSU beseitigten, kämpften sie nicht nur unter demokratischen, sondern auch unter national-russischen Fahnen. Die Aufbruchsstimmung, die damals in Moskau herrschte, erinnerte sehr stark an die Atmosphäre der Frankfurter Paulskirche im Jahre 1848, als die Idee der Freiheit und die der Nation eine Symbiose eingegangen waren.
Man muss sich indes vor Augen führen, in welche Richtung sich die deutsche Nationalbewegung weiter entwickeln sollte. Denn das, wonach diese Bewegung strebte, war nicht nur Freiheit, sondern auch Macht: „Die Bahn der Macht ist die einzige, die den gärenden Freiheitstrieb befriedigen und sättigen wird“, erklärte zum Beispiel im September 1848 der liberale Abgeordnete der Frankfurter Nationalversammlung Dahlmann. Und als es sich herausstellte, dass der autoritäre preußische Staat über ein viel wirksameres Instrumentarium als die Paulskirche verfügte, um die Macht Deutschlands zu steigern, hat die Mehrheit der national gesinnten deutschen Demokraten vor ihm kapituliert.
Eine ähnliche Entwicklung begann sich auch in Russland nach der Entmachtung der KPdSU anzubahnen. Viele Demokraten, die sich vor August 1991 für die „Rückkehr“ Russlands nach Europa eingesetzt hatten, begannen sich nun immer häufiger auf den „russischen Sonderweg“ zu besinnen:
Sobald die russischen Westler an die Macht kommen, müssen sie aufhören, Westler zu sein, sagte einer der engsten Mitarbeiter Jelzins, Jewgenij Kozhokin. Eine grenzenlose Verklärung des Westens sei in Russland nur dann möglich, wenn man sich in der Opposition befinde, fügte er hinzu.
Und so begannen sich Russland und der Westen erneut asynchron zu entwickeln. Während der westliche Teil des europäischen Kontinents in den 1990er Jahren an der Schwelle eines postnationalen Zeitalters stand und einen immer tieferen Integrationsprozess erlebte, kehrte das isolierte Russland quasi ins 19. Jahrhunderts zurück und begann den „nationalen Interessen“ eine immer größere Bedeutung beizumessen. Der Moskauer Religionswissenschaftler Dmitrij Furman sprach bereits Anfang 1992 von einer nationalen Woge im Lande, die die demokratische Woge der Perestroika-Zeit abgelöst habe. Beide Wellen hätten eine beinahe unwiderstehliche Kraft an den Tag gelegt.
Die Reaktion der russischen Zivilgesellschaft auf den „ersten“ Tschetschenienkrieg
Die von Furman erwähnte „nationale Welle“ war in der Tat mächtig, aber zunächst nicht allmächtig. Denn die russischen Demokraten, die sich zu den europäischen Werten bekannten, waren keineswegs bereit, ihren national und imperial gesinnten Kontrahenten die Initiative im innerrussischen Diskurs zu überlassen und meldeten sich unentwegt zu Wort. Dies konnte man insbesondere nach dem Beginn der Bestrafungsaktion Jelzins gegen das abtrünnige Tschetschenien im Dezember 1994 sehen. Dass die damaligen Versuche der sogenannten Moskauer „Kriegspartei“ die Bevölkerung zu indoktrinieren, im ersten Tschetschenienkrieg scheiterten, war nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass die Kritiker der Regierungspolitik während des gesamten Krieges, ihren Standpunkt in den Massenmedien verteidigen durften. Den mutigen Journalisten, Menschenrechtlern und Politikern, die der Bevölkerung das wahre Bild des Tschetschenienkrieges zu vermitteln suchten, war es zu verdanken, dass die Moskauer Führung darauf verzichtete, den Krieg bis zum siegreichen Ende zu führen, und sich mit einem Kompromiss begnügte – mit dem Abkommen in der nordkaukasischen Stadt Chasawjurt vom September 1996, das den Krieg praktisch beendete.
Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Schließung der letzten „Fenster Russlands nach Europa“
In einer völlig anderen Konstellation findet der am 24. Februar begonnene Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine statt. Die systematische Aushöhlung und Zerstörung aller pluralistischen Strukturen und unabhängigen Medien im Lande, die in der Gorbatschow- und in der Jelzin-Zeit entstanden waren, stellt den roten Faden der 22jährigen Herrschaft Putins dar. Dieser Prozess wurde am 28. März praktisch vollendet. An diesem Tag hat die „Nowaja gaseta“ ihr Erscheinen vorübergehend eingestellt. Das wohl letzte Fenster Russlands nach Europa wurde praktisch geschlossen. Innerhalb von einigen Wochen hat Putin das Land aus der Moderne, deren Wesen der permanente Diskurs darstellt, quasi herauskatapultiert. Die gespenstische Parallelwelt, die die Putinschen Propagandisten aufgebaut haben, um ihren schändlichen Krieg gegen den westlichen Nachbarn zu legitimieren, lässt sich in den offiziell erscheinenden Medien nicht mehr in Frage stellen. Die Tatsache, dass etwa 80% der befragten Russen diesen zerstörerischen und zugleich selbstzerstörerischen Kurs der Regierung unterstützen, wirkt besonders erschreckend. Dennoch ist das andere Russland, das man als das Gewissen des Landes bezeichnen kann, keineswegs verschwunden. Immer wieder melden sich die unerschrockenen Kriegsgegner zu Wort – sowohl im Lande selbst als auch aus dem erzwungenen Exil. Da die Geschichte Russlands nicht selten zyklisch verläuft, schließe ich nicht aus, dass die Vertreter des „anderen Russland“ in absehbarer Zeit auf die politische Bühne des Landes erneut zurückkehren werden.
Lesen Sie weitere Artikel von Leonid Luks.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
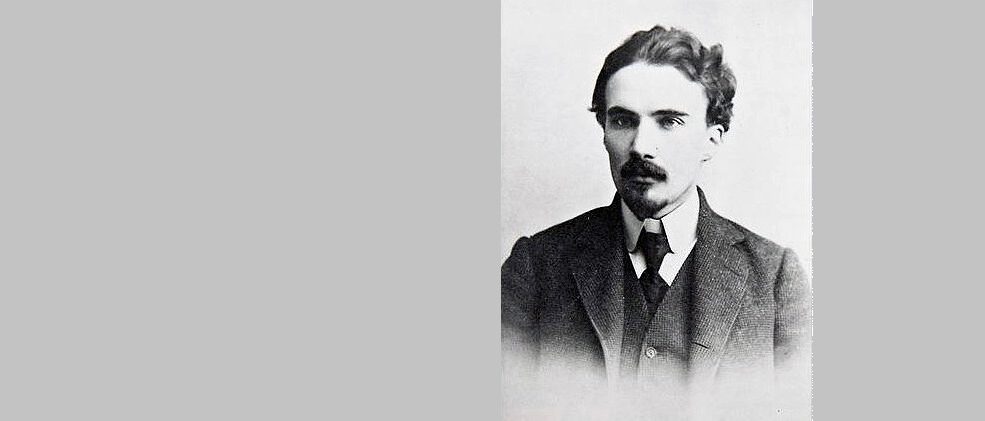

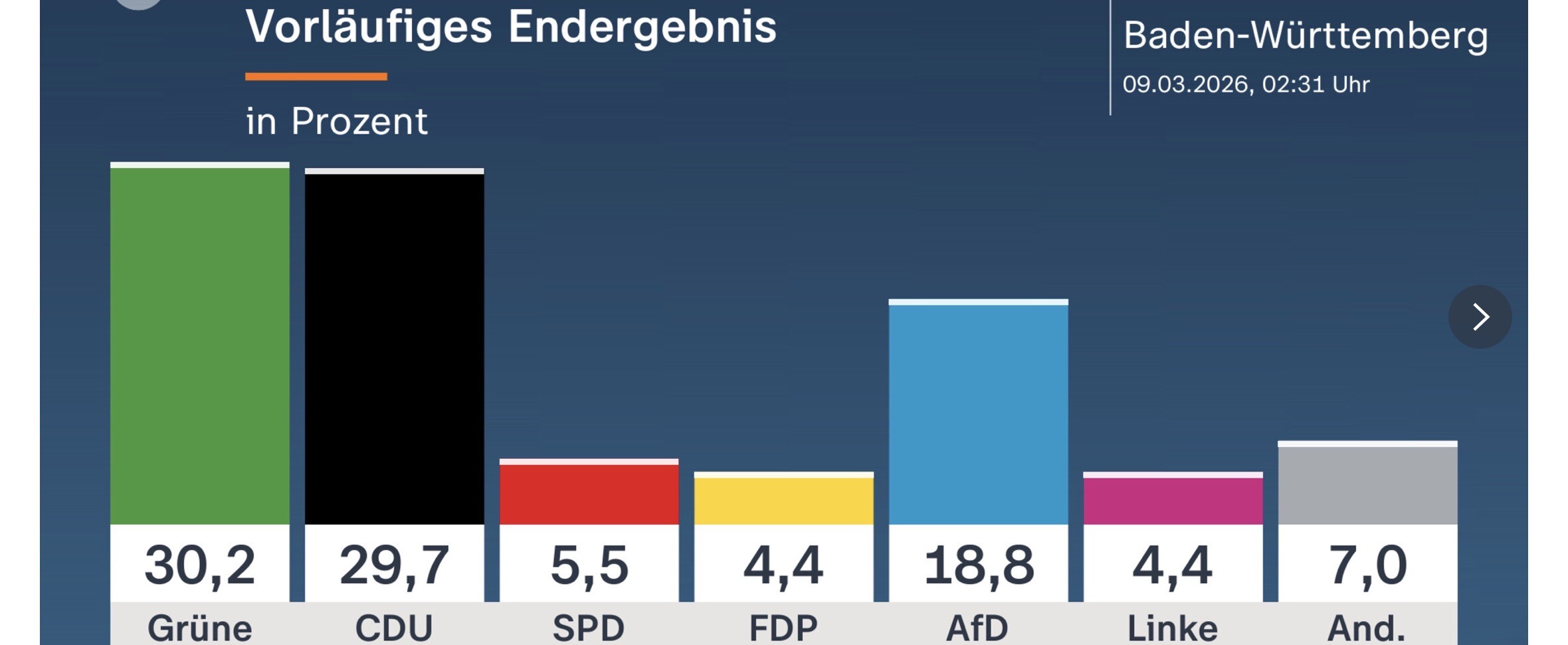


Ihr Kommentar