So richtig warm bin ich mit dem hoch gelobten Schriftsteller Neil Gaiman noch nicht geworden. Sein The Graveyard Book wirkte auf mich arg konstruiert, als habe sich jemand überlegt, wie man die Parabel des Dschungelbuch bei jungen Leuten, die auf Zombies und Vampire stehen, vielleicht doch noch einmal fruchtbar machen könnte, wobei alles über Bord geworfen wurde, was die Tiere als Gegenkultur zum imperialen England in Indien und zur repressiven Dorfgemeinschaft Mowglis als Metapher tatsächlich nachvollziehbar machte. Dabei ist The Graveyard Book aber in jedem Fall kurzweilig geschrieben, es unterhält, und das ist ja schon einiges wert.
So viel Lob und Preis
Einem Autor, der mit Auszeichnungen überschüttet wird, die auch schon dem großen Philip K. Dick zuteil wurden, will ich gern eine weitere Chance geben. Das von ihm selbst als „Author’s prefered Text“ hervorgehobene und für die „Tenth Aniversary Edition“ mit einem ausgedehnten Vorwort versehene American Gods schien der Prüfstein, an dem sich Gaimans literarische Fähigkeiten am ehesten erproben ließen. Um vorzugreifen: American Gods enttäuscht.
Negative Kritiken zu dem Roman, den Gaiman explizit als eine Erkundung dessen, was Amerika ausmacht, verstanden wissen will, sozusagen als seinen Anlauf zu einer „Great American Novel“, finden sich bis heute jedoch kaum. Nur auf Amazon wird auffallend oft darauf hingewiesen: Die Idee sei gut, sonderlich gut ausgeführt sei sie nicht.
Gute Idee, schlechte Ausführung?
Die Idee ist die folgende: Götter entstehen durch den Glauben derer, die sie verehren. In die vereinigten Staaten brachten Einwanderer seit 14.000 Jahren ihre Götter mit. Doch die USA als „melting pot of nations“ ist „ein schlechter Ort für Götter“. Verlassen schlagen sich die überirdischen Entitäten in der modernen Welt nun gerade so durch, hier und dort versuchen sie ein wenig Glauben anzufachen, denn dieser erhält sie am Leben, wie Peter Pans Fee Glöckchen das Klatschen der Kinder. Wie gut die Idee ist, oder besser, ob das Konzept trägt, entscheidet sich allerdings erst in der Ausführung.
An dieser ist zu allererst ähnlich wie schon bei Philipp Pullmans His Dark Materials mythologische und theologischen Uninformiertheit, wenn nicht gar ein Desinteresse an den Stoffen zu bemängeln, die Gaimans Erzählung zu Grunde liegen. Den alten Göttern der Einwanderer (warum auch immer: vor allem Nordische, Odin, Loki, usw.) stellt Gaiman neue Götter gegenüber, darunter das Internet oder die totale Vernetzung, den Markt, das Fernsehen. Erfrischend durchaus, dass zum Schluss nicht die Alten gegen die neuen Götter ins Recht gesetzt werden, witzig vielleicht noch, wie die Eisenbahn und auch Elvis Presley, der mit dem Zwerg Ylvis identifiziert wird, der Tradition und nicht der Moderne zugeschlagen werden. Doch wieso Menschen glauben, was Menschen glauben und was glauben und Glauben unterscheiden könnte thematisiert Gaiman nicht einmal in Ansätzen. Was Animismus etwa in der Verehrung eines Steins, die Verehrung früher Naturgottheiten, die kaum etwas anderes sind als die Naturgewalten selbst, und den komplex aufeinander bezogenen griechischen Pantheon in seiner noch geglaubten und in seiner bereits mythologisch stillgelegten Form voneinander unterscheiden könnte, berührt ihn nicht. Die griechischen Götter, nachdem er an ihnen zuvor noch die Frage aufgeworfen hat, ob man früher im Umland Athens tatsächlich Göttern begegnete, vergisst Gaiman gar ganz, wo es doch durchaus erkenntnisstiftend hätte sein können, sie dem so genannten Nordpantheon (so im Buch), der in American Gods eine dominante Rolle einnimmt, gegenüberzustellen.
Die „Göttin der Weisheit“ etwa, der „Strategie und des Kampfes, der Kunst, des Handwerks und der Handarbeit“, zumal die Göttin jener Wiege der Zivilisation, Athen – Athene, wurde als Ideal doch so vieler rein körperlicher Tätigkeiten aus dem Kopfe Zeus geboren, verkörpert der Vorstellung nach u.a. den Geist. Darin aufgehoben findet sich die Vergeistigung kultureller Tätigkeiten, auch wo sie körperlich sind. Solcherart erkenntnisgeleiteten Mythos, Mythos als Aufklärung, vermag sich Gaiman nicht vorzustellen.
Angst vor Monotheismen?
Entsprechend traut er sich auch an die Monotheismen kaum heran, Judentum, Christentum, Islam: gut möglich, dass deren Götter und Propheten fehlen, weil Gaiman die Auseinandersetzung scheute. Ebenso nahe liegt aber, dass er nicht fähig gewesen wäre insbesondere die dialektische jüdische und christliche Theologie, letztere eng an Aristoteles und Platon gebunden, mit den Göttern seiner Konzeption zu konfrontieren.
Für Gaiman in American Gods ist Glauben gleich glauben. Und selbst wo glauben mit Glauben nichts zu tun hat wird jeder Unterschied nivelliert. Einsichtig ist noch, dass Götter im Glauben Macht erhalten, die über die gläubigen Individuen hinausweist. Gesellschaft verselbstständigt sich. Der Einzelne wird womöglich zum Spielball der Verhältnisse. Doch an Odin glaubt man anders, als man das Internet oder den Markt verehrt. Ersterer ist immateriell, wo kein Glaube und nicht ausreichend Gläubige, da kein Gott. Die beiden neuen „Götter“ nach Gaiman sind materiell in dem Sinne, als dass man ohne Glauben dennoch innerhalb ihrer handelt, so zu ihrem Bestehen beitragend. Und der Markt z.B. bleibt dem Netz stets übergeordnet: Ja, es gibt Leute die lesen Hayek als läsen sie die Bibel. Doch noch der überzeugteste Antikapitalist lebt in der Marktwirtschaft nach dem Markt. Basta.
Aber sollte man religionstheoretische Schwächen einem Werk vorhalten, dass doch zuerst als literarisches zu überzeugen hätte? Andererseits, kann ein Werk, das in erster Linie Religionsvorstellungen und die Verhältnisse der Menschen zu ihnen und zu Amerika verhandeln soll mit solchen inhaltlichen Schwächen literarisch überzeugen? In der englischen Wikipedia wird American Gods als ein Exponat des amerikanischen magischen Realismus gehandelt. Den magischen Realismus habe ich mehrfach in unterschiedlichen Formulierungen als eine Art zu schreiben charakterisiert, in der das Übernatürliche als Handlungselement in Erscheinung tritt und gleichzeitig als Metapher fungiert. Etwa wenn in Garcia Marquez‘ Hundert Jahre Einsamkeit Remedios die Schöne in den Himmel auffährt, als sei es das natürlichste der Welt.
Zum „Magischen Realismus“
Hinzuzufügen wäre vielleicht des weiteren, dass magischer Realismus sich um die Kohärenz seiner magischen Elemente einen feuchten Kehricht scheren muss, da die Real-Metapher immer auch eine realistische Lesart erlaubt, als nur metaphorisch magisches Moment im kollektiven oder persönlichen Erlebnis von Figuren der Erzählung. Das unterscheidet, wo man unterscheiden will, grob magischen Realismus von Fantasy, die entweder im Ganzen als metaphorisch oder als geschlossenes System zu lesen ist. In American Gods versucht sich Gaiman beide Wege offen zu halten, was er so auch in einigen beinahe schon unverschämt zu nennenden Leseranreden postuliert.
Hier ist offenkundig der Wunsch Vater des Gedanken. Denn regelmäßig erlaubt American Gods nur jene eine Lesart, in der die alten und neuen Götter tatsächlich um die Herrschaft über die Menschheit kämpfen. Besonders deutlich zeigt sich das in einer Kleinigkeiten, die man naturgemäß leicht überliest. Etwa: Nachdem er tief genug in das Spiel der Götter hineingesogen wurde, und immer noch nicht Bescheid weiß, was genau eigentlich mit ihm passiert, denkt Protagonist Shadow darüber nach, sich umzubringen. Bekannt ist ihm allerdings schon, dass seine verstorbenen Frau seit ihrem Tod als lebender Leichnam noch immer auf der Erde wandelt, und damit Selbstmord als Ausweg wohl flach fällt. Wie kann es aber sein, dass Shadow dann den Selbstmord überhaupt noch ins Auge fasst? Auf der anderen Seite: Wenn bis hierhin alles symbolisch zu denken gewesen wäre – wäre dann der Selbstmord real?
Auch den geschätzten Kollegen von Ferret-Brain fällt der Unterschied zwischen Gaimans Texten und dem, was man unter magischem Realismus versteht, ins Auge. Kyra bringt das in einer enthusiastischen Besprechung von Pan’s Labyrinth auf den Punkt:
Myths, fairytales and folktales on their most basic level have always been mechanisms for understanding the world, and Ofelia’s is no different Her fantasy world is informed by, and a reflection of, the real world, growing in darkness and complexity as Ofelia begins to notice and struggles to comprehend the horrors that surround her. And, one in the eye for people who keep thrusting down our throats the notion that fairytales are dark, man dark (*cough* Gaiman *cough*), no matter how dark and dirty Ofelia’s world may be it will always be preferable to the horrors of the real world in which the only real hope of redemption and escape is death, and the only victories can be small and personal ones (…) Ofelia’s world mirrors her growing understanding and fear of reality, and symbols and images echo through them both.
Neil Gaiman, scheint es mir, hat dagegen hier einfach kein tieferes Interesse an den Stoffen, die er bearbeitet. Er weiß genau, was ankommt. Und baut auf „coolen“ Prämissen ein sicher nett zu lesendes Werk auf, das nicht hält was es verspricht. Wer nun trotzdem einen Gaiman lesen möchte: The Graveyard Book ist kurzweiliger. The Ocean at the End of the Lane auch. Oder Coraline. Oder… Sie sehen sicher, worauf ich hinaus will.
+++
Lesen Sia auch: Clemens Meyers absurde Literaturpreis-Beschwerde
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

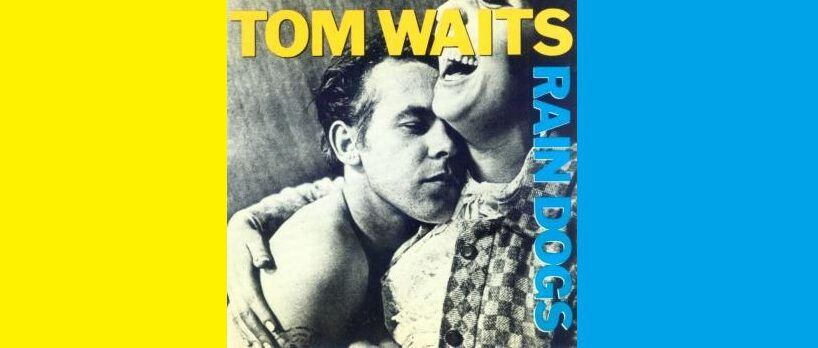


Ihr Kommentar