Ende Mai habe ich den kanadischen Premierminister Justin Trudeau an dieser Stelle als smarten Sonnyboy gedisst, der zwar gut reden und perfekt auf dem politischen Zeitgeist surfen kann, der aber bisher nichts geleistet hat, was den allgemeinen Hype um ihn rechtfertigen würde. Eines habe ich damals schon zugestanden: Kein Politiker weltweit formuliert derzeit so Medien – und vor allem Social Media – tauglich wie der Regierungschef aus Ottawa. Auch zum europäischen Geiere um das Freihandelsabkommen CETA fand der Jungdynamiker die passenden Worte: „Wenn es sich zeigt, dass Europa unfähig ist, einen fortschrittlichen Handelspakt mit einem Land wie Kanada abzuschliessen, mit wem glaubt Europa dann noch Geschäfte machen zu können?“
In der Tat habe ich Kanada stets als Land erlebt, dass den Werten der Europäischen Union näher steht als jeder andere außereuropäische Staat (einige Regionen eingeschlossen, die geographisch dem europäischen Kontinent zuzurechnen sind). Anders als in den USA gibt es zwischen Neufundland und Vancouver einen funktionierenden Sozialstaat, eine transparente Verwaltung sowie eine passable öffentliche Daseinsvorsorge. Man wird in Krankenhäusern behandelt, ohne vorher die Kreditkarte zu zeigen oder dem Personal Briefumschläge mit freundlichem Inhalt zuschieben zu müssen. Im Unterschied zu manchen Ecken Europas funktionieren im hohen Norden Amerikas sogar die Finanzämter und das Katasterwesen. Die Marktwirtschaft ist in Kanada ziemlich sozial abgefedert, die Unabhängigkeit der Justiz allgemein anerkannt. Aus allen diesen Gründen hätte ich hohes Vertrauen in Fairness und Vertragstreue der Kanadier.
Kanada steht Europa näher als jemand sonst
Nun bin ich weder Jurist, noch Experte für internationale Handelsabkommen. Aber was ich bislang über CETA gelesen habe, reicht nicht aus, um mir nächtelang den Schlaf zu rauben. Es wird beispielsweise betont, dass weder Umwelt- noch Sozialstandards gesenkt würden. Weder wird der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen das Wort geredet, noch verhindert CETA, dass private Dienste kommunalisiert werden können. Und sollte es dennoch inhaltliche Differenzen zwischen den europäischen und kanadischen Vorstellungen geben, dann wäre Trudeaus sozialdemokratische Regierung wohl die letzte auf dieser Welt, mit der sich nicht darüber verhandeln ließe. Aber vielleicht sind manche europäischen Befindlichkeiten ja postfaktisch, um einen aktuellen Modebegriff zu gebrauchen. Man kann jedenfalls Trudeau und seine zuständige Handelsministerin verstehen, wenn sie sich von der europäischen Kakophonie und manchen lokalen Extravaganzen zunehmend genervt zeigen.
Nach dem der europäische Berg lange genug um CETA gekreist war, sah es zuletzt so aus, als wolle die Regionalregierung der Wallonie sogar die Geburt einer Maus verhindern. Die Wallonie? Nun kennen sich Kanadier meinen Erfahrungen nach nicht besonders gut mit kleineren europäischen Regionen aus. Und aus geopolitischer Perspektive schien dieser südliche Teil Belgiens bislang in der Tat vernachlässigenswert. Der Landstrich mit seinen gut dreieinhalb Millionen Einwohnern – das entspricht in etwa der Bevölkerung der kanadischen Stadt Montreal – hat sich im letzten halben Jahrhundert zu so etwas wie dem belgischen Mezzogiorno entwickelt. Dank Kohle und Stahl waren die Wallonen lange Zeit der dominierende Landesteil. Dementsprechend hoch trugen sie die Nase – insbesondere gegenüber ihren flämischen Landsleuten, die sie als bäurisch ansahen. Französisch galt als die Sprache der Eliten, flämisch war das Idiom der Underdogs. Und so mussten sich flämische Rekruten in der belgischen Armee einst auf französisch kommandieren lassen.
Absteigerregion Wallonie
Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Nach dem Niedergang der Montanindustrie ist den Wallonen nie ein echter Strukturwandel gelungen, ein bis heute andauernder wirtschaftlicher Niedergang setzte ein. Flandern dagegen boomt. Nicht selten müssen Wallonen inzwischen der Jobs wegen gen Norden ziehen.
Aus flandrischer Sicht stellt sich das innerbelgische Verhältnis inzwischen so dar: Die Flamen finanzieren mit ihren wirtschaftlichen Erfolgen die Wallonie, wo viele Bürger dennoch dem alten Überlegenheitsglauben und einer teils unverständlichen Staatsgläubigkeit verhaftet sind. Die Wallonen wiederum fühlen sich als Globalisierungsverlierer.
Der Dauerzwist zwischen den beiden Landesteilen führte zeitweise dazu, dass in Belgien monatelang keine Regierung gewählt werden konnte. Außerdem stellen flandrische Politiker, die keine Steuergelder mehr in den Süden abführen wollen, regelmäßig die Separationsfrage. Mehrmals schon drohte das Belgische Königreich am Regionenstreit zu zerbrechen. Es heißt, der König und die Fußballnationalmannschaft sind die einzigen Institutionen, die das Land noch zusammenhalten.
Die Maus, die brüllte
Und so dürfte die wallonische Blockadehaltung gegenüber CETA auch Teil eines innerbelgischen Machtpokers sein. Sei es um die Preise beim Verteilungskampf mit Flandern in die Höhe zu treiben, sei es um endlich mal wieder die alte Power auszuspielen. Umso wirkungsvoller das Ganze, wenn die Wallonen mit ihrem Veto gleich die komplette EU de facto zur Geisel nehmen können. Es ist zwar eine Maus, die da brüllt, dennoch wären machtpolitische Motive wenigstens rational nachvollziehbar.
Allem Machiavellismus zum Trotz: Gerade bei den Wallonen stecken Vorbehalte gegen die Globalisierung tief in der DNA. Befeuert wird diese Haltung auch von konservativ denkenden Gewerkschaften, die zum Teil mit Schuld am Niedergang einer einstigen Wohlstandsinsel sind. Und so zeigt das Beispiel Wallonie, wie Abschottung, ein Verharren in alten Denkschemata und völlig unbegründetes Überlegenheitsdenken einen echten Strukturwandel verhindern können. Dass man wirtschaftliche Umbrüche nicht gottgegeben und larmoyant hinnehmen muss, haben etwa Bayern, Teile des Ruhrgebiets, die polnische Region Schlesien, die schottische Industriemetropole Glasgow – und eben auch Flandern – gezeigt. Die Bayern haben inzwischen neben der Lederhose auch den Laptop im Repertoire, an der Ruhr gibt es spannende Wissenschaftseinrichtungen, in Schlesien werden Autos gebaut und Glasgow profiliert sich als Kunst und Kultur-Hotspot sowie als High-Tech-Labor. Das alles funktioniert gerade dank globaler Impulse.
Die Alternative heißt Protektionismus
Wer dagegen ähnlich den Wallonen Freihandel blockiert, sollte bedenken, dass die Alternative Protektionismus heißt. Unabhängig davon, dass man damit an der Seite von Mister Trump, Madame Le Pen, Herrn Gauland oder Frau Wagenknecht im Team spielt, hat wirtschaftliche Abschottung den Nationen nie etwas Gutes gebracht. Der Aufbau von Handelsbarrieren vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs ist ein beredtes Beispiel dafür. Zum Aufbau von Wohlstand bei breiten Bevölkerungsschichten hat dieser Ansatz eher nicht beigetragen.
Die Wallonen täten deshalb gut daran, sich zu erinnern, dass ihr Aufstieg zum Industriestandort – wie eigentlich überall in Westeuropa – gerade von einem wachsenden internationalen Handel begünstigt wurde. Eine Rückkehr zu diesen Wurzeln und zu mehr Unternehmergeist stünde Belgiens Süden nicht schlecht an. Vielleicht könnten wallonische und andere Freihandelsgegner auch etwas von Justin Trudeaus, sicher sehr nordamerikanischem, quasi-naivem Optimismus annehmen. Es schadet jedenfalls nicht, erst einmal die Chancen und nicht gleich die Probleme oder gar eine Weltverschwörung zu sehen.
Man muss EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nicht mögen, aber in einem hat er recht: Wenn Europa kein Handelsabkommen mit Kanada zustande bekommt, erscheint es unmöglich entsprechende Vereinbarungen mit anderen Teilen der Welt abzuschließen. Und das wäre tatsächlich ein fatales Signal für einen Kontinent, der wirtschaftlich einmal tonangebend in der Welt war.
Globalisierung aktiv gestalten
CETA ist sicher nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber es könnte eine starkes Signal setzen, an dem sich künftige Handelsvereinbarungen zu orientieren hätten. Vor allem könnte Europa die Botschaft aussenden, dass es Globalisierung weiter aktiv gestalten will, anstatt sich als Player der Weltwirtschaft abzumelden. Denn die Globalisierung wird im Zeitalter von Digitalisierung und Internet eher noch schneller voranschreiten, egal ob Populisten das schlecht finden und egal, was immer eine wallonische Provinzregierung dazu beschließen mag. Und eines ist gewiss: Wer unvermeidliche Entwickelungen nicht selbst mit beeinflusst, läuft Gefahr, am Ende von anderen gestaltet zu werden.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
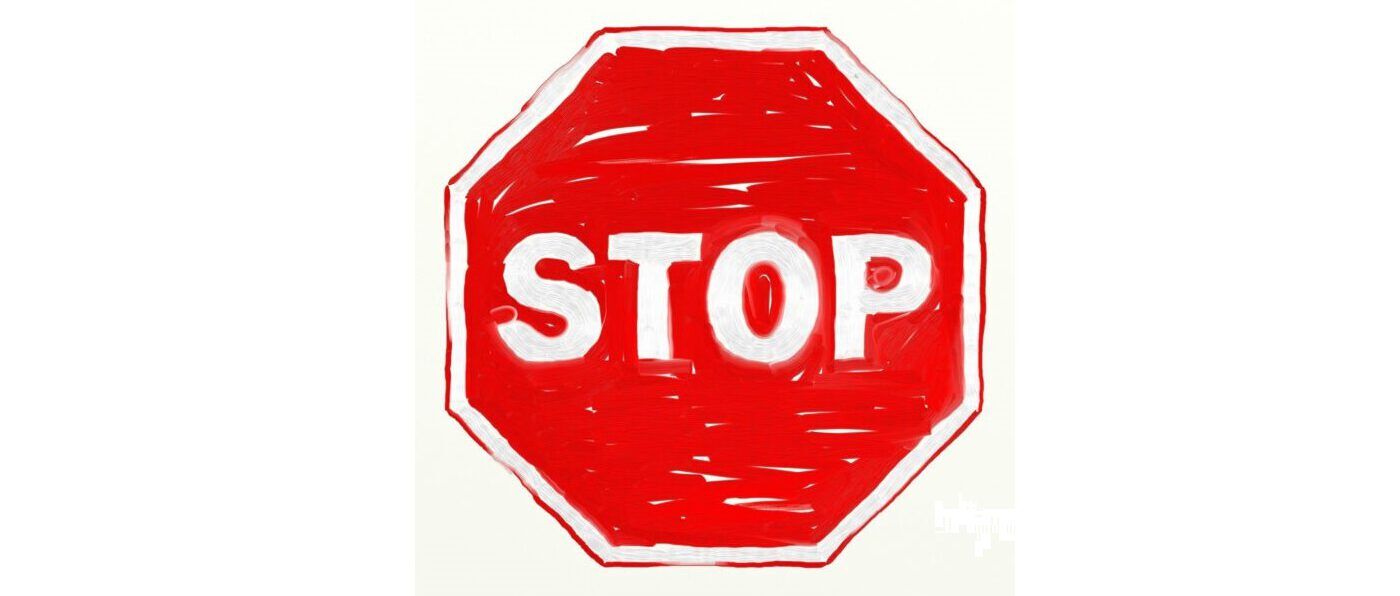
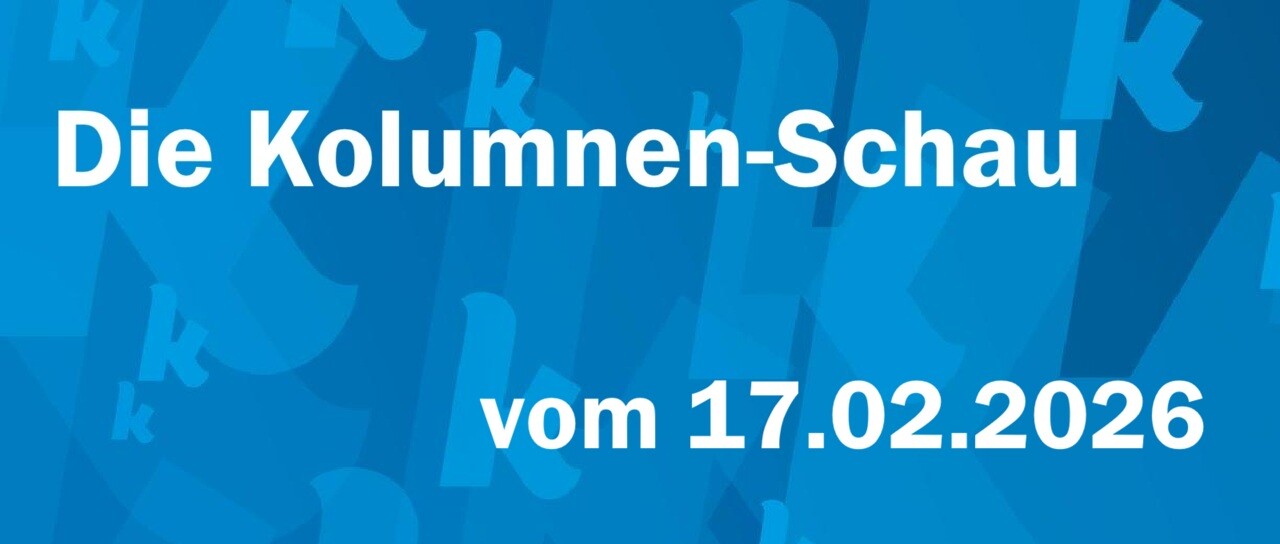

derblondehans
… nun ja, dass Kanada, Deutschland und andere die ‚Globalisierung‘ gestalten, puuuh, wer glaubt das denn? Nix gegen einen ‚freien Handel‘ zwischen den Nationen zum Vorteil aller. Im Gegenteil.
Das kann ich bei CETA (und TTIP) nicht erkennen. Anders, CETA (und TTIP) sind Abschottung gegenüber anderen. Zum Beispiel Afrika. Oder?
CETA (und TTIP) übertragen, ähnlich der alternativlosen Bankenrettung, EFSM, EFSF, ESM, usw., unternehmerische Risiken auf den Steuerzahler. Das nennt sich Sozialismus. Gewinne privatisieren, Verluste sozialisieren.