Russland nach 1991 und „Weimar“: Parallelen und Kontraste
Kurz nach der Auflösung der UdSSR gehörten Vergleiche zwischen Russland und Deutschland zum ständigen Repertoire der Publizistik in Ost und West. Dies betraf insbesondere den Vergleich zwischen dem postsowjetischen Russland und der Weimarer Republik. Die Ähnlichkeiten sind auf den ersten Blick in der Tat verblüffend. Wie in der Weimarer Republik assoziiert sich im postkommunistischen Russland die Demokratie mit dem Zusammenbruch der hegemonialen Stellung des Landes auf dem europäischen Kontinent, mit dem Verlust von Territorien und mit der Entstehung einer neuen Diaspora. Zur nationalen Demütigung gesellte sich in beiden Fällen eine tiefe Wirtschaftskrise. Nicht zuletzt deshalb wurde im Russland-Diskurs in Ost und West seit dem Beginn der 1990er Jahre oft der Begriff „Weimarer Russland“ verwendet. Trotz all dieser Parallelen wurden indes einige grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Konstellationen oft außer Acht gelassen.
So handelt es sich bei Russland, auch nach der Beendigung des Kalten Krieges, der offiziell keine Sieger und keine Verlierer kannte, um eine der stärksten Militärmächte der Welt, die als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates der UNO das Weltgeschehen entscheidend mitprägt. Die Weimarer Republik hingegen war durch die Restriktionen des Versailler Vertrages zur militärischen Ohnmacht verurteilt und hatte nur einen begrenzten Einfluss auf die Gestaltung der internationalen Ordnung. Zwar träumten manche Weimarer Politiker, ähnlich wie die „Nationalpatrioten“ im postsowjetischen Russland, von einer territorialen Revanche. Solche Alleingänge wie die Putinsche Annexion der Krim hätten sie aber niemals gewagt.
Dennoch handelt es sich beim Krim-Coup Putins um einen Pyrrhussieg. Putin habe zwar einen taktischen Erfolg erzielt, strategisch habe er allerdings alles verloren – so kommentierte die Krim-Annexion der am 27. Februar 2015 ermordete russische Regimekritiker Boris Nemzow.
Und in der Tat – die rücksichtslose Machtpolitik im Namen der sakralisierten nationalen Interessen verstößt derart eklatant gegen den postnationalen europäischen Mainstream, dass Russland nun erneut Gefahr läuft, den Anschluss an die Moderne zu verlieren.
Der „Platz an der Sonne“?
Das Putinsche Russland tritt als eine „gekränkte Großmacht“ auf, die nach dem aus ihrer Sicht ihr gebührenden „Platz an der Sonne“ sucht. Als ihren größten Kontrahenten betrachtet die Kreml-Führung dabei bekanntlich die Vereinigten Staaten, denen sie vorwirft, sie seien nicht bereit, die Interessen anderer souveräner Staaten zu respektieren. Die USA versuchten, so lautet der Vorwurf, der gesamten Welt eine politische Ordnung aufzuzwingen, die nur den Interessen Washingtons entspreche. Die Verteidiger der „gelenkten“ bzw. „souveränen“ russischen Demokratie gebärden sich in diesem Disput als Verfechter einer neuen multipolaren Weltordnung, als Wortführer der nach Souveränität strebenden Völker, die sich angeblich nach einer Befreiung von der amerikanischen Hegemonie sehnten.
Und hier bietet sich wieder eine deutsch-russische Parallele an, allerdings nicht mit der militärisch ohnmächtigen Weimarer Republik, sondern mit dem Wilhelminischen Reich. Denn die Argumentation der Putin-Riege ist derjenigen der politischen Klasse des Wilhelminischen Reiches nicht unähnlich. Damals ging es aber um eine angebliche „Befreiung“ der Völker von der „britischen Welthegemonie“. Deutschlands Mission sei die Emanzipierung der Welt von der englischen Dominanz, schrieb damals der deutsche Historiker Otto Hintze. Nur eine Mobilisierung des gesamten europäischen Machtpotentials konnte, nach Meinung mancher deutschen Autoren, der englischen Vorherrschaft ein Ende setzen. Nicht zuletzt deshalb hielten sie die Idee von einem europäischen Gleichgewicht für veraltet. Sie sei englischen Ursprungs und diene lediglich den englischen Interessen.
Dieser Versuch, die europäischen Völker, natürlich unter deutscher Führung, zu einigen, um sich gegen die englische Weltherrschaft zu wehren, sei aber gänzlich gescheitert, so der Historiker Ludwig Dehio. In Wirklichkeit habe niemand etwas von dieser Befreiungsmission der Deutschen wissen wollen. England sei es gelungen, gerade dieses europäische Gleichgewicht, das angeblich den Interessen der Europäer widersprach, gegen Deutschland zu aktivieren. Nicht englische, sondern deutsche Hegemonialbestrebungen habe man in Europa als Bedrohung empfunden.
Nicht anders erging es Putin mit seinem antiamerikanischen Kurs. Statt einen Keil zwischen die EU und die USA zu treiben, löste er durch seine aggressive Ukraine-Politik einen für viele unerwarteten Solidarisierungseffekt beinahe aller demokratisch regierten Staaten diesseits und jenseits des Atlantiks aus, und dies trotz der ausgeprägten Skepsis der Europäer gegenüber den Alleingängen Washingtons, zum Beispiel in der NSA-Affäre:
Russland hat … keinen einzigen Verbündeten“ in diesem neuen Konflikt zwischen Ost und West, sagte 2018 der Moskauer Politologe Dmitri Trenin: „Niemand hat sich Russland angeschlossen.
Die russozentrische und aggressive Außenpolitik der Kreml Führung führt außerdem nicht nur zu einer Entfremdung zwischen Moskau und dem Westen, sondern auch zu Spannungen zwischen Russland und manchen autoritär regierten Staaten im postsowjetischen Raum, auf deren Territorien sich russische Minderheiten befinden. Auch sie sind durch das Vorgehen Moskaus in der Ukraine beunruhigt. Dies betrifft sogar Kasachstan, dessen Präsident Tokajew vor kurzem Moskau flehentlich um Unterstützung gegen die Rebellion im eigenen Lande bat. Und der Vorgänger Tokajews, Nursultan Nasarbajew, wandte sich mehrmals entschieden gegen alle Versuche mancher national gesinnten russischen Politiker, die territoriale Integrität Kasachstans in Frage zu stellen.
Moskaus Anspruch, als Interessenvertreter der russischen Minderheiten jenseits der Grenzen der Russischen Föderation aufzutreten, erinnert in gewisser Weise an ähnliche Bestrebungen national gesinnter Gruppierungen im Wilhelminischen Reich, die sich um die Belange der deutschen Minderheit im Zarenreich kümmerten. Ihre laut bekundeten Proteste gegen die Russifizierungsmaßnahmen der Petersburger Regierung, nicht zuletzt in den Ostseeprovinzen, trugen damals erheblich zur Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen und zur Festigung des russisch-französischen Bündnisses bei. Solange Bismarck noch an der Macht war, lehnte er jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Zarenreiches ab. Die Aufrechterhaltung freundschaftlicher Beziehungen mit Petersburg war für ihn wichtiger als die Verteidigung der Belange der Auslandsdeutschen. Obwohl er die deutsche Nationalbewegung geschickt für die machtpolitischen Interessen des herrschenden Establishments ausnutzte, war er eben doch kein klassischer Nationalist. Bismarcks Nachfolger wollten indes von der Zurückhaltung des Reichsgründers nichts mehr wissen.
Die Motive der Reichsführung wurden den anderen europäischen Kabinetten immer weniger verständlich. Die beiderseitigen Ängste verhärteten nur die Fronten und das Wettrüsten (der „trockene Krieg“, wie der deutsche Historiker Hans Delbrück den damaligen Rüstungswettlauf nannte) wurde fortgesetzt.
Der Paradigmenwechsel nach 1945
Es bestehen allerdings einige grundlegende Unterschiede zwischen der damaligen und der heutigen Konstellation. Sie betreffen in erster Linie die Lehren, die eine beträchtliche Zahl der Europäer von heute aus der Geschichte des vor kurzem zu Ende gegangenen „kurzen“ 20. Jahrhunderts gezogen haben. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Nationalstaat als Krönung der Schöpfung angesehen, und der Verteidigung der nationalen Interessen wurde absolute Priorität eingeräumt. Dieses Denken verwandelte Europa in ein Pulverfass, das zweimal – 1914 und 1939 – explodierte. Erst die Trümmer, die der Zweite Weltkrieg in Europa hinterlassen hatte, führten hier zu einem Paradigmenwechsel. Der bis dahin sakralisierte Nationalstaat wurde zumindest partiell entthront, es begann der europäische Integrationsprozess, der den Europäern eine der längsten Friedenperioden ihrer Geschichte sicherte (der Krieg im ehemaligen Jugoslawien gehörte hier insoweit zu den wenigen Ausnahmen).
Russlands „europäische Sehnsucht“
Auch viele russische bzw. sowjetische Reformer begannen sich seit der Gorbatschowschen Perestroika zu den europäischen Werten zu bekennen. Ihr ausdrückliches Ziel war die „Rückkehr ihres Landes nach Europa“. Das „politische Wunder“ der friedlichen Revolutionen von 1989, die Überwindung der europäischen Spaltung und die deutsche Einheit wären ohne diese „Sehnsucht“ und ohne den Verzicht des Reformflügels in der Gorbatschow-Equipe auf die „Breschnew-Doktrin“, die der Gorbatschowschen Idee vom „gemeinsamen europäischen Haus“ eklatant widersprach, undenkbar gewesen. Wolfgang Schäuble, der als Bundesinnenminister den Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands aushandelte, schrieb in seinen Erinnerungen, dass der deutsche Einigungsprozess nur mit der Duldung der Sowjetunion, und nicht gegen sie möglich gewesen sei.
Nach dem Scheitern des Putschversuchs der kommunistischen Dogmatiker vom August 1991 und nach dem Verbot der KPdSU schien das wichtigste Hindernis, das der „Rückkehr Russlands nach Europa“ im Wege stand, beseitigt. In der politischen Klasse des Landes dominierten damals prowestliche Orientierungen. Mitte 1992 bezeichnete der russische Staatspräsident, Boris Jelzin, die westlichen Länder als „natürliche Verbündete Russlands“.
Indes erwies sich die Befreiung Russlands von dem etwa 70jährigen totalitären Erbe alsbald als ein äußerst schwieriges Unterfangen. Und wie die deutsche Erfahrung nach 1945 zeigt, ist eine nachhaltige Bewältigung von einem solchen Erbe ohne eine massive Unterstützung von außen kaum denkbar. Von einer vergleichbaren Unterstützung träumten auch viele Reformer in der Mannschaft Jelzins. Sie dachten an eine Art Marshallplan zur Unterstützung der russischen Transformationsprozesse und hielten sogar den Beitritt Russlands zur NATO für eine realistische Option. All diese Erwartungen hätten sich als eine naive Illusion erwiesen, sagte vor kurzem einer der engsten Mitarbeiter Jelzins, Gennadij Burbulis. Einige Vertreter des westlichen politischen Establishments erlagen damals der Versuchung, Russland als Verlierer im Kalten Krieg zu betrachten, und nutzten die zu Beginn der 1990er Jahre noch bestehenden Möglichkeiten nicht aus, um Russland nachhaltig in wirtschaftliche und sicherheitspolitische Strukturen des Westens einzubinden, was zusätzlich zur Erosion der „zweiten“ russischen Demokratie beitrug. Selbstverständlich hat das Scheitern des im August 1991 in Russland errichteten Systems in erster Linie innerrussische Ursachen (wirtschaftliche Schocktherapie, scharfe Konflikte an der Spitze der Machtpyramide, die Tschetschenien-Kriege und vieles mehr). Aber auch außenpolitische Faktoren spielten dabei eine wichtige Rolle.
Die Tatsache, dass die von Michail Gorbatschow lancierte Idee vom „gemeinsamen europäischen Haus“, ungeachtet der Entmachtung der KPdSU, nicht verwirklicht werden konnte, führte dazu, dass Russland und der Westen sich erneut asynchron zu entwickeln begannen. Während der westliche Teil des europäischen Kontinents in den 1990er Jahren bereits an der Schwelle eines postnationalen Zeitalters stand und einen immer tieferen Integrationsprozess erlebte, kehrte das isolierte Russland quasi ins 19. Jahrhundert zurück und begann den „nationalen Interessen“ eine immer größere Bedeutung beizumessen. Der Moskauer Religionswissenschaftler Dmitri Furman sprach bereits Anfang 1992 von einer nationalen Woge im Lande, die die demokratische Woge der Perestroika-Zeit abgelöst habe. Beide Wellen hätten eine beinahe unwiderstehliche Kraft an den Tag gelegt.
Die nationale Woge und die Revanche der entmachteten Eliten
Als Wladimir Putin im August 1999 von Jelzin zum russischen Ministerpräsidenten ernannt wurde, schwamm der neue Regierungschef geradezu auf dieser nationalen Welle und erzielte eine beträchtliche Popularität im Lande in erster Linie als eine Art „Kriegsheld“ im Kampfe gegen die tschetschenischen Freischärler im zweiten Tschetschenienkrieg. Der kometenhafte Aufstieg Putins wurde damals vom Publizisten der Moskauer Zeitung „Moskowskije Nowosti“, Andrej Gratschow, Folgendermaßen kommentiert:
Putin ist der erste (postsowjetische) Ministerpräsident, der seine Popularität nicht der wirtschaftlichen Effizienz, nicht dem Kampf gegen die Korruption und Kriminalität, sondern einer Militärkampagne verdankt.
Parallel zu dieser nationalen Welle fand in Russland auch eine Art Revanche der im August 1991 entmachteten Eliten statt. Auch hier lassen sich gewisse Prallelen zur „ersten“ deutschen Demokratie, insbesondere zur deutschen Novemberrevolution von 1918, ziehen. Denn die Novemberrevolution hatte ähnlich wie die russische Augustrevolution von 1991 einen halbherzigen Charakter. Dies hatte nicht zuletzt mit der Haltung der SPD zu tun, die das Rückgrat des infolge der Novemberrevolution errichteten Systems im Lande bildete. Die Verhinderung der sogenannten „russischen Zustände“ in Deutschland hielt die SPD damals für ihr wichtigstes Ziel, ungeachtet der Tatsache, dass eine Revolution nach bolschewistischem Muster das damalige Deutschland in keiner Weise bedrohte. Die allzu intensive Beschäftigung der SPD-Führung mit der linken Gefahr führte dazu, dass sie die Position des konservativen Establishments im Machtapparat und in der Wirtschaft nicht allzu stark erschütterte, was zu der wohl wichtigsten Voraussetzung für die im Januar 1933 erfolgte rechte Revanche werden sollte. Der Berliner Historiker Heinrich August Winkler schrieb 1990 Folgendes in diesem Zusammenhang:
Richtig ist, dass (die Sozialdemokraten) die Gefahren von links überschätzten und diejenigen von rechts unterschätzten
Was die russische Augustrevolution anbetrifft, die zur Entmachtung der KPdSU führte, so wollte die Mehrheit der siegreichen Demokraten die August-Ereignisse nicht als eine Revolution verstehen. Durch die Erfahrung von 1917 traumatisiert, verknüpften sie mit dem Begriff Revolution Erscheinungen wie Massenterror und Diktatur. Nicht zuletzt deshalb verzichteten sie auf eine allzu gründliche Erneuerung der bestehenden Machtstrukturen. Die 1998 ermordete demokratische Politikerin Galina Starowojtowa hielt es für einen unverzeihlichen Fehler der Demokraten, dass sie ihren Sieg vom August 1991 nicht ausreichend genutzt hätten. Gerade damals hätte eine einmalige Gelegenheit bestanden, den geschockten alten Machtapparat abzulösen bzw. radikal zu erneuern. Dies sei aber nicht geschehen und so hätten die alten Strukturen eine Atempause erhalten, um sich erneut zu konsolidieren. Das System der „gelenkten Demokratie“, das der von Boris Jelzin auserkorene Nachfolger Wladimir Putin in den ersten Jahren seiner Präsidentschaft errichtete, symbolisierte geradezu die Abkehr Russlands von den Grundsätzen der demokratischen Augustrevolution und die Revanche der 1991 entmachteten Eliten.
Irreführende Parallelen
Wie lässt sich das System, das nach dem Scheitern der „zweiten“ russischen Demokratie errichtet worden war, charakterisieren? Der amerikanische Politologe Alexander J. Motyl sah in seinem 2009 veröffentlichten Artikel Ähnlichkeiten zwischen diesem System und dem Regime, das in Deutschland nach dem Scheitern der „ersten“ deutschen Demokratie entstanden war – also mit dem NS-Regime. Er schrieb:
In beiden Ländern gaben die Menschen den Befürwortern der Demokratie … die Schuld an allen Übeln. Hypernationalismus und eine Fetischisierung des Staates kompensierten die Frustrationen. Starke Männer ergriffen – auf legalem Wege – die Macht und nutzten die Bereitschaft der Bevölkerung zur Unterwerfung, um ihre diktatorische Herrschaft zu errichten.
Die Partei „Einiges Russland“, auf die sich Putin stützt, ähnelt nach Ansicht Motyls zwar nicht den faschistischen Parteien vor ihrer jeweiligen Machtübernahme, als sie noch auf eine revolutionäre Veränderung des Systems setzten. Ähnlichkeiten bestünden aber aus seiner Sicht zwischen der Partei „Einiges Russland“ und den faschistischen Parteien in der jeweiligen Regime-Phase.
Die Tatsache, dass die Partei „Einiges Russland“ über keine kohärente Ideologie verfügt, stellt aus der Sicht Motyls ihre Wesensverwandschaft mit der NSDAP oder mit der Partei der italienischen Faschisten nach deren jeweiliger Machtübernahme nicht in Frage:
Faschistische Parteien vertreten keine allumfassende Ideologie, die auf alle Lebensfragen Antwort gibt. Sie wollen wie alle autoritären Staaten die Gesellschaft nur beeinflussen und kontrollieren, so Motyl.
Insbesondere der Charakter des NS-Regimes wird durch solche Aussagen in einer eklatanten Weise verkannt. So verfügte der Nationalsozialismus, anders als Motyl meint, durchaus über eine allumfassende Ideologie, die in mancher Hinsicht nach einer noch gründlicheren Veränderung der bestehenden Verhältnisse strebte, als dies beim Kommunismus der Fall war. Die NSDAP wollte die Gesellschaft nicht „nur beeinflussen und kontrollieren“, sondern grundlegend verändern. Ihr Ziel war die Erschaffung einer nie dagewesenen rassisch geprägten „neuen europäischen Ordnung“. Anders als Motyl suggeriert, verlor die NSDAP nach der „Machtergreifung“ keineswegs ihren früheren revolutionären Elan. Im Gegenteil: erst der Machtbesitz verlieh ihr die Möglichkeit, ihr rassenpolitisches Programm mit voller Wucht zu verwirklichen. Es begann nun eine Reihe von Vernichtungsfeldzügen, zu deren Opfern im Laufe der Zeit immer größere Gruppen zählten, darunter – psychisch Kranke, polnische Intellektuelle, Sinti und Roma, sowjetische Kriegsgefangene, slawische Völker in den besetzten Gebieten, in erster Linie aber die Juden, die für die nationalsozialistische Ideologie das Böse an sich verkörperten und deshalb gänzlich eliminiert werden sollten.
Angst vor den „europäischen Ideen“
Das Streben der Nationalsozialisten nach der Erschaffung eines „neuen Menschen“ und einer „neuen“ nie dagewesenen Gesellschaft ist der „gelenkten Demokratie“ Putins eher fremd. Putins Programm ist nicht revolutionär, sondern vor allem rückwärtsgewandt, wobei es an manche Konzepte konservativer russischer Politiker aus der Zarenzeit erinnert, die danach strebten, Russland in seiner Entwicklung „einzufrieren“. Mit besonderer Vehemenz vertrat dieses Programm der einflussreiche Berater der beiden letzten russischen Zaren und zugleich Oberprokuror des Heiligen Synod – des obersten Organs der Russisch-Orthodoxen Kirche – Konstantin Pobedonoszew (1880-1905). Um die revolutionäre Gefahr im Lande einzudämmen, versuchte Pobedonoszew Russland von den aus dem Westen stammenden Ideen abzuschirmen. Insbesondere den mit dem Westen assoziierten Individualismus prangerte er an. Der Einzelne halte sich jetzt für das Zentrum des Universums und wolle seine Rechte nicht zugunsten anderer Menschen oder übergeordneter Werte abtreten, schrieb Pobedonoszew im Jahre 1896. Eine solche Einstellung verzerre die Wirklichkeit ähnlich wie dies seinerzeit das geozentrische System von Ptolemäus getan hätte, so der Oberprokuror. Wann werde der neue Kopernikus kommen und das menschliche Ich auf den ihm gebührenden Platz zurückführen, fragte Pobedonoszew. Dennoch stand Pobedonoszew mit seinem Kampf gegen die Moderne auf verlorenem Posten. Insbesondere das Streben der russischen Unterschichten nach Emanzipation sollte es zu Fall bringen.
Die restauratorischen Bestrebungen des konservativen Establishments des Zarenreiches im ausgehenden 19. Jahrhundert erinnern in gewisser Weise an die politischen Konzepte der Verfechter der Putinschen „gelenkten Demokratie“, die den demokratischen Experimenten der Gorbatschow- und der Jelzin-Ära, die aus ihrer Sicht das Land destabilisierten und zur Auflösung der UdSSR führten, ein Ende setzten wollten. Kurz nach der Wahl Putins zum Staatspräsidenten begann in Russland eine weitgehende Demontage der zivilgesellschaftlichen Strukturen, die sich im Lande seit Ende der 1980er Jahre entwickelt hatten. Dieser Prozess beschleunigte sich nach dem Sieg der „farbigen Revolution“ in der Ukraine im Jahre 2004. Erst nach dieser Zäsur begann die antiwestliche Rhetorik Moskaus eine ganz neue Dimension anzunehmen, und dies hatte in erster Linie mit dem „Primat der Innenpolitik“ zu tun. Vieles spricht dafür, dass nicht die Armeen der NATO, sondern die europäischen Ideen in Moskau die stärksten Ängste hervorrufen. Der Sieg des Kiewer „Euromaidan“ (2013/14) stellte für die Kreml Führung einen zusätzlichen Schock dar. Sie war sich darüber im Klaren, dass der demokratische Aufbruch in einem Land, das sprachlich und kulturell mit Russland so eng verwandt ist, an der Grenze der Ukraine nicht stehen bleiben wird. Daher ihr Versuch, die Ukraine zu spalten und zu destabilisieren. Um in Russland vergleichbare Entwicklungen wie in der Ukraine zu verhindern, bedient sich die Kreml-Führung im Wesentlichen einer doppelten Strategie. Auf der einer Seite versucht sie die im Lande noch verbliebenen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen aufzulösen. Das vor kurzem erfolgte Verbot der Menschenrechtsorganisation „Memorial“ veranschaulicht diese Strategie besonders deutlich. Auf der anderen Seite appellieren die Machthaber im Kreml an die imperialen Sehnsüchte der Bevölkerung, um diese emotional noch stärker an die Regierung zu binden. Unmittelbar nach der Krim-Annexion im März 2014 schien diese Rechnung aufzugehen. Putins Popularität, die nach der sogenannten Rochade vom September 2011, als der amtierende Staatspräsident Dmitrij Medwedew und der damalige Ministerpräsident Putin die Absicht bekundeten, ihre Ämter zu tauschen, vorübergehend gesunken war, erreichte im Frühjahr 2014 schwindelnde Höhen. Inzwischen spielt aber der Krim-Faktor bei den innenpolitischen Auseinandersetzungen im Lande eine immer geringere Rolle: „Die (Krim-Problematik) hat ihre Aktualität im Grunde verloren“, hob am 4. August 2019 der Petersburger Soziologe Michail Dmitrijew hervor. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Kreml-Führung mit der Verschärfung ihrer antiwestlichen Rhetorik, die seit Ende 2021 zu beobachten ist und mit ihren ultimativen Forderungen an die NATO, eine vergleichbare nationale Mobilisierung im Lande erzielen möchte, wie dies im Jahre 2014 bereits der Fall war. Wobei sie bei den imperial gesinnten Teilen der russischen Öffentlichkeit durchaus Erfolge verzeichnen kann.
Man darf aber auf der anderen Seite nicht vergessen, dass Russland nicht nur über imperiale, sondern auch über freiheitliche Traditionen verfügt. Zwar haftet den russischen Verfechtern dieser letzteren Orientierung, die sich für die „Rückkehr Russlands nach Europa“ einsetzen, das Image der ewigen Verlierer an. Dennoch darf man nicht vergessen, dass es in der Geschichte Russlands durchaus Perioden gab, in denen die Vertreter dieses „anderen“ Russland – die „russischen Europäer“ – den politischen Diskurs und das politische Geschehen im Lande entscheidend prägten. Dies war z.B. in der Zeit der Reformen des liberalen Zaren Alexander II. (1855-1881), in der Periode zwischen der Revolution von 1905 und dem bolschewistischen Staatsstreich vom Oktober 1917 oder während der Gorbatschowschen Perestroika bzw. in der frühen Jelzin-Periode der Fall. Dessen ungeachtet vertreten viele Analytiker in Ost und West die Meinung, dass Russland für eine Demokratie klassischen Zuschnitts ungeeignet sei, wobei zu solchen Skeptikern auch manche führende Vertreter der SPD zählen – also der gleichen Partei, deren Vorsitzender Willy Brandt seinerzeit die Deutschen dazu aufrief „mehr Demokratie zu wagen“. Russland trauen aber diese Politiker anscheinend nichts Vergleichbares zu.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



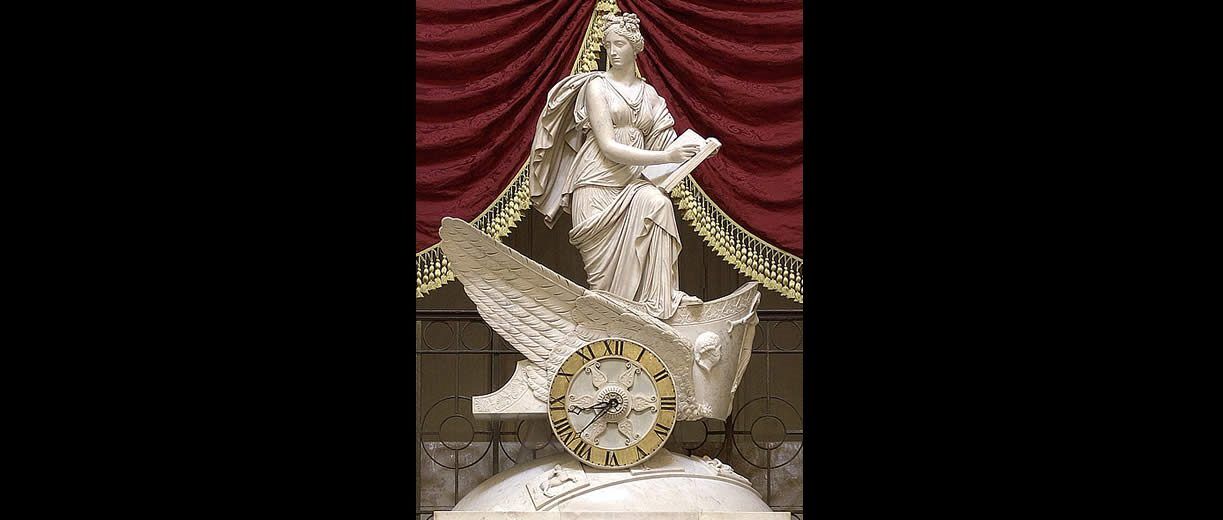

Ihr Kommentar