Slouching Towards Bethlehem von Joan Didion habe ich mir vor allem wegen des Titel-Stückes zugelegt. Statt der von der TAZ gefeierten tief blickenden Reportage fand ich einen eher assoziativen, frei zwischen verschiedenen Interviewpartnern springenden Text, der sicherlich ein interessantes Bild der späten Tage Haight-Ashburys im Jahre ’67 zeichnet. Doch auch ein sehr einseitiges. Wo Selbstzeugnisse der Beteiligten sich gerne in Verklärung verlieren, stößt Didion vor allem auf die dunklen Seiten. Kleine Kinder auf LSD, Vergewaltigungen, massenweise geplatzte Träume. Die sonst überhöhten Ideale finden hier gar nicht mehr statt, die Einbindung in die größere Bewegung, die seit spätestens Mitte der Sechziger unaufhaltsam unterwegs war, bleibt ganz aus. Überhaupt: So präzis Didion sonst beobachtet – die Leichtigkeit mit der sie darüber hinwegsieht, dass die Freiheiten, die sie selbstverständlich lebt, erkämpft werden mussten und müssen, zeugt von einem frappierenden blinden Fleck. Trotzdem bleibt Slouching Towards Bethlehem ein unverzichtbarer Text für alle, die in die Counterculture jenseits der popkulturellen Verklärung des Hippietums einsteigen wollen. Und sei es nur, weil er deren Schattenseiten scharf konturiert.
Drei Seiten: Ein Roman
Die wahren Perlen des Essaybandes sind aber andere. Ein Bericht vom Filmset von The Sons of Katie Elder etwa, als John Wayne bereits unter seiner beginnenden Krebserkrankung zu leiden hatte. Didion kontrastiert in klaren Bildern den John Wayne der reinen Vorstellung mit dem realen Mann, ohne die Vorstellung krampfhaft entzaubern zu wollen, oder auf die Tränendrüse zu drücken. Ähnlich genial portraitiert sie Joan Baez oder bearbeitet den Mordfall (das Fehlurteil?) Lucille Miller.
Eine dreiseitige dichte Erinnerung an eine Reise nach Guaymas, Sonora dringt so tief in die Psyche des gelangweilten gehobenen Bürgertum wie manch gefeierter Roman nicht, und Erinnerungen an die Kindheit in Sacramento entwickeln sich, anfangs kaum merklich, zu einer Geschichte „von all den Dingen die wir verlieren und den Versprechen, die wir brechen wenn wir älter werden“.
Kafka berüht Fitzgerald
Selbst die bedeutendsten Romanciers unserer Zeit wagen sich kaum noch an schöne Sätze. Sätze, die Sprache in einer Weise verwenden, die über die reine Widerspiegelung eines Geschehens oder einer Meinung hinausweisen und gerade so tiefere Wahrheit, gern auch hässliche, zum Klingen bringen. Etwa in einer allegorischen Passagen wie dieser aus dem Sacramento-Essay:
I want to tell you a Sacramento story. A few miles out of town is a place, six or seven thousand acres, which belonged in the beginning to a rancher with one daughter. That daughter went abroad and married a title, and when she brought the title home to live on the ranch, her father built them a vast house – music rooms, conservatories, a ballroom. They needed a ballroom because they entertained: people from abroad, people from San Francisco, house parties that lasted weeks and involved special trains. They are long dead, of course, but their only son, aging and unmarried, still lives on the place. He does not live in the house, for the house is no longer there. Over the years it burned, room by room, Wing by Wing. Only the chimneys of the great house are still standing, and its heir lives in their shadow, lives by himself on the charred site, in a house trailer.
Oder dieser, aus den Ruinen von Alcatraz:
I saw the shower room with the soap still in the dishes. I picked up a yellowed program from an Easter Service (Why seek ye the living among the dead? He is not here, but is risen) and I struck a few notes on an upright piano with the ivory all rotted from the keys and I tried to imagine the prison as it had been, with the big lights playing over the windows all night long and the guards patrolling the gun galleries and the silverware clattering into a bag as it was checked in after meals, tried dutifully to summon up some distaste, some night terror of the doors locking and the boat pulling away. But the fact of it was that I liked it out there, a ruin devoid of human vanities, clean of human illusions, an empty place reclaimed by the water, where a woman plays an organ to stop the wind’s whining and an old man plays ball with a dog named Duke. I could tell you that I came back because I had promises to keep, but maybe it was because nobody asked me to stay.
Man mag kaum glauben, dass diese Texte einst in Hochglanzmagazinen erschienen. In der Vogue, oder in „Holiday“. So zeitlos elegant stehen sie heute noch da. Didion führt in herrlich leichten Essays Kafka und Fitzgerald eng, und schafft es dabei dem Leser weiß zu machen, dass er nichts als einen weiteren Tequila Sunrise schlürft.
____________________________________________________________________________________
In den USA gilt Didion als eine der ganz großen Schriftstellerinnen der Neuzeit. Auf Netflix ist gerade eine Dokumentation über die Autorin erschienen. Fatma Aydemir bespricht den Film in der Taz.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

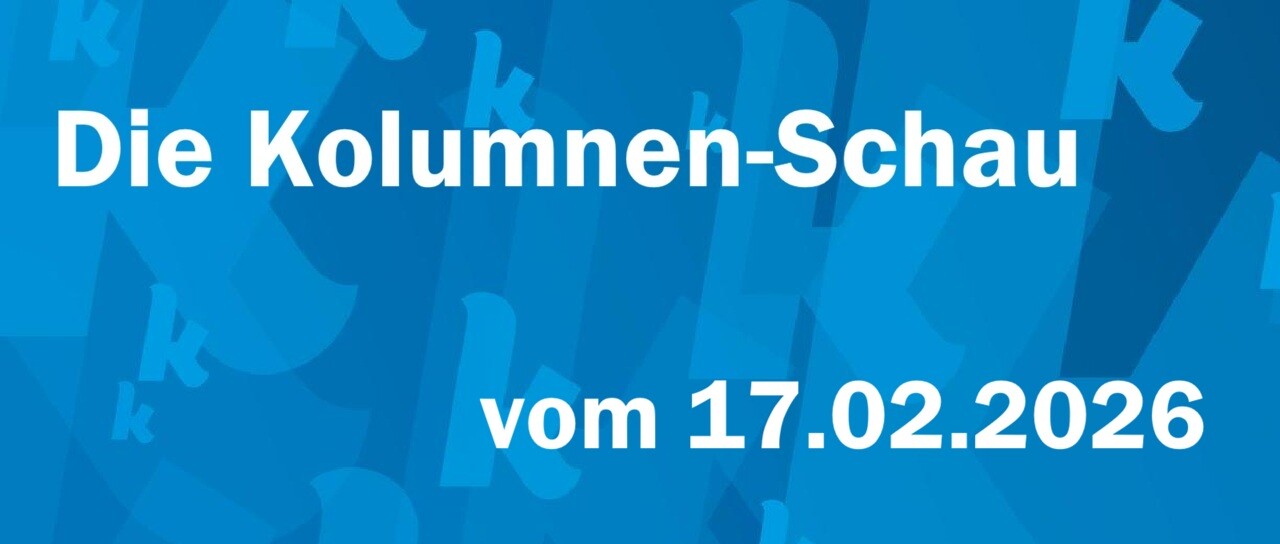


Ihr Kommentar