Natürlich könnte ich einfach milde lächelnd darauf hinweisen, dass Heinrich Schmitz mich in seiner gestrigen Antwort auf meine Kolumne schlicht falsch verstanden und an meinen Überlegungen vorbeigeredet hat. Aber auch das ist ja ein guter Grund zur Reflexion. Deshalb möchte ich zu seinen beiden zentralen Punkten ein paar Gedanken loswerden, unabhängig davon, ob sie als Kritik an meinem Standpunkt taugen oder nicht.
Unschuldsvermutung
Heinrich Schmitz ist der Meinung, ich hätte „die Unschuldsvermutung einfach mal so gekippt“. Das ist zwar falsch, weil es in meinem Text, und auch im Teaser, gar nicht um die tatsächliche Schuld der Angeklagten im NSU-Prozess geht, und mit ein bisschen logischem Verständnis kann man das selbst im prägnant formulierten Teaser erkennen. Aber es ist auch ein willkommener Anlass, über die allgemeine und wohlfeile Phrase, es gelte für jeden Angeklagten bis zum Beweis seiner Schuld die Unschuldsvermutung, einmal etwas genauer nachzudenken.
Erstens: Der Begriff ist irreführend. Niemand kann dazu aufgefordert werden, etwas zu vermuten, was ich vermute, kann mir keine Norm vorschreiben. Deshalb heißt es in den grundlegenden Normentexten auch (z.B. in der Europäischen Menschenrechtskonvention, §6, Absatz 2)
Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig.
„Als etwas gelten“ ist aber etwas anderes, als „etwas sein“ und „etwas vermuten“. Wenn etwa die Leute in den Strafverfolgungsbehörden vermuten würden, dass eine Angeklagte unschuldig ist, würden sie kaum in der Lage sein, effektiv eine Schuld nachzuweisen. Staatsanwälte und sonstige Kläger vermuten natürlich, dass die Angeklagte schuldig ist – aber sie müssen sich damit abfinden, dass sie als unschuldig gilt, solange für die Schuld nicht der gesetzliche Beweis erbracht ist.
Als unschuldig gelten – das ist eine gesellschaftliche Vereinbarung, jemanden auf eine bestimmte Weise zu behandeln. Allerdings ist selbst das gar nicht so einfach – denn wenn man Angeklagte einfach wie Unschuldige behandeln würde, könnte man sie nicht guten Gewissens in Untersuchungshaft einsperren – man muss dafür gute Gründe haben: eine Schuld vermuten.
Die nächste Frage ist: Wer hat sich eigentlich an diese Unschuldsvermutung zu halten? Der oben zitierte Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention regelt die „Rechte auf ein faires Verfahren“ und der Artikel 47 „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“, der mit „Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte“ überschrieben ist, steht im Abschnitt „Justizielle Rechte“. Innerhalb des juristischen Verfahrens gilt also die „Unschuldsvermutung“, da hat eine angeklagte Person als unschuldig zu gelten.
Das heißt also nicht, dass wir uns in der öffentlichen Diskussion jederzeit der Forderung unterwerfen müssten, so zu sprechen, als sei ein Angeklagter eigentlich unschuldig. Wir müssen uns nicht einmal jederzeit gegenseitig versichern, die Peron gelte natürlich als unschuldig. Wir können uns offen und frei über unsere Vermutungen austauschen – zumal wir ohnehin mit unseren Vermutungen nicht an das Urteil eines Gerichts gebunden sind – denn dieses stellt, wie man in dem zitierten Artikel auch nachlesen kann, nur die gesetzliche Schuld, nicht aber etwa eine moralische oder faktische Schuld fest.
Eine simple Ausweitung der Unschuldsvermutung auf jede öffentliche Diskussion – zumal, wenn sie tatsächlich als Verbot, über Schuldvermutungen zu sprechen, verstanden wird, wäre auch eine unzulässige Einschränkung der Meinungsfreiheit.
Allerdings gibt es eine weitere Einschränkung: Den Pressekodex. Da steht in Ziffer 13:
Die Berichterstattung über Ermittlungsverfahren, Strafverfahren und sonstige förmliche Verfahren muss frei von Vorurteilen erfolgen. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gilt auch für die Presse.
Es lohnt sich, die Details dieser Ziffer 13 nachzulesen, dann sieht man, dass das alles gar nicht so einfach ist. Auf ein Detail komme ich unten noch mal zurück. Zumindest soll aber die Berichterstattung über Verfahren keine Vorverurteilung beinhalten.
Spannend ist aber viel mehr, welche Verbindlichkeit der Pressekodex eigentlich hat. Autor ist der Presserat, ein eingetragener Verein, dessen Mitglieder Berufsorganisationen von Verlagen und Journalisten sind. Der Pressekodex ist kein Gesetz, sondern ein Regelwerk, in dem ein bestimmter Berufstand für sich selbst festlegt, wie mit Beschwerden über journalistische Produkte umgegangen werden soll.
Der Pressekodex ist als Regelwerk Ergebnis eines stetigen Aushandlungsprozesses zwischen denen, die selbst journalistisch tätig sind. Er ist ständiger Kritik unterworfen und muss auch dauernd in Frage gestellt werden, damit er z.B. nicht Instrument einer trägen angepassten Journalistenmehrheit gegen investigative und provozierende Kollegen wird. Ob eine Plattform wie DieKolumnisten, die sich in ihrem Claim selbst als „Parteiisch, persönlich und provokant“ bezeichnet, sich pauschal dem Pressekodex unterwerfen sollte, scheint wenigstens fragwürdig zu sein.
Wer bestimmt, was Strafe ist
Zu einem anderen Punkt: Heinrich Schmitz ist in seiner Antwort auf meinen Text offenbar der Meinung, dass die Rechtssprechung als gesetzgebende Praxis oder wenigstens die Rechtswissenschaft als Disziplin die allgemeine Definitionshoheit über rechtlich relevante Begriffe wie „Strafe“ hat. Er beklagt meine „Erwägungen zur Strafe und zum Strafmaß, die sich dermaßen jenseits des Strafrechts bewegen, dass ich da ein paar Dinge zurechtrücken muss“.
Warum sollte das Strafrecht dafür entscheidend sein, welche Bedeutung der Begriff der Strafe allgemein in der Gesellschaft oder überhaupt in anderen Diskursen als dem juristischen haben? Natürlich braucht das Strafrecht einen Begriff der „Strafe“ und man kann nur hoffen, dass es sich dabei an die alltagssprachliche Bedeutung des Begriffes anschließt. Aber die Begriffe sind nicht identisch. Im Allgemeinen sind die fachsprachlichen Begriffe einer Institution enger als die allgemeinsprachlichen – ohne dabei präzisier oder gar besser sein zu müssen. Sie haben einfach einen kleineren Anwendungsbereich, sie bezeichnen weniger Sachverhalte als die der allgemeinen Sprache.
Übrigens hat das auch die Rechtsprechung in einem wichtigen und allgemein bekannten Urteil anerkannt. Das berühmte „Soldaten-sind-Mörder“-Urteil des Bundesverfassungsgerichts basiert genau darauf, dass der Begriff des Mordes, wie er in der Allgemeinsprache verwendet wird, nicht identisch ist mit dem des Strafrechts. In der Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts heißt es nämlich:
In der Alltagssprache ist ein unspezifischer Gebrauch der Begriffe »Mord« und »Mörder«, der nicht auf juristische Abgrenzungen abstellt, durchaus üblich. Danach kann unter »Mord« jede Tötung eines Menschen verstanden werden, die als ungerechtfertigt beurteilt und deshalb missbilligt wird.
Bedenklich ist, dass in diesem Fall sowohl das Amtsgericht als auch das Landgericht ganz selbstverständlich die Definition von Mord aus dem Strafgesetzbuch als allgemeingültig angesehen hatten und dass erst das höchste Gericht darauf hinweisen musste, dass es „keine Anhaltspunkte dafür [sieht], warum ein verständiger Leser des Aufklebers die Aussage in einem solchen fachlich-technischen Sinn verstehen musste.“
Die Anmaßung, dass Experten eine allgemeine Definitionsmacht für die Begriffe haben, die sie selbst aus der Alltagssprache entnommen und für ihre Bedürfnisse zugerichtet haben, teilen Juristen übrigens mit vielen anderen Experten. Es sind oft insbesondere Naturwissenschaftler, etwa Physikern, die beanspruchen, allgemeinverbindlich festzulegen, was wirklich eine Dimension oder Energie sei, oder Biologen, die meinen, bestimmen zu können, was wirklich eine Beere sei und was nicht. Philosophie hat nach meinem Verständnis die Aufgabe, solche Ansprüche und ihre Konsequenzen kritisch zu reflektieren. Dabei geht es mir nicht darum, eine eigene Definition anzubieten und zu verteidigen, wie es Heinrich Schmitz in einem Facebook-Kommentar gefordert hat. Mir reicht es völlig, zu zeigen, dass Fachdefinitionen im Alltag schnell an ihre Grenzen kommen und Konsequenzen haben können, die unerwünscht sind.
Strafe und Unschuldsvermutung
Interessanterweise ist ausgerechnet die Unschuldsvermutung ein Beleg dafür, dass Strafe eben außerhalb des Verfahrens der gesetzlichen Urteilsfindung und -vollstreckung etwas anderes ist als das, was die Juristen darunter verstehen. Dazu schauen wir schließlich noch einmal kurz in den Pressekodex. Dort heißt es nämlich weiter: „Ziel der Berichterstattung darf in einem Rechtsstaat nicht eine soziale Zusatzbestrafung Verurteilter mit Hilfe eines „Medien-Prangers“ sein“. Eine solche Zusatzbestrafung wäre ja gar nicht möglich, wenn sich Strafe in dem erschöpfen würde, was das Strafrecht darunter versteht. Mithin würde die Forderung nach einer Unschuldsvermutung in der Berichterstattung obsolet. Die Medien könnten berichten, was sie wollten, das wäre für den Angeklagten, sollte er freigesprochen werden, gar keine Strafe. Jeder weiß, dass das eben nicht so ist, und deshalb lohnt es sich, darüber nachzudenken, was alles zur Strafe gehört, über das hinaus, was ein Gesetz als Zahl in einen Strafrechtsparagraphen schreiben kann.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

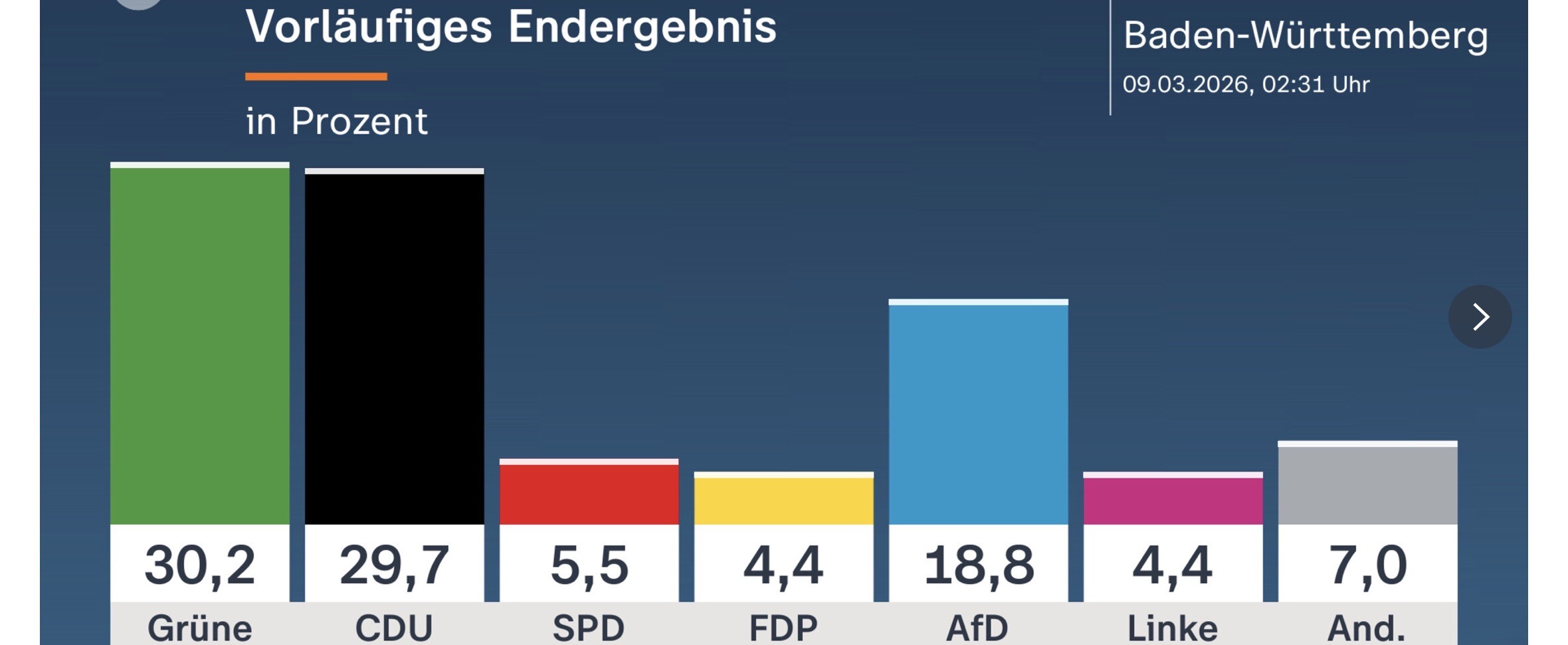


UJ
Sie argumentieren also mitunter juristisch um zu zeigen, dass Sie nicht juristisch argumentieren müssen. Sehr philosophisch. Chapeau!