Für viele Menschen ist die Sache einfach: Wenn der Verfassungsschutz eine Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ einordnet, dann gehört diese Partei verboten. So äußern sich Politiker, Journalisten in den Medien, Freunde im Alltag. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird dabei als eine Ermittlungsbehörde angesehen, die mit untrüglicher Sicherheit verbindliche Einstufungen vornehmen kann und aus der Einstufung „gesichert rechtsextrem“ müsste irgendwie zwangsläufig ein Parteiverbot folgen.
Manchmal hat man den Eindruck, dass die Erwartungshaltung eigentlich wäre, dass am Tag nach einer solchen Einstufung, wenn schon nicht am Tag nach einer Correctiv-Reportage, der Innenminister sich hinstellen müsste und sagen müsste „Die AfD ist hiermit verboten!“ Zähneknirschend wird akzeptiert, dass es dazu eines Verfahrens vor dem Bundesverfassungsgericht bedarf. Auf Unverständnis stößt allerdings, dass sich keiner der Antragsberechtigten – Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung – mal eben durchringt, ein Verbotsverfahren beim Gericht zu beantragen.
Das NPD-Verbotsverfahren: Ein lehrreiches Beispiel
Die Meinung scheint verbreitet, dass so ein Verfahren ganz selbstverständlich zu einem AfD-Verbot führen müsse, wenn doch die Einstufung „rechtsextrem“ bereits vorgenommen ist. Dass selbst diese Einstufung bisher abschließend nur für einige Landesverbände und nicht für die Bundespartei anerkannt ist, scheint unwichtig.
So einfach ist die Sache jedoch nicht. Anhand der Verfahren, die in Sachen Verfassungswidrigkeit der NPD in den letzten Jahren stattgefunden haben, kann man sich das sehr genau ansehen und jeder, der nach einem AfD-Verbotsverfahren ruft, sollte sich die Urteile des Gerichts sehr genau ansehen.
Das gilt insbesondere für das Urteil vom 17. Januar 2017, in dem das Gericht den Verbotsantrag als unbegründet zurückgewiesen hat. Es gibt die Ansicht, dass das NPD-Verbot ja nur gescheitert sei, weil diese zu klein und unbedeutend ist, um ihre Ziele zu erreichen. Das ist richtig, heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass die AfD leicht zu verbieten wäre, weil sie ja durchaus groß und bedeutend genug ist, um ihre Ziele womöglich auch zu erreichen.
Um zu der Einschätzung zu kommen, ein AfD-Verbot sei möglich, reicht es nicht, festzustellen, dass die Gründe, die ein NPD-Verbot verhindert haben, bei der AfD nicht gegeben sind, man muss auch sicher sein, dass Gründe, die ein NPD-Verbot gerechtfertigt hätten, bei der AfD ebenfalls zutreffen. Dazu ist es klug, sich die Argumentation des Gerichtes genau und möglichst emotionslos anzusehen.
Kurz gesagt, verlangt das Bundesverfassungsgericht drei Dinge, die zusammenkommen müssen, damit eine Partei verboten werden kann.
- Die Partei muss sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung (fdGO) richten.
- Sie muss die Beseitigung wenigstens von wichtigen Elementen der fdGO aktiv und in einem Ausmaß betreiben, dass eine reale Gefahr für die fdGO bestehen kann.
- Dieses aktive Betreiben muss nicht nur einzelnen oder auch vielen Funktionären, Mitgliedern und Anhängern zugerechnet werden können, sondern der Partei als ganzer Organisation, die dabei planvoll, organisiert und systematisch vorgeht.
Vorwurf Rechtsextremismus
Dass eine Partei rechtsextremistisch ist, reicht dem Gericht auf alle Fälle nicht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz definiert den Begriff „Rechtsextremismus“ auf seiner Website im Kern so:
„Rechtsextremisten unterstellen, dass die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Nation über den tatsächlichen Wert eines Menschen entscheide. Dieses Werteverständnis konterkariert zentrale Werte der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und steht damit in einem fundamentalen Widerspruch zum Grundgesetz. Nationalismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit wie Rassismus und Antisemitismus prägen die rechtsextremistische Agitation.“
Nehmen wir für einen Moment an, dass es in einem AfD-Verbotsverfahren wirklich gelänge, der AfD als Partei (und nicht nur konkreten Mitgliedern oder Anhängern) einen so definierten Rechtsextremismus nachzuweisen. Wie würde das Gericht damit umgehen? Das kann man im NPD-Urteil nachlesen. Dort bestimmt das Gericht drei Wesenselement der fdGO und sagt, es müsse zumindest die Abschaffung oder Beeinträchtigung eines davon gefordert werden:
- Die Garantie der Menschenwürde,
- Das Demokratieprinzip,
- Das Rechtsstaatsprinzip.
Knüpft man an die Definition des Bundesamtes für Verfassungsschutz an, würde man sich wohl auf das erste Element konzentrieren und zeigen müssen, dass mit der Höherbewertung der Zugehörigkeit zum deutschen Volk, wie sie von der AfD vorgenommen wird, die Menschenwürde anderer Menschen verletzt wird. Dazu wird es vermutlich nicht reichen, darauf hinzuweisen, dass von AfD-Funktionären eine „Remigration“ von nichtdeutschen Straftätern und von abgelehnten Asylbewerbern gefordert wird.
Zurechenbarkeit zur Partei
Aber nehmen wir an, es ließe sich zeigen, dass der Rechtsextremismus in der AfD tatsächlich dem Menschenwürdeprinzip widerspricht – das halte ich für möglich. Nun muss man zeigen, dass diese Ansichten auch der Partei zuzurechnen sind. In den Leitsätzen des Urteils von 2017 kann man dazu lesen:
Zuzurechnen ist einer Partei zunächst einmal die Tätigkeit ihrer Organe, besonders der Parteiführung und leitender Funktionäre. Bei Äußerungen oder Handlungen einfacher Mitglieder ist eine Zurechnung nur möglich, wenn diese in einem politischen Kontext stehen und die Partei sie gebilligt oder geduldet hat. Bei Anhängern, die nicht der Partei angehören, ist grundsätzlich eine Beeinflussung oder Billigung ihres Verhaltens durch die Partei notwendige Bedingung für die Zurechenbarkeit. Eine pauschale Zurechnung von Straf- und Gewalttaten ohne konkreten Zurechnungszusammenhang kommt nicht in Betracht.
Man muss also der Parteiführung und den leitenden Funktionären der Bundespartei nachweisen, dass sie Ansichten vertreten, die die Menschenwürde verletzen. Man wird also Äußerungen etwa von Bundes-Parteichef Tino Chrupalla zu Björn Höcke prüfen und feststellen, dass dieser, etwa vor einem Jahr bei Markus Lanz, darauf hingewiesen hat, dass Höckes Forderungen nicht im Wahlprogramm der AfD stehen. Man mag das als taktisches Ausweichmanöver ansehen, aber es ist wahrscheinlich, dass es nicht gelingen wird, der Bundespartei die Aussagen etwa von Björn Höcke zuzurechnen.
Aktive Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung
Aber nehmen wir auch an, dass es gelänge, rechtsextremistische Aussagen von Parteifunktionären und Bundestagsabgeordneten der Bundespartei als Ganzer zuzuordnen und nachzuweisen, dass die AfD als Partei diese rechtextremen Ansichten vertritt. Auch das würde noch kein Verbot rechtfertigen, wie man dem NPD-Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2017 entnehmen kann. In den Leitsätzen kann man lesen:
„Das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot. Notwendig ist ein Überschreiten der Schwelle zur Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung durch die Partei.
Es muss ein planvolles Vorgehen gegeben sein, das im Sinne einer qualifizierten Vorbereitungshandlung auf die Beeinträchtigung oder Beseitigung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder auf die Gefährdung des Bestandes der Bundesrepublik Deutschland gerichtet ist.“
Was das bedeutet, hat das Gericht in seinem Urteil in den Randnummern 571-580 dargelegt. Kurz gesagt, dass sich die Partei verfassungsfeindlich äußert, reicht nicht aus, sie muss aktiv verfassungsfeindlich handeln: „Die Partei muss also über das ‚Bekennen‘ ihrer eigenen (verfassungsfeindlichen) Ziele hinaus die Grenze zum ‚Bekämpfen‘ der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes des Staates überschreiten“. Unter Verweis auf das KPD-Verbotsurteil schreibt das Gericht,
„dass eine Partei nicht schon dann verfassungswidrig sei, wenn sie die obersten Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen Grundordnung nicht anerkenne, sie ablehne oder ihnen andere entgegensetze. Hinzukommen müsse eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung (vgl. BVerfGE 5, 85 <141>). Weiterhin wird im Urteil darauf verwiesen, dass die Bekämpfung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung so weit in Handlungen (dies seien unter Umständen auch programmatische Reden verantwortlicher Persönlichkeiten) zum Ausdruck kommen müsse, dass sie als planvoll verfolgtes politisches Vorgehen der Partei erkennbar werde.“
Am Rande sei angemerkt, dass das Gericht mit diesem Bezug auf sein Urteil von 1956 eine mehr als sechzigjährige Kontinuität in den Kriterien für Parteienverbote beweist, die sicher durch die Entwicklungen des letzten Jahrzehnts nicht abgebrochen wird.
Wohlgemerkt darf diese „aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden Ordnung“ nicht nur bei einzelnen, wenn auch markanten und präsenten Führungsfiguren der AfD zu finden sein, sondern sie muss Prinzip der Partei als ganzer sein.
Welche konkreten Handlungen das Gericht hier als relevant und ausreichend ansieht, um diesen Tatbestand als erfüllt anzusehen, kann man sich im Urteil über viele Seiten an vielen Beispielen ansehen. So kämen etwa Gewaltbereitschaft, Ausschreitungen und das Verbreiten einer Atmosphäre der Angst, die die Teilnahme an der demokratischen Willensbildung beeinträchtigen, in Frage.
Selbst bei der NPD sah das Gericht „keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass bei der Antragsgegnerin eine Grundtendenz besteht, ihre verfassungsfeindlichen Ziele durch Gewalt oder die Begehung von Straftaten durchzusetzen.“ (Rn. 951)
Es würde hier zu weit führen, auch nur einige der Beispiele und die damit verbundenen Argumentationen des Gerichts aufzuführen, zumal diese für jeden nachlesbar sind. Zu empfehlen sind insbesondere die detaillierten Falldiskussionen ab der Rn. 950. Wenn man das mit den Nachrichten über die AfD und ihre Anhänger vergleicht, sollte schnell klar werden, dass ein Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht aussichtslos wäre.
Fazit
Allenfalls denkbar wäre ein Verfahren zum Ausschluss der AfD aus der Parteienfinanzierung nach dem 2017 neu geschaffenen Absatz 3 des Artikel 21 GG, weil es dort nicht mehr auf das aktive Handeln sondern nur noch auf die Ausrichtung der Partei ankäme. Man müsste also lediglich zeigen, dass der Rechtsextremismus in der AfD sich einerseits auf die Beeinträchtigung und Beseitigung der fdGO ausrichtet und dass dies der Partei als Ganzer zuzurechnen wäre. Ich halte beides für sehr schwierig, wenn ich mir die Strenge des Gerichts im Falle der NPD ansehe.
Ein Verfahren vor Gericht sollte man nur anstrengen, wenn man wirklich meint, im Recht zu sein. Das gilt für zivilrechtliche Streitigkeiten genauso wie für Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Die bisherige Rechtsprechung des Gerichts sollte man dabei zur Kenntnis nehmen und zum Ausgangspunkt machen. Das gebietet der Respekt vor dem Gericht.
Die Auseinandersetzung mit der AfD, wie sie heute im politischen Raum auftritt, muss politisch erfolgen, und dagegen spricht nicht, dass die Parteien der Mitte dafür noch keine erfolgversprechende Strategie gefunden haben. Sie muss bei der Frage beginnen, warum sich immer mehr Menschen in ihrer freien Wahlentscheidung für die AfD entscheiden. Wer meint, dass dies an einem – womöglich globalen – Rechtsruck in den demokratischen Gesellschaften läge, muss sich die Frage stellen, wie ein solcher Ruck nach rund 80 Jahren stabiler parlamentarischer Systeme mit Wohlstand und umfassender politischer Bildung und mit gut ausgestattetem öffentlich-rechtlichem Rundfunk möglich war. Dort an den Ursachen anzusetzen statt Zeit und Ressourcen in öffentlichen Debatten, politischen Entscheidungen und juristischen Schritten zu verschwenden, könnte dem politischen Gegner, den man bekämpfen will, wirklich etwas entgegensetzen.
Hier geht es zur Gegenmeinung von Heinrich Schmitz:
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


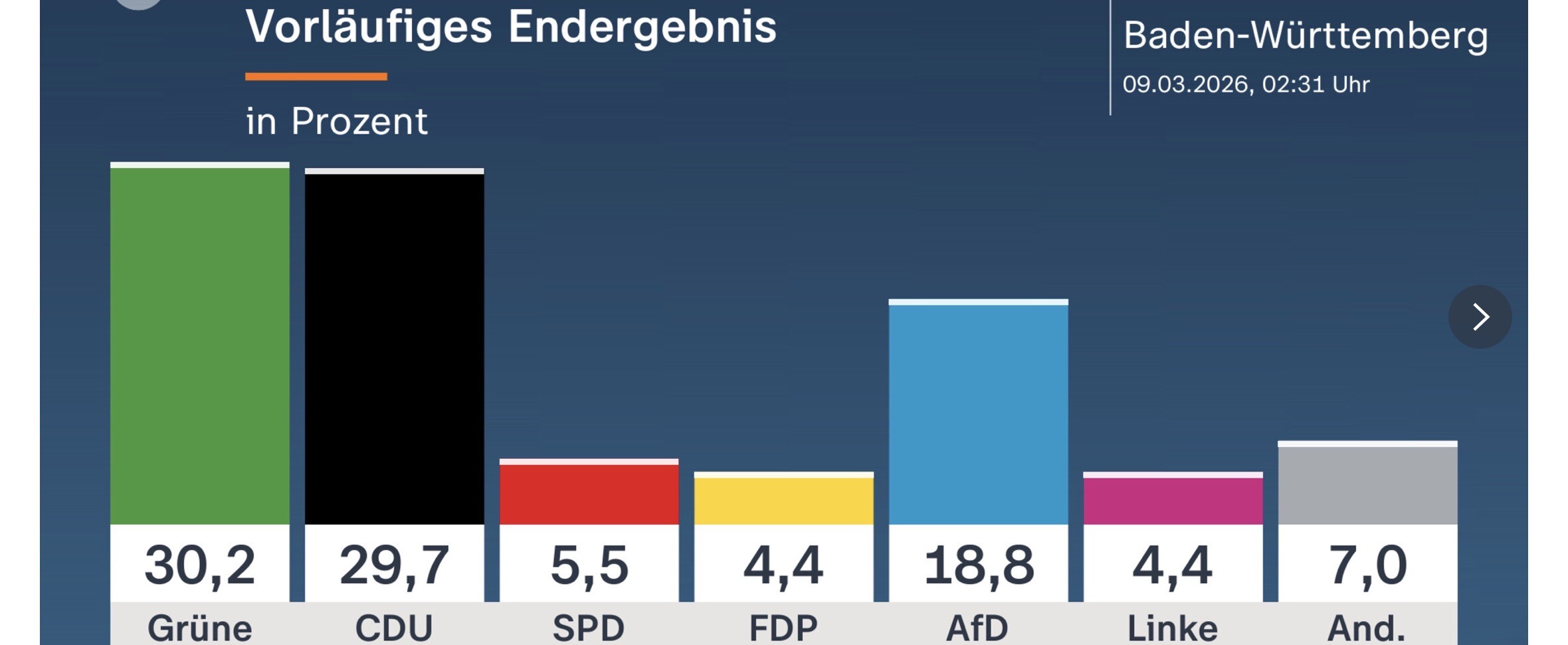


Mighty Quinn
… ich stimme dem ‚Contra‘ im Grunde zu. Nur warum die NPD als Vergleich? Nationalismus bei der AfD? Ich sehe Patriotismus bei der AfD. Dass die AFD die Zugehörigkeit zu einer Ethnie oder Nation über den tatsächlichen Wert eines Menschen stellt, habe ich noch nie gelesen. In einer Studie der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, Okt. 2025, heißt es, Deutsche mit Migrationshintergrund wählen unterm Strich nicht anders als solche ohne diesen Hintergrund. Anders also, der VS und seine Auftraggeber sind es, die Menschen mit Migrationshintergrund als doof darstellen. Das wäre dann Rassismus. Oder?
Der VS, eine weisungsgebundene ‚BRD‘-Behörde, definiert den Begriff ‚Rechtsextremismus‘. Echt Hr. Friedrich, was ist mehr als Quark? Ich meine nicht Ihren Hinweis, ich meine die fragwürdige VS-Def. zum ‚Rechtsextremismus‘, denn ‚gesichert rechtsextrem‘ ist eine ideologische Zuschreibung für Andersdenkende, hier konkret die Sicht einer weisungsgebundenen ‚BRD‘-Behörde. Es gibt kein ‚gesichert rechtsextrem‘; ‚rechts‘ ist kein bestimmter oder genormter Rechtsbegriff. S.h. mein ‚Beitrag‘, bei H.S..