‚ del toro frankenstein ist scheisse‘, schickt mir mein alter Schulkumpel vor 3 Tagen eine WhatsApp. Klingt nicht verheißungsvoll, denke ich. Trotzdem zappe ich eine Stunde später rein, denn zum einen mag ich Guillermo del Toro grundsätzlich recht gerne, und zum anderen wird das Werk von der Kritik derart gehypt, dass Nichtschauen geradezu ein cineastisches Sakrileg bedeutet. ‚Bin nach 30 Minuten wieder ausgestiegen‘ schreibe ich um Mitternacht dem Schulkumpel zurück, lege mich ins Bett und träume von alten Monster-Filmen: Frankensteins Braut (1935).
Gestern unternehme ich den nächsten Versuch, denn ein Rezensent sollte schon den kompletten Film gesehen haben, bevor er seine Rezi tippt. Schon mal vorab: Die zweieinhalb Stunden ziehen sich.
Warum muss Frankestein ständig erneut zum Leben erweckt werden?
Es gibt Stoffe, die sind unsterblich – und dann gibt es Stoffe, die werden einfach nicht in Ruhe gelassen. Frankenstein gehört eindeutig zur zweiten Kategorie. Seit Mary Shelley 1818 ihrem Monster das erste Mal Leben einhauchte, hat die Geschichte mehr Wiedergeburten erlebt als jeder Untote im B-Movie-Kino. Man könnte meinen, der Mythos habe sich irgendwann erschöpft, doch Regisseure können offenbar nicht widerstehen, selbst noch einmal den Blitzschalter umzulegen. Jetzt also Guillermo del Toro. Und wie so oft, wenn er am Werk ist, ist alles wunderschön anzusehen – aber dieses Mal innerlich hohl wie ein Museumsstück, das man bloß aus Respekt für den Künstler betrachtet, aber nicht, weil es Gefühle in einem erweckt.
Del Toro hat sein ganzes Schaffen lang von Monstern gelebt – buchstäblich und metaphorisch. Vom amphibischen Liebhaber in The Shape of Water bis zu den Schattenwesen in Pan’s Labyrinth: Seine Kreaturen sind immer auch Projektionsflächen für menschliche Sehnsucht, Einsamkeit, Anderssein. Und genau deshalb war die Ankündigung, dass er sich endlich Frankenstein vornimmt, eigentlich nur folgerichtig. Mary Shelleys moderner Prometheus ist schließlich der Urvater all seiner Monster. Nur leider zeigt sich in dieser Rückkehr zum Ursprung auch, warum del Toro als Regisseur zunehmend stagniert: Er hat nichts mehr zu sagen, nur noch viel zu zeigen.
Rein optisch ist sein Frankenstein natürlich makellos. Jedes Bild sieht aus wie aus einem viktorianischen Albtraum entsprungen: dampfende Labore, elektrische Stürme, gläserne Herzen, die im Takt des Wahnsinns schlagen. Del Toro hat ein untrügliches Gespür für Atmosphäre, für Textur, für den Moment, in dem Schönheit und Schrecken ineinanderfließen. Doch er vertraut den Bildern mehr als den Ideen. Es ist, als habe er sich in seiner eigenen Ästhetik verfangen – ein Regisseur, der das Kino liebt wie ein Sammler seine Vitrinen: voller Bewunderung, aber ohne Bewegung.
Inhaltlich gibt sich der Film ambitioniert. Erzählt wird die Geschichte aus zwei Perspektiven – aus der Sicht des Schöpfers Victor Frankenstein (Oscar Isaac) und aus jener seiner Kreatur (Jacob Elordi). Das klingt nach einer reizvollen Doppelstruktur, nach einem moralischen Gleichgewicht. In der Praxis ist es aber vor allem redundant. Wir erfahren, was wir ohnehin wissen: dass das wahre Monster nicht der zusammengenähte Körper ist, sondern der Mann, der ihn schuf. Del Toro hämmert uns diese Binsenweisheit mit der Subtilität eines Presslufthammers ein. Wenn Victor zum fünften Mal mit leerem Blick in die Kamera sagt, dass er „zu weit gegangen“ sei, möchte man ihm zurufen: Ja, wirklich, Guillermo, wir haben’s verstanden – schon bei Shelley, vor über zweihundert Jahren.
Schöne Bilder, wenig Inhalt, streckenweise kitschig
Oscar Isaac spielt den Wissenschaftler als selbstverliebten Demiurgen mit leichtem Hang zum Overacting – was durchaus passt, aber irgendwann ermüdet. Jacob Elordi hingegen verleiht dem Geschöpf eine zarte, fast kindliche Präsenz. Sein Monster ist kein Zerstörer, sondern ein Beobachter, der lernen will, was es heißt, Mensch zu sein. Das ist schön, aber auch streckenweise kitschig. Del Toro verwechselt Gefühl mit Gefühligkeit, Tragik mit Tränenfilter. Wenn seine Kamera in Zeitlupe über die Narben des Wesens streicht und die Musik anschwillt, klingt das eher nach Werbung für Duftkerzen als nach existenziellem Horror.
Und während Lanthimos’ Poor Things im vergangenen Jahr den Frankenstein-Mythos wild, weiblich und anarchisch neu erfand – Emma Stone als grotesk-erleuchtetes Gegenstück zu Shelleys Kreatur –, traut sich del Toro keinen Millimeter aus seiner Komfortzone. ‚Poor Things‘ war eine Explosion der Imagination, ein feministisches, satirisches Feuerwerk über Schöpfung, Körper, Macht. Del Toros Frankenstein ist dagegen brav wie ein Konfirmand, der zu spät merkt, dass er seinen Katechismus auswendig gelernt hat, aber den Sinn nie verstand. Man spürt die Ehrfurcht vor der Vorlage, aber keine Lust auf das ihr immanente Risiko.
Dabei wäre gerade jetzt, im Zeitalter von KI, Transhumanismus und moralischem Kontrollverlust, reichlich Gelegenheit gewesen, das Thema neu zu denken. Stattdessen inszeniert del Toro seinen Frankenstein als klassisches Melodram mit gotischem Staubrand. Das mag nostalgisch gemeint sein, wirkt aber eher wie Rückschritt. Wenn man sich heute fragt, was es bedeutet, Leben zu erschaffen, denkt man nicht mehr an Kupferspulen und Blitze, sondern an Codezeilen und neuronale Netze. Doch del Toro weigert sich, diese Brücke zu schlagen. Vielleicht, weil ihn Technik nicht interessiert – oder weil er, wie er selbst sagte, „vor menschlicher Dummheit mehr Angst hat als vor künstlicher Intelligenz“. Eine hübsche Pointe, die aber nichts an der inhaltlichen Schieflage seines Films ändert: Er bleibt eine Hommage an die Vergangenheit, nicht ein Kommentar zur Gegenwart.
Regisseur & Autor in Personalunion ist selten eine gute Idee
Das größte Problem ist, dass del Toro wieder einmal Regisseur und Drehbuchautor ist. Dieses Experiment – die totale Kontrolle – funktioniert in den seltensten Fällen. Ohne einen Co-Autor, der widerspricht, bleibt das Werk selbstverliebt. Alles ist durchdacht, nichts ist hinterfragt. Der Film hat denselben Fehler wie sein Protagonist: Er will zu viel selbst machen und verliert darüber die Balance. Ein Drehbuch braucht manchmal einen Widerstand, jemanden, der sagt: „Nein, das reicht.“ Del Toro scheint niemanden gehabt zu haben, der das wagte.
Formal beeindruckend, erzählerisch leer – das könnte man als Fazit über fast alle seine jüngeren Filme schreiben. Schon bei Nightmare Alley war das so: eine perfekte Oberfläche, hinter der sich gähnende Leere verbarg. Jetzt also Frankenstein, der schönste Leichnam seiner Karriere. Man staunt über die Pracht der Ausstattung, über das Spiel mit Licht und Schatten, über Alexandre Desplats melancholischen Score – und merkt erst nach einer Stunde, dass man emotional längst ausgestiegen ist. Del Toro betet das Kino an, aber er spürt es nicht mehr.
Del Toro Frankenstein: auch der Film fleddert den Leichnam
Was bleibt, ist die alte Ironie der Geschichte: Del Toro, der Künstler der Monster, hat ein Werk geschaffen, das selbst ein Monster ist – zusammengesetzt aus den schönsten Versatzstücken des Kinos, aber ohne Seele, ohne Herzschlag. Vielleicht ist das ja die eigentliche Tragik dieses Frankensteins: Dass er von einem Filmemacher kommt, der sich zu sehr in seine Schöpfung verliebt hat. Er will sie beleben, perfektionieren, verewigen – und erstickt sie dabei.
Am Ende sieht man einen Film, der alles hat, was das Auge begehrt, und nichts, was den Geist fordert. Die schönste Kameraarbeit nützt nichts, wenn die Geschichte tot ist. Und so schließt sich der Kreis: Ein Film über die Hybris des Schöpfers wird selbst zum Lehrstück über genau diese Hybris. Del Toro hat – ungewollt, aber treffend – bewiesen, dass man Kunst nicht allein aus Schönheit zusammennähen kann. Irgendwo dazwischen braucht es auch ein Herz. Und das schlägt hier nur noch müde im Takt der Frankenstein-Dioden.
PS. und Christoph Waltz spielt wie immer Christoph Waltz
+++
Frankenstein
Erscheinungsjahr: 2025
Regie & Drehbuch: Guillermo del Toro
150 Minuten
Auf: Netflix
4 Punkte (von 10 möglichen)
+++
Hier geht es zu weiteren Film-Rezensionen von Henning Hirsch:
Der ungeschminkte Westen
Als Habgier den Blumenmond tötete
Ein Hauch von Dallas in New York
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.




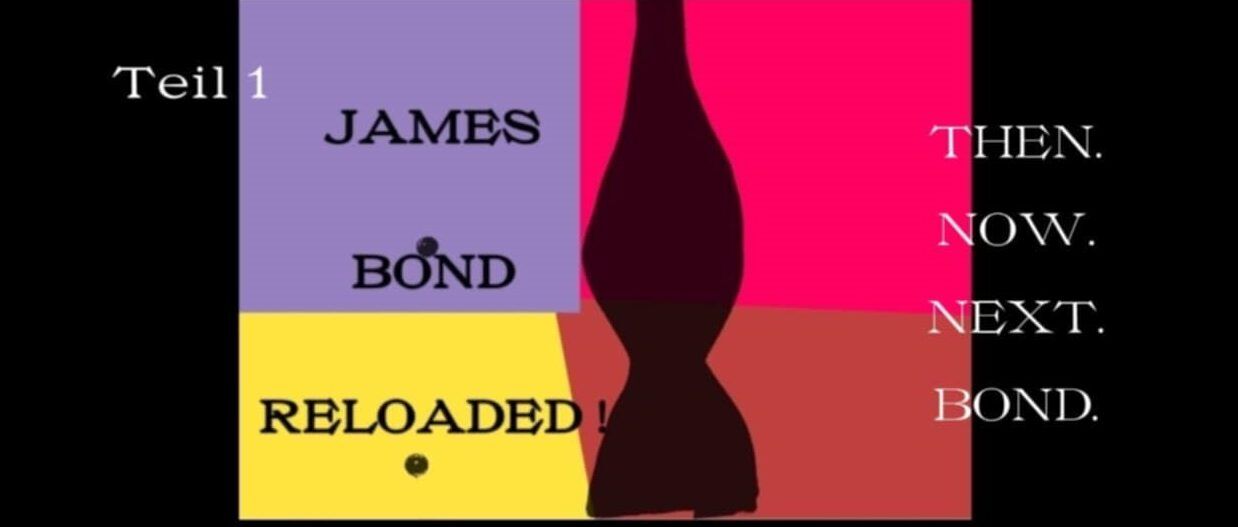
Ihr Kommentar