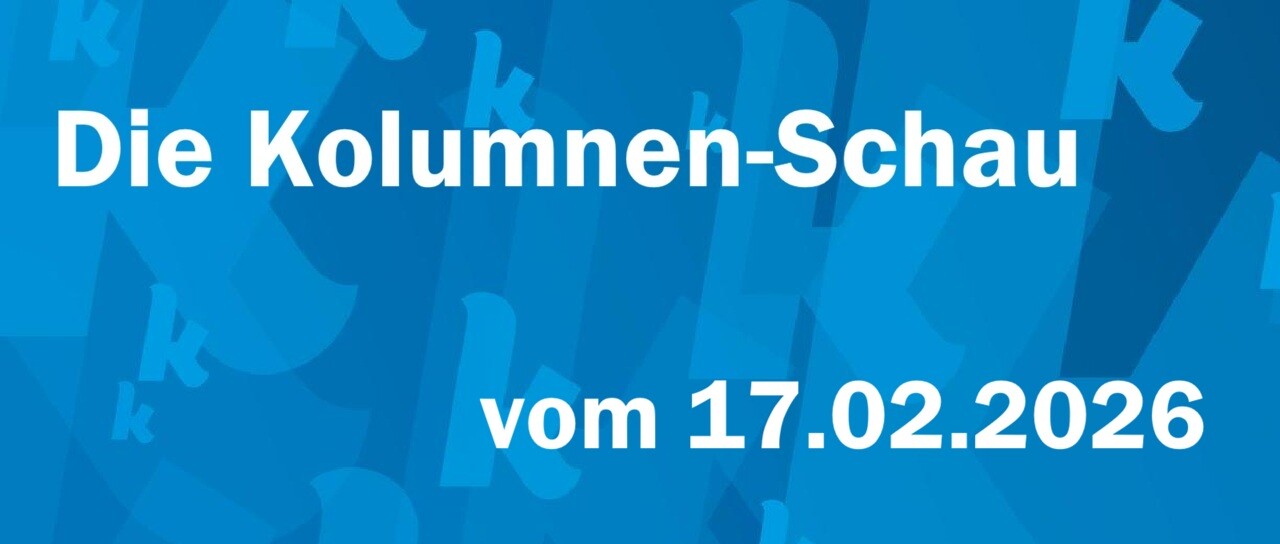Attentate sind nicht hilfreich für eine friedliche Gesellschaft. Bild von Mark Scanland auf Pixabay
Als ich in den Nachrichten von dem Anschlag auf einen Charlie Kirk hörte, berührte mich das ungefähr soviel wie die Meldung über die Sperrung der A1 bei Kölln. Attentate sind nicht hilfreich, dachte ich, da ich den Mann nicht kannte, und dass in Amerika Menschen durch Schusswaffen ums Leben kommen, ist nun keine Neuigkeit. Und dann las ich, dass dieser Kirk wohl die Toten durch Waffengewalt als angemessenen Preis für das Recht auf Waffenbesitz hielt. Nun denn.
Erst als der orangene Mann aus dem Weßen Haus öffentlich dicke Krokodilstränen vergoß und – noch bevor der Täter identifizeirt war – die bösen Linken für den Tod seines Propagandisten verantwortlich machte, fing die Causa an, mich zu interessieren. Ein politischer Mord also.
Im Netz hieß es gleich, Mord ist Mord. Naja, Stauffenberg, der allerdings nicht erfolgreich war, was ich ausdrücklich bedaure, wird hier als Held verehrt. Also ist Mord doch nicht Mord?
Es gibt eine gefährliche Versuchung in der Politik: die Vorstellung, dass man mit einer einzigen Kugel die Welt verändern kann. Der Attentäter glaubt, der Abzug sei schneller als jede Debatte, der Schuss effektiver als jedes Wahlplakat, die Gewalt ehrlicher als die mühsame Arbeit an Kompromissen. Diese Idee ist nicht nur mörderisch, sie ist auch zutiefst dumm. Denn politische Attentate haben die Menschheit immer tiefer ins Chaos gestoßen, als dass sie jemals das gewünschte Ziel erreicht hätten.
Man könnte meinen, die Geschichte hätte uns das längst gelehrt. Doch offenbar reicht selbst das Blut der Jahrhunderte nicht, um die Faszination am „großen Schlag“ zu brechen.
Cäsar, Sarajevo, Dallas: Drei Kugeln, drei Katastrophen
Nehmen wir drei der bekanntesten Fälle. Julius Cäsar wurde im Jahr 44 v. Chr. von seinen Gegnern erstochen, um die Republik zu retten. Das Ergebnis? Ein blutiger Bürgerkrieg, der genau das Gegenteil brachte: den Untergang der Republik und den Aufstieg des Kaisertums. Die Attentäter wollten konservieren, und sie beschleunigten die Revolution. Dumm gelaufen.
Gavrilo Princip erschoss 1914 den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand. Er wollte Freiheit für die Südslawen. Stattdessen entzündete er den Ersten Weltkrieg – Millionen Tote, eine zerschlagene Ordnung, Hass, aus dem später der Faschismus erwuchs. Princip starb elend im Gefängnis. Seine Kugel aber rollte wie eine Lawine durch die Weltgeschichte. Noch dümmer gelaufen. Immerhin wurde der Thronfolger später Namensgeber einer Rockband.
Oder Dallas, 1963: John F. Kennedy, das Symbol einer neuen politischen Generation, fällt dem Gewehrschuss von Lee Harvey Oswald zum Opfer. Die USA stürzen in eine Phase von Misstrauen, Verschwörungstheorien und politischer Lähmung. Der Attentäter mag im Dunkeln verschwunden sein – die Nation blieb jahrzehntelang traumatisiert.
In allen drei Fällen zeigt sich das Muster: Attentate schaffen keine Lösungen, sie reißen Löcher. Sie entziehen Gesellschaften das Vertrauen in ihre Institutionen und lenken die Geschichte auf Abwege, deren Preis immer höher ist, als es selbst die wildeste Phantasie des Attentäters je gedacht hätte. Und natürlich wird auch das Attentat auf Kirk zu unangenehmen Folgen führen, weil es vom Präsidenten instrumentalisiert wird, lästige Konkurrenz auszuschalten.
Der falsche Mythos des Märtyrers
Warum üben Attentate trotzdem eine so magnetische Wirkung aus – auf Täter wie auf Beobachter? Weil sie Geschichten produzieren, die sich leicht weitererzählen lassen. Ein Attentat ist verdichtetes Drama: Opfer, Täter, Motiv, Blut. Politiker oder halt auch andere politische Aktivisten,, die zuvor kaum beachtet wurden, werden im Moment ihres Todes zu Märtyrern, ihre Namen eingraviert in die kollektive Erinnerung.
Trügerischer Mythos
Doch dieser Mythos ist trügerisch. Er macht aus einem Mord ein Spektakel und verschiebt die Wahrnehmung. Das Opfer wird auf sein Ende reduziert, das politische Projekt in Trauer erstarrt, in Vergeltung verwandelt oder beides. Für die Gesellschaft bleibt eine klaffende Wunde.
Attentäter dagegen verschwinden oft ins Nichts. Wer erinnert sich noch an die Namen der Mörder von Olof Palme oder Indira Gandhi außer Historikern und Ermittlern? Die Tat überstrahlt die Person. Und gerade das macht den Mord so perfide: Er löscht nicht nur Leben aus, sondern auch den politischen Diskurs, indem er ihn in einen Krater verwandelt.
Gewalt als Bankrotterklärung der Politik
Es gibt einen einfachen Grundsatz: Wo das Argument endet, beginnt die Gewalt. Ein Attentat ist deshalb immer ein Eingeständnis politischen Scheiterns. Es ist das Gegenteil von Debatte, es ist die Kapitulation vor der Komplexität einer pluralistischen Gesellschaft.
In Demokratien ist der Mord an einem Politiker besonders verheerend. Er ist nicht nur ein Angriff auf eine Person, sondern ein Angriff auf das Prinzip selbst: die Idee, dass Macht zeitlich begrenzt, friedlich übertragbar und öffentlich kontrollierbar ist. Der Attentäter will den Prozess abkürzen, doch er zerstört ihn.
In autoritären Regimen wiederum werden Attentate oft zur einzigen verzweifelten Möglichkeit, einen Tyrannen zu beseitigen. Doch auch dort zeigen sie selten die erwünschte Wirkung. Wer Hitler töten wollte, musste erkennen: Selbst ein erfolgreiches Attentat hätte das System nicht sofort gestürzt, sondern höchstens verschoben. Gewalt gebiert Gegengewalt – und kein Schuss der Welt reicht, um Strukturen zu zerlegen.
Attentate im Zeitalter der Polarisierung
Heute, im 21. Jahrhundert, erleben wir eine neue Eskalation. Polarisierung, Hass in den sozialen Medien, enthemmte Sprache: All das schafft einen Nährboden, in dem Attentate wieder wahrscheinlicher werden. Wer ständig hört, der politische Gegner sei kein Gegner, sondern ein „Feind“, wer sich in Echokammern mit Gewaltfantasien auflädt, der kann irgendwann die Grenze überschreiten – vom Kommentar zur Tat. Oder er wird selbst Opfer des von ihm gesäten Hasses.
Die digitale Bühne verstärkt diesen Sog. Ein Attentat ist nicht mehr nur ein Akt im Verborgenen, es wird zum Livestream, zum globalen Medienereignis, zum Fanal für Nachahmer. Die Täter wissen das, und sie kalkulieren es ein. Der Mord wird zur Botschaft.
Aber gerade deshalb ist es entscheidend, wie Gesellschaften reagieren. Wer sich in Panik verliert, wer beginnt, politische Auseinandersetzung durch Misstrauen und Repression zu ersetzen, der macht den Attentätern das größte Geschenk: Er zerstört von innen, was sie von außen nicht hätten zerstören können.
Debatte verteidigen
Es klingt banal, ist aber überlebenswichtig: Demokratie lebt von Worten, nicht von Waffen. Jede Kugel, die einen Politiker trifft, trifft auch die Vorstellung, dass Konflikte durch Sprache lösbar sind. Deshalb ist der Schutz der politischen Kultur genauso wichtig wie der Schutz der politischen Personen.
Wir müssen eine Grenze ziehen: Zwischen harter Kritik, die erlaubt und notwendig ist, und sprachlicher Entmenschlichung, die irgendwann den Weg zur Gewalt ebnet. Zwischen Protest, der Demokratie lebendig macht und Radikalisierung, die sie zerstört.
Wer Attentate verharmlost oder gar feiert, zeigt, dass er die Demokratie nicht verstanden hat. Denn jedes Attentat ist in Wahrheit ein Attentat auf uns alle – auf unsere Fähigkeit, miteinander zu streiten, ohne uns gegenseitig auszulöschen.
Der Schuss ist nie das letzte Wort
Die Geschichte beweist es immer wieder: Attentäter schreiben keine Lösungen, sie reißen Kapitel heraus und hinterlassen verbrannte Seiten. Ihre Kugeln bringen keinen Fortschritt, sondern Traumata. Sie vergrößern das Leid, sie verzerren die Geschichte, sie machen Märtyrer aus Menschen, selbst aus Widerlingen, und Mythen aus Morden.
Wir dürfen uns davon nicht hypnotisieren lassen. Der Glaube an die Kugel ist ein Irrglaube. Der einzige Weg, Politik zu verändern, führt über das Wort – das mühsame, das ungeduldige, das kompromissbeladene Wort. Alles andere endet in Blut und Schweigen.
Und wenn uns die Geschichte etwas lehren sollte, dann dies: Nicht der Attentäter bestimmt das letzte Wort, sondern die Gesellschaft, die entscheidet, ob sie ihm die Deutungshoheit überlässt. Die bessere Antwort ist, sich lauter, klarer und standhafter zur Demokratie zu bekennen. Denn der Schuss mag laut sein – aber er darf nicht das letzte Wort sein.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.