Einen bereits veröffentlichten Roman zu Lebzeiten umfangreich überarbeitet neu aufzulegen, ist ein Wagnis. Erstens, weil die Neubearbeitung wie die Fortsetzung zu Vergleichen drängen, und der Vergleich mit dem Ursprungswerk selten fair durchgeführt wird. Wie der Igel ist der alte Text immer „schon da“, und leicht ist man geneigt, ihm allein das zum Vorteil auszulegen. Zweitens aber auch, weil die Neubearbeitung, gelungen oder nicht, von einem Kunstwollen zeugt, das quer zum Anspruch der Öffentlichkeit an den Autor als Unterhalter steht. „Das war nicht perfekt, das muss ich nochmal machen.“ Die Haltung scheint ein wenig aus der Zeit gefallen und ist für den Kritiker ein gefundenes Fressen: Denn wie die Überarbeitung den Blick auf die Schwächen des Alten lenkt, ermutigt sie auch zum Suchen nach den Schwächen des Neuen.
Unzufriedenheit als Treibstoff
Entsprechend würdigen sollte man es, wenn ein Autor das scheinbar Unmögliche dennoch versucht, das Dickens, Goethe und Whitman noch Usus war. Und wichtiger heute vielleicht: Wenn sich ein Verlag findet, der dabei mitspielt.
Oliver Plaschka war mit seinem Fairwater wohl schon länger nicht mehr so ganz zufrieden. Auch das liegt in der Natur der Sache: Ein Erstlingswerk, noch dazu das literarisch bis heute wohl ambitionierteste des Autors. Da schmerzen Schwächen, derer man sich nach Drucklegung bewusst wird, besonders. Dazu Plaschka im Vorwort der Neubearbeitung:
Als ich mit dem Abstand von vierzehn Iahren wieder in [Fairwater] eintauchte, sah ich nur noch einen Schimmer der Magie, die ich einst hineinprojiziert hatte. Stattdessen sah ich: fragwürdige Formulierungen, eine Flut von Füllwörtern und verschlüsselte autobiografische Bezüge. Und ich sah mich selbst zu dieser Zeit: einen jungen, unerfahrenen Autor, der mit viel Rauch und Spiegeln seine Unsicherheit zu kaschieren versuchte (…)
Seit Fairwater hat Plaschka beachtliches vorgelegt: Das kluge Spiel mit Perspektiven Die Magier von Montparnasse, den rasant-hintergründigen Steampunkroman Der Kristallpalast gemeinsam mit Alexander Flory, das anspruchsvolle High-Fantasy-Epos Das Licht hinter den Wolken und den umfangreichen und detailliert recherchierten Roman Marco Polo. Bis ans Ende der Welt. Aber mit seiner radikalen Erzählweise, den sieben Erzählsträngen, die sich teils kaum zu berühren scheinen und doch in einem vielschichtigen, gebrochenen Bild einer fiktiven amerikanischen Kleinstadt konvergieren, mit den musikalisch durchkomponierten Traumsequenzen und den wie ein Kippbild zwischen übernatürlichen und (kollektiv-) psychologischen Erklärungen hin und her schlagenden Geschehnissen in dieser Kleinstadt – Fairwater – nahm der Roman in der neueren deutschsprachigen Literatur von Anfang an eine Sonderstellung ein.
„Ein Alptraum Faulkners in einem heruntergekommenen amerikanischen Provinzvenedig“,
habe ich ihn in einer ältere Kurzbesprechung charakterisiert.
Der Fairwater-Kosmos
„Wie kann ein Ganzes sein, ohne dass dem Einzelnen Gewalt angetan wird“ – das nennt Adorno die „Frage aller Musik“. Und das lässt sich durchaus auf die Kunst im Allgemeinen ausdehnen, und das selbst von Musikalischem und von Verweisen auf Musikalisches durchzogene Fairwater war in jedem Fall auch 2007 bereits ein guter Versuch in Richtung einer Antwort.
Und worum geht es in Fairwater? In Fairwater, dem heruntergekommenen provinziellen Venedig Marylands, geschahen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts rätselhafte Morde. Der Mörder dringt in die Wohnräume des Opfers ein, ohne Spuren seines Eintretens zu hinterlassen. Wie in einem klassischen Krimi setzt sich erst die Washingtoner Journalistin Gloria auf die scheinbar kalte Spur. Sie weilt zur Beerdigung ihres verschwundenen Freundes Marvin in der Stadt ihrer Kindheit. Marvin wurde für verstorben erklärt, sein Sarg wird leer beerdigt. Nach der Dauer einer kurzen Novelle (130 Seiten) verlässt Gloria Fairwater und glaubt den Fall gelöst zu haben. Der Leser aber ist so klug wie zuvor. Fairwater allerdings hat kaum begonnen. In insgesamt sechs weiteren Kapiteln wird das zentrale Thema stets aufs Neue angegangen. Wurde das Königshaus einer alten außerirdischen Zivilisation vor langer Zeit in Fairwater verstreut und behält nur Fetzen der Erinnerung an seine Herkunft? Oder sind das nur die Traumbilder eines jungen Mannes, der als Kind Qualen, Enttäuschungen und einen schweren Unfall durchlitt? Oder ist es der quasi metaphorische Ausfluss einer kollektiven Massenpsychose? Hat die Industrie der Familie Van Bergen des Trinkwasser verunreinigt? Haben gar Regierungsorganisationen ihre Finger im Spiel? Oder sind die Spiegel des Herrn Bartholemew tatsächlich Tore in eine andere Welt?
Fairwater spielt geschickt mit Perspektiven, und ist derart dicht bevölkert mit skurrilen Charakteren, dass der Roman selbst sich anfühlt wie eine Kreuzung aus Geisterbahn und Spiegelkabinett. Den Reiz der Ausgabe von 2007 machten dabei auch die überbordende, sehr bildreiche Sprache und der je nach Fokus-Charakter immer wieder neu erfundene Stil aus. Die größte Sorge begeisterter Leser der Erstausgabe dürfte gewesen sein, dass Plaschka mit dem Anspruch, Jugendsünden auszumerzen, hier zu sehr auf die Bremse drückt.
Der variable kunstvolle Stil bleibt
Ich denke, ich kann diese Sorge zerstreuen. Die Notwendigkeit vieler Veränderungen sollte sich für Leser mit etwas ästhetischem Spürsinn sofort erschließen. Doppelungen quasi sinngleicher Wörter wurden gestrichen. Widersprüche wie frischer Wind voll Frühlingsduft und dem Geruch von fauligem Laub getilgt. Die Sätze dürften im Schnitt etwas kürzer geworden sein, all zu lange Bandwurmsätze wurden zusammengestrichen. Oft aber auch einfach dadurch entschärft, dass an der Stelle von Kommata, die im Geiste schon immer Punkte oder Doppelpunkte waren, das entsprechend stärkere Satzzeichen gesetzt wurde. Lange melodische Satzkompositionen bleiben erhalten, wo sie hin gehören. Weiterhin bleiben die Stimmen gut voneinander abgesetzt, Glorias Erzählstrang ist tough und straight, Marvins Wahn grotesk und gehetzt, das Silberschiff melodiös-poetisch.
Dabei sollte man übrigens lieber nicht zu sehr ins vergleichende Lesen verfallen. Entscheidend ist, dass das neue Fairwater als Werk für sich überzeugt. So kann ich es denn auch nicht statistisch belegen, glaube aber dass die Popkultur-Referenzen im Nachsatz mit „wie“ deutlich verringert wurden. Also Sätze wie „(…) wobei sie sich trotz des eklatanten Fehlens einer wie auch immer gearteten Waffe in ihren Händen in etwa so entschlossen vorkam wie Sigourney Weaver in ihrer Rolle als Ripley am Ende von Aliens“ – Es sind auch im neuen Fairwater noch einige geblieben, dieser zum Beispiel, aber in der Erstauflage traten sie so häufig auf, dass es doch oft gesucht wirkte, was jedes Mal aus der Welt heraus riss. Diesmal stolpere ich kaum, die Popkultur fügt sich nun organischer in Werk und Welt.
Ach ja, die Welt: Plaschka kritisiert im Vorwort ein wenig seine Herangehensweise, in der 2007-Veröffentlichung „seine Wissenslücken mit Versatzstücken aus Fernsehen und Kino gestopft“ zu haben. Ich halte gerade das für eine große Stärke beider Versionen, nur ist die neue darin schnörkelloser. Fairwater versuchte nie, „Realität plus Magie“ zu sein, wie etwa Harry Potter. Auch das Amerika Fairwaters wird stets als überspitzte Kunstwelt kenntlich. Mit mächtiger umweltverschmutzender Geschäftsaristokratie, Agenten in Trenchcoats, Sanatorien, die die ganze Tradition des Southern-Gothic in sich aufgesaugt zu haben scheinen und einer großen Masse kafkaesker Aussteiger, die von den Mythen rund um Fairwater wie magisch angezogen werden. 2007 war Fairwater eine Art milde Dystopie durch groteske Überzeichnung, ohne die totalisierende Systembildung, die dem Genre so oft zu eigen ist. 2018 freilich ist Fairwater beinahe schon ein Ort, an den man sich selbst flüchten möchte. Das liegt daran, dass aller Überarbeitung zum Trotz die Welt sich in elf Jahren stärker verändert hat als das Buch.
Ulfs Anmerkungen zum Fairwater-Soundtrack:
Wovenhand – Story & Pictures:
Southern Gothic, bildhafte Sprache, bedrohliche Atmosphäre? Da passt David Eugene Edwards hervorragend als Umrahmung. Mit seinen Bands 16 Horsepower und Wovenhand gehört er zweifellos zu den mitreißendsten und charismatischen Songwritern der letzten gut 25 Jahre. Die Bandbreite reicht vom knochigen Wüstenrock über den manischen Priester bis hin zu sanften Augenblicken stiller Sensitivität. Zu letzteren zählt der verlinkte Song.
The Sisters Of Mercy – Afterhours
Traumsequenzen? Psychologie trifft Surrealismus? Dark Faulkner? „Hitchcock meets Dali“ gibt ja bereits. Warum also nicht „Plaschka meets Sisters“? „Afterhours“ ist Klang gewordener Nebel, der trefflich die in uns allen lauernde Dunkelheit illustriert. Inmitten dieser dräuenden Finsternis erwartet den Hörer eine tonnenschwere Magma-Gitarre. Es ist eines der hypnotischsten Riffs der Rockgeschichte und knüpft dort an, von Ennio Morricones „Harmonica Man“ begann.
Baxter Dury – Miami:
Skurrile Charaktere? Geisterbahn trifft Spiegelkabinett?
„Baxter erschafft sarkastisches Crooning voll doppelter Böden und makabrer Pointen. Auf mittlerweile fünf Alben zerrt er das Dunkel ans Licht und bietet Geschichten aus der Schattenwelt menschlicher Abgründe und Merkwürdigkeiten.
Nicht selten fängt das harmlos an. Während der arglose Hörer den Protagonisten noch für den harmlosen Kerl von nebenan hält, entpuppt dieser sich als pädophiler Kidnapper oder sonstwie monströser Geselle.
Wie Baxter Dury Songs aus scheinbar harmonischen Situationen ins Abseitige oder gen Sarkasmus kippen lässt, hat methodisch etwas von Randy Newman. Bei Dury jedoch sprachlich derber und atmosphärisch zwielichtiger verpackt.
Absolutes Highlight ist „Miami“. Der Song schillert und perlt elegant mit großer Cabrio & Ray Ban-Geste. Doch unter der sonnigen Fassade des Molochs lauern kaputte, widerwärtige Gestalten, begrabene Träume und gebrochene Versprechen. Aus allem saugt der Dämon Miami seinen schwarzen Honig. „Pissing on your fucking hill. And you can’t shit me out./ ‚Cause you can’t catch me, ‚cause you’re so fat./ So fuck ya, I’m Miami!““
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


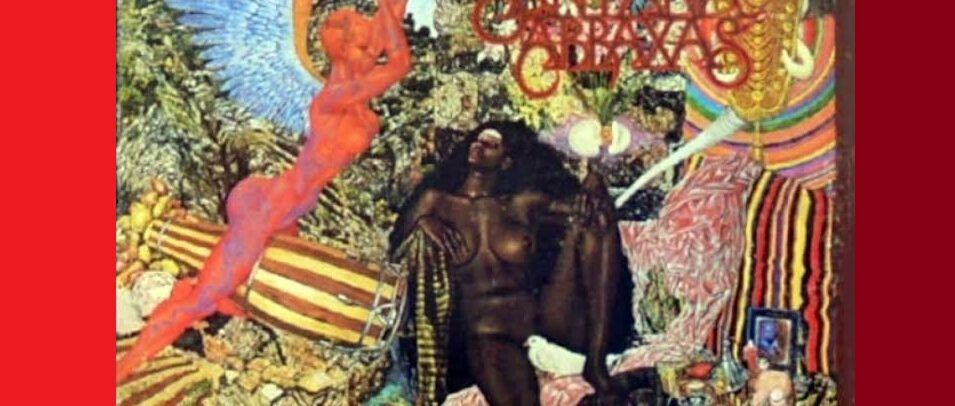

Ihr Kommentar