Es ist nun schon ein paar Wochen her, dass mein geschätzter Kolumnisten-Kollege Sören Heim sich ausführlich mit ein paar Anmerkungen von mir über Redeweisen von etwas „spezifisch Deutschem“ oder etwas „spezifisch Lyrischem“ auseinandergesetzt hat, und ich möchte nicht einen Monat vergehen lassen, bevor meine Antwort dazu erscheint.
Ich war zunächst ziemlich überrascht, dass ein Autor, der kürzlich noch sehr nachvollziehbar dargestellt hat, dass sich nicht alles, was des Sagens wert ist, klar und einfach ausdrücken lässt, eine Definition aus einem Standardwerk für maßgeblich hält, wenn es um die Frage geht, was denn wohl „das Lyrische“ sei. Er gesteht dann auch zu, dass es wohl auch andere Definitionen gäbe, dass auch immer Grenzfälle und Grauzonen existieren; aber wer nach dem Spezifischen sucht, so meint Sören Heim, der solle sich bitte an eine Definition halten. Alles andere sei etwas Diffuses und eben nichts Spezifisches. Wer einen spezifischen Begriff wolle, der schlage eine Definition nach; wer hingegen einen „frei fließenden“ Begriff wolle, könne darauf verzichten.
Was ist spezifisch?
Sören vermutet, dass wir sehr unterschiedliche Begriffe von „Spezifizität“ haben müssten; ich bin da nicht so sicher. Ein spezifischer Begriff muss ein Phänomen klar erkennbar machen, darin sind wir einig. Aber er muss das, meine ich (wohl im Gegensatz zu ihm) nicht durch eine Lexikon-Definition leisten, sondern dadurch, dass er sich im Sprachgebrauch einer Gemeinschaft bewährt. Ein solcher Begriff kann durch Beispiele und Versuch und Irrtum eingeübt werden.
Im Ergebnis kommt es dazu, dass in einer solchen Gemeinschaft Sätze verwendet und verstanden werden wie: „Dieser Text ist geradezu das Paradigma des Lyrischen“, oder „Dies sieht zwar aus wie ein Gedicht, aber es ist vollkommen unlyrisch.“ Oder „Dieser Text ist zwar eine Erzählung, aber er ist unglaublich lyrisch geschrieben“.
In der Gemeinschaft, in der solche Sätze verstanden werden, werden auch Begründungen gegeben, verstanden, akzeptiert und verworfen. Dies geschieht nicht durch Verweise auf Lexika; denn wie Sören Heim selbst schreibt, lässt sich jede Definition durch eine andere ersetzen. Die Begründung erfolgt tatsächlich durch Verweise auf nachvollziehbare Attribute: „Sprich das doch mal laut, spürst du nicht die Rhythmik?“ könnte jemand sagen, und ein anderer würde erwidern „Da ist zwar Rhythmik, aber sie ist hölzern, ganz unmelodisch“ usw.
Diese Gespräche würden zeigen, dass die Sprachgemeinschaft tatsächlich einen gemeinsamen Begriff des Lyrischen hat, der ziemlich spezifisch ist, denn es ist klar, dass die Beurteilung, ob ein Text nun lyrisch ist oder nicht, ganz und gar nicht beliebig ist, dass jeder, der sich an der Beurteilung beteiligt, eine klare Meinung hat, für die er gute Gründe vorbringt, und dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, andere zu überzeugen. In so einer Gemeinschaft herrscht es Einigkeit darüber, dass es auf lange Sicht die Möglichkeit gibt, einen Konsens über die Frage herzustellen, ob ein Text als lyrisch angesehen werden kann, oder nicht. Man wird einzelne Elemente heranziehen, man wird Beispiele zum Vergleich nehmen, bei denen man bereits einig ist, usw.
Grauzonen und Grenzfälle
Gerade die Tatsache, dass man Definitionen als mehr oder weniger brauchbar ansehen kann, dass man Grenzfälle und Grauzonen kennt, dass man auch Fälle, die gemäß Definition gar nicht zum Bezirk des Begriffs gehören, durch Verwendung eben dieses Begriffs charakterisieren kann: all das zeigt, dass man schon vor aller theoretischen Analyse über einen sehr spezifischen Begriff verfügt.
All das kann man nun auch für das „spezifisch Deutsche“ so finden: man ersetze in meinem obigen Text einfach „lyrisch“ durch „deutsch“ und „Text“ wahlweise durch „Person“ oder „Verhalten“ und man wird sehen, dass es da keinen großen Unterschied gibt. So wird man vielleicht „ordnungsliebend“ oder „exakt-pedantisch“ und weiteres als Attribute heranziehen, wo ich oben von der Rhythmik in der Lyrik sprach – auch andere Begriffe sind sicher möglich -, und man wird sehen, dass sich ganz ähnliche Gespräche über Spezifisches führen lassen. Und das, was dabei charakterisiert wird, erläutert eben auch das Erleben von Vertrautheit und Fremdheit, das jemand empfindet, der Verhalten und Personen beobachtet, so, wie jemand, der viele verschiedene Gedichte gelesen hat, bei einem weiteren Text die Vertrautheit des Lyrischen oder die Fremdheit des Prosaischen erlebt.
Sören Heim verweist aber noch auf etwas anderes, das mir in diesem Zusammenhang interessant erscheint. Er sagt, dass er Vertrautheit vielleicht eher in einem französischen Dorf als in einer deutschen Großstadt erlebt, und dass es dem Berliner doch wahrscheinlich gerade umgekehrt gehen könnte. Das ist natürlich richtig. So, wie ein Text nie nur als lyrisch bezeichnet werden kann, sondern z.B. auch einen Inhalt, einen Bezug zu bestimmten aufgerufenen Bildern und zu bestimmtem zeitlichen Kontext aufweist, und deshalb fremd erscheinen kann, selbst wenn er lyrisch vertraut klingt, so gilt diese Beobachtung noch stärker für das menschliche Verhalten. Ob die Vertrautheit aufgrund nationaler Zugehörigkeit für das Wohlgefühl des Einzelnen das Entscheidende ist, ist sicher von vielen Einflussfaktoren abhängig.
Vertrautheit und Fremdheit
Und überhaupt ist natürlich der Bezug auf die Nation letztlich fragwürdig, auch wenn der Nationalstaat einiges geprägt haben dürfte, was wir heute als spezifisch Nationales empfinden. Aber regionale Zugehörigkeiten, das spezifisch Westfälische, das spezifisch Rheinländische oder Bayrische, sind wohl weit mehr vertraut oder fremd als es das spezifisch Deutsche ist, das gleichwohl immer wieder im Verhalten durchscheint. Und da mag auch der Westfale mit dem Holländer viel vertrauter sein als mit dem Württemberger. Umso mehr dem Menschen allerdings der Bezug zum Regionalen verloren geht, und die mediale und regionale Mobilität zunimmt, desto stärker kann die nationale Vertrautheit, die durch die Muttersprache vermittelt wird, für ihn an Bedeutung gewinnen. Aber das wäre eine neue Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


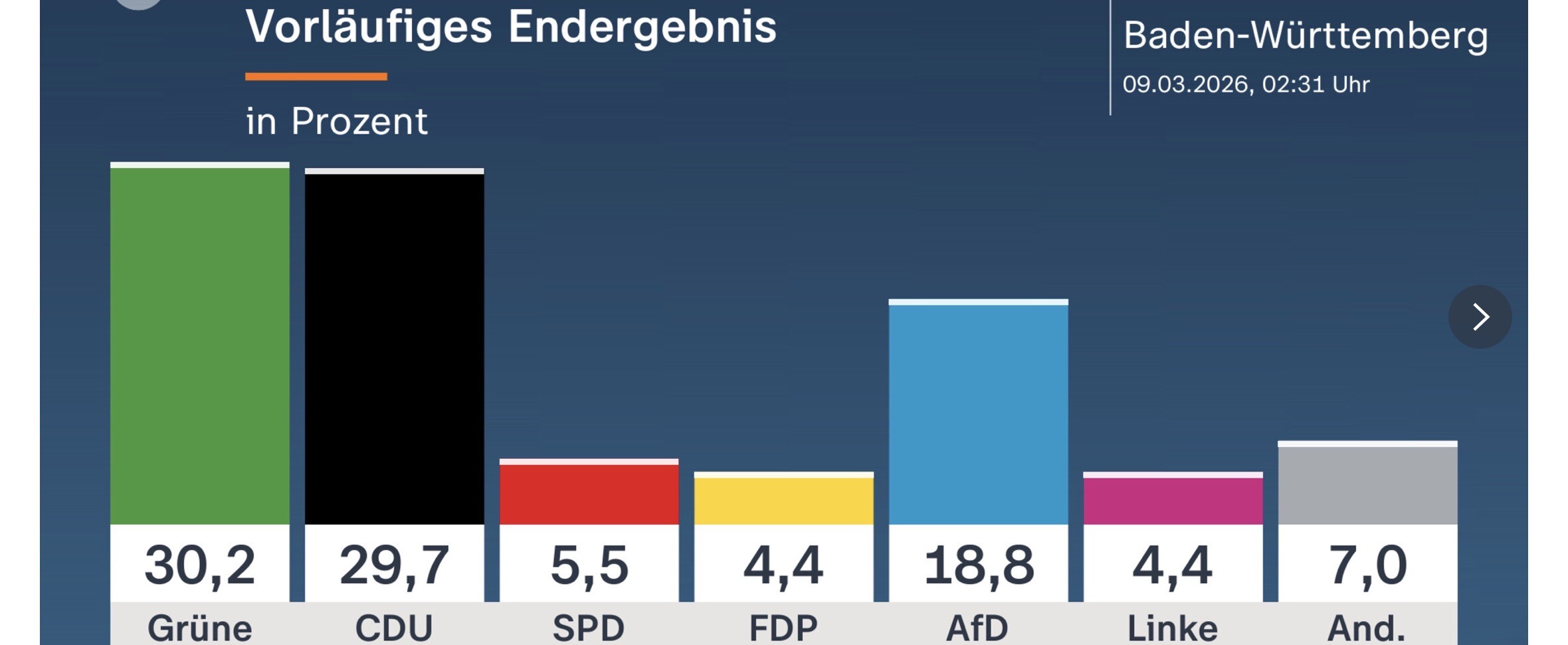


UJ
Für mich stellt sich in dieser Diskussion die Frage ob man, wie Sie es tun, Herr Friedrich, so einfach vom „spezifisch Lyrischen“ zum „spezifisch Deutschen“ schreiten kann. Für mich sind das zwei verschiedene Kategorien.
Ihr Deutschsein haben sich die meisten Deutschen passiv erworben: Sie wurden als Kind deutscher Eltern geboren. Aktiv etwas für ihr Deutschsein tun, müssen ausschließlich Menschen, die eingebürgert werden wollen.
Mit Lyrik, ebenso wie mit Kunst und Musik, verhält es sich anders. Sie werden aktiv von Menschen hervorgebracht – in der Regel im vollen Bewusstsein dessen, in welche Kategorie ihr Werk gehört oder zumindest gehören sollte und, normalerweise, mit der Absicht, dass andere Menschen ihr Werk rezipieren.
Die Rezeption eines solchen Werkes erfolgt dabei nicht zwingend einer binären Logik, nach dem Motto: Ist das Lyrik oder nicht? Oder: Ist das Musik oder Krach? Ganz zu schweigen von: Ist das Kunst oder kann des weg? Keine Frage, solche Gespräche gibt es natürlich auch, meist aber gehen wir in derlei Diskussionen mehr ins Detail. Wir diskutieren darüber, ob ein Werk „gut“, im Sinne von spannend, anregend, innovativ, ergreifend, berührend etc. ist. Oder wir gehen noch weiter und diskutieren, warum uns dieses Werk als „gut“ oder „schlecht“ erschien und wie sein Urheber eben diese Wirkung erreichte.
Im letzteren Falle sind wir dann in ein Gespräch geraten, in dem wir uns dem handwerklichen Aspekt eines Werkes widmen, dem poietischen Aspekt von Poesie sozusagen. Ich würde behaupten, dass den meisten Menschen dieser handwerkliche Aspekt beim Betrachten von Lyrik, aber auch Kunst oder Musik sehr wichtig ist, weil er eine (halbwegs) objektive Gesprächsgrundlage bietet. Ein Missachten/Ignorieren dieses Aspektes führte zu totaler Beliebigkeit.
Um ein Beispiel zu geben: Ich hatte während meine Schulzeit in Kunst meist eine 3, weil ich, zugegebenermaßen, über keine sehr ausgeprägte zeichnerische Begabung verfüge. Ab Klasse 9 jedoch mussten wir keinerlei Vorgaben in unseren Werken mehr erfüllen, außer dass diese grob zum Thema passen sollten („Schrei“, „Freundschaft“ etc.). Außerdem sollten wir einen Aufsatz zu unserem Bild schreiben. Prompt zählte ich zu den Klassenbesten. Kunst isch, wenn ma‘ drüb’r schwätzt.
Sind es diese handwerklichen Aspekte eines Werkes, die es ermöglichen, eine halbwegs objektive Gesprächsgrundlage zu finden, so können sie auch bei der Diskussion der Frage helfen, was denn nun spezifisch für Lyrik, Kunst etc. sei.
Beim „spezifisch Deutschen“ sieht es anders aus. Deutsch bin ich, weil es in meinem Pass steht. Strenggenommen müsste ich nicht einmal die deutsche Sprache beherrschen, unsere Regierungssystem begreifen, oder mich in deutscher Geschichte auskennen. Als Kind deutscher Eltern geboren zu sein, genügt. Ich verliere mein „Deutschsein“ nicht, wenn ich unpünktlich bin, die Kehrwoche nicht einhalte oder nicht weiß, was am 30.1.1933 geschah. Im Gegensatz zu Ausländern, die sich einbürgern lassen wollen, muss ich mich keiner Prüfung unterziehen.
Lange Rede kurzer Sinn: das spezifisch Lyrische und das spezifisch Deutsche sind zwei verschiedene Kategorien. Ersteres bringt der Mensch aktiv hervor, letzteres ist man durch passives Erleiden.