Ein politisch Lied! Pfui! Ein garstiges Lied! Das, was Goethe einem Zecher in Auerbachs Keller in den Mund gelegt hat, dürfte ein Teil der Moskauer Elite nach dem Sieg der Ukraine beim diesjährigen Eurovision Song Contest, kurz ESC, empfunden haben. Dabei war der Beitrag „1944“ der Sängerin Jamala im Gegensatz zu vielen anderen alles andere als garstig. Die gebürtige Krimtatarin hat Charme und Ausstrahlung, der Song ist mit seiner Mischung aus Moritat, Elektrobeats und orientalischer Folklore originell arrangiert.
Nur: Ohne seine politische Botschaft, die Anklage der Vertreibung der Krimtataren durch Stalin in der UdSSR im Jahr 1944, hätte das Lied nicht funktioniert – oder wäre zumindest nicht auf einem vorderen Rang gelandet. Insofern dürfte die russische Kritik, die Europäische Rundfunkvereinigung (European Broadcasting Union – EBU) habe mit der Zulassung des ukrainischen Beitrags gegen ihre eigenen Regeln verstoßen, im Kern berechtigt sein. Denn politische Botschaften sollen beim ESC eigentlich draußen bleiben. Das Vehikel der Ukrainer, Jamala beschreibe in ihrem Song lediglich die Gefühle ihrer deportierten Großmutter, wirkt allzu offensichtlich gekünstelt.
EBU schafft gefährlichen Präzedenzfall
Die EBU könnte somit einen gefährlihen Präzedenzfall geschaffen haben. Was soll man künftig Armeniern oder Aserbaidschanern sagen, die von den Traumata ihrer Angehörigen in den Scharmützeln und Kriegen um Berg-Karabach singen wollen? Oder einem Vertreter aus einem Balkanstaat, der Vorfälle aus den post-jugoslawischen Sezessionskriegen zum Thema machen möchte? Es wird spannend zu sehen, ob Jamala Nachahmerinnen oder Nachahmer findet, die versuchen, mit Politik zu punkten. Die Wahrscheinlichkeit erscheint groß. So wimmelte es dieses Jahr nur so von Klonen oder Epigonen des schwedischen Vorjahressiegers Mans Zelmerlöw. Am weitesten weg von Zelmerlöws Rezeptur waren wohl Siegerin Jamala und die letztplatzierten Deutschen mit einem sonderbaren Sonderweg. Aber dazu gleich mehr.
Eigentlich war bereits der Sieg von Conchita Wurst vor zwei Jahren Politik pur. Nur brauchte die österreichische Travestiekünstlerin nicht mit Worten politisch zu werden. Die Kunstfigur selbst war die Politik – und das ging mit den Regeln des Wettbewerbs konform.
Australien hätte Sieg verdient gehabt
Ganz ohne Politik hätte Australien wohl den Sieg davon getragen, knapp vor den zuvor favorisierten Russen, deren Eurodancehymne aber wohl zu überambitioniert und zu sehr Zelmerlöw 2.0 war. Dagegen lieferte die Australierin Dami Im, in sich ruhend und unprätentiös, eine stark arrangierte Pop-Ballade ab, die mit Sicherheit auch außerhalb des ESC-Mikrokosmos funktioniert.
Die einzige Kritik, die nach einem Sieg „Down unders“ hätte laut werden müssen: Warum ist der fünfte Kontinent bei einem europäischen Musikwettbewerb überhaupt dabei? Die Vorwegnahme einer möglichen Süderweiterung der Europäischen Union kann als eher unwahrscheinlich angesehen werden. Zumal Australien dann prompt großer Nettozahler wäre und seine sehr rigide Einwanderungspolitik auf den Prüfstand stellen müsste.
Im Popbereich indes hat das Land vom anderen Ende der Welt in den vergangenen Jahren mit Kylie Minogue, Natalie Imbruglia und Vanessa Amorosi einige international erfolgreiche weibliche Stars hervorgebracht. Mit denen kann sich Dami Im messen. Eine so große Popnation kann wohl auch richtig einschätzen, was das eigentliche garstige Lied des ESC-Abends war: der deutsche Beitrag, der zu recht mit klarem Abstand auf dem letzten Platz landete.
Verschwörungstheorien ziehen nicht
So schrieb ein australisches Nachrichtenportal, dass Sängerin Jamie-Lee Kriewitz wie eine japanische Touristin wirke, die in einem Berliner Club zu viel gefeiert habe. Ihr Lied sei nichts besonderes gewesen, ihr Outfit aber noch schlechter. Die Australier dürften der Wahrheit damit näher kommen, als alle Verschwörungstheoretiker, die das Abschneiden Deutschlands in eine Abstrafung für die Europapolitik der hiesigen Bundeskanzlerin umdeuten. Auch wenn der ESC schon immer politisiert war, selbst das russische Fernsehpublikum ließ Ukrainerin Jamala Punkte zukommen. Und die Ukrainier voteten für den Eurodance made in Moskau. Deshalb: Gemach, gemach, liebe Verschwörungstheoretiker!
Der hierzulande verantwortliche Sender NDR muss sich daher ernsthaft eine paar kritische Fragen gefallen lassen. Die beiden schwedischen Moderatoren parodierten in einer Pausennummer, was ein Song brauche, um beim ESC erfolgreich zu sein. Ihre nicht ganz ernst gemeinte Antwort: Glamour, Kostüme, Beats, ein wenig nackte Haut, Charme, Folklore sowie Themen á la Frieden oder Liebe. Also kurz gesagt: All das, was der deutsche Beitrag nicht zu bieten hatte.
Sonderbares Manga-Mädchen
Empathie ist hierzulande seit Monaten ein viel bemühtes Wort. Also seien wir empathisch und versetzen uns einmal in – sagen wir – irische, albanische oder gar australische Fernsehzuschauer. Wieso sollen die einem sonderbaren Manga-Mädchen, das in einem noch sonderbaren Outfit durch einen künstlichen Gruselwald spaziert und dazu ein nichtssagendes Liedchen trällert, Stimmen geben? Wer darauf eine plausible Antwort geben kann, darf dank der Kraft seiner Illusion auch mit einer Verschwörungstheorie wiederkommen. Ansonsten kann man getrost der Meinung sein, dass selbst der Gnadenpunkt der georgischen Jury noch ein äußerst freundliches Geschenk für Jamie-Lee & Co. war.
Ansonsten war das Niveau des diesjährigen ESC-Jahrgangs musikalisch durchaus akzeptabel. Es dominierten eingängige Popsongs, die auffällig oft von schwedischen Autorenteams konzipiert wurden. Do it like Zelmerlöw, hätte das Zweitmotto des ESC lauten können.
Viel Mainstream-Pop und Schwedenstyle
Die Damenwelt zog Glitzerkleider diesmal allzu viel Textilfreiheit vor, die Herren wählten Lederjacken und Löcherjeans als gängiges Outfit. Briten, Spanier und Franzosen konnten sich mit etwas frischeren Beiträgen von den Deutschen absetzen. Auch das italienische Hippie-Mädchen, das wider erwarten nicht „Karl der Käfer wurde nicht gefragt“ sang, hatte seine Fans. Zypern schickte eine schräge Bon-Jovy-Cover-Band, die offenbar in Käfighaltung lebt. Allzu viel Punkte gab es dafür nicht.
Was fehlte waren schrille oder schräge Nummern sowie der früher häufiger aufgeführte typische Balkanstyle. In Ansätzen ließ ihn die kroatische Teilnehmerin anklingen, deren Outfit dann aber fast so daneben war, wie das von Jamie-Lee. Ein polnischer Minipliträger mit Wallemähne (Mischung aus Phantom der Oper und Wolle Petry) wurde stylingtechnisch zwar ebenfalls negativ auffällig, warum dessen Kitschbalade dann im Zuschauervoting so hoch gewertet wurde, war das eigentliche Mysterium des Abends.
Hamburger Armenierin desklassiert Jamie-Lee
Für Deutschland endete es indes mehrfach peinlich: Sowohl die Österreicherin Zoe als auch die aus Hamburg stammende Armenierin Iveta Muchuchyan deklassierten Jamie-Lee. Es hätte für Deutschland wohl selbst dann nicht schlimmer enden können, wenn – sagen wir einmal – Michael Wendler oder der aus „Goodbye Deutschland“ bekannte Schlagernovize Jens Büchner angetreten wären.
Zoe dagegen landete mit ihrem zuckersüßem, auf französisch vorgetragenen Chanson „Loin d ´ici“ weit vor dem deutschen Beitrag auf Platz 13. Ihr Lied, das irgendwie an Louane erinnert und die „fabelhafte Welt der Amelie“ aufleben lässt, traf den Massengeschmack offenbar weitaus besser, als eine schlechte K-Pop-Kopie made in Germany. Muchuchyan schaffte mit kraftvoller Ausstrahlung und wuchtigen Elektrobeats sogar Rang Sieben.
So war die eigentlich Erkenntnis des Abends: Ein politisches Lied muss nicht garstig sein – und ein garstiges nicht politisch.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

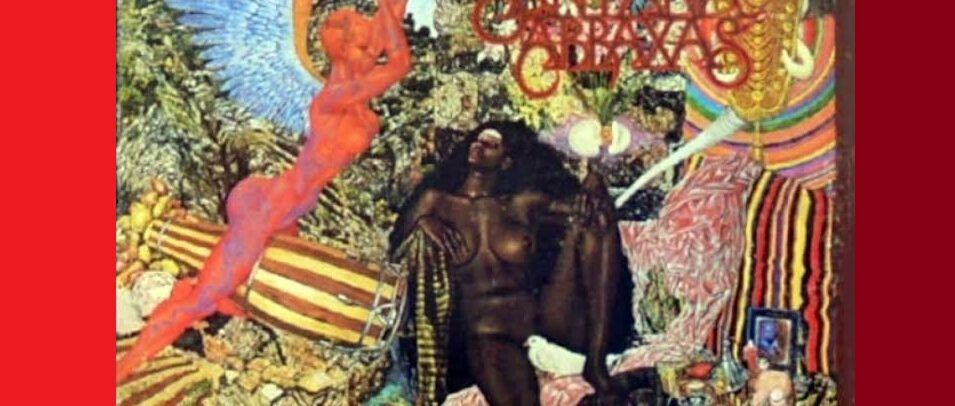

derblondehans
… au ja, … soll Heino ein nicht garstiges Lied beim nächsten ESC vortragen. Für meine, aus ihrer Heimat, völkerrechtswidrig, vertriebenen Ahnen. Oder?