Noch ist nicht absehbar, wie die Geschichte einmal über die Präsidentschaft Barack Obamas urteilen wird. Müsste man aus heutiger Sicht eine Prognose wagen, dann wohl etwa die: Eine verheerende Nahostpolitik steht klugen Impulsen in Richtung Lateinamerika gegenüber, einer Region, die den Vereinigten Staaten lange Zeit geographisch zwar sehr nahe war, sich emotional aber so weit wie möglich absetzen wollte.
In seinem letzten Amtsjahr hat Obama gerade zwei historische Staatsbesuche hinter sich gebracht: Die erste Visite eines US-Präsidenten seit Dekaden im einst verfemten sozialistischen Kuba und sofort im Anschluss die Reise nach Argentinien zu Mauricio Macri, der sich gerade mit Reformen im Eiltempo zum Hoffnungsträger eines ganzen Subkontinents entwickelt.
Macri spricht nicht vom Wandel, er schafft ihn
Ähnlich wie einst Obama ist Macri vor allem deshalb gewählt worden, weil sich ein Volk nach lähmenden Jahren unter unpopulären Vorgängern einen radikalen Wandel erhofft hat. Obama sollte die Wunden der aggressiven Außenpolitik George W. Bushs heilen, Macri indes sollte Argentinien nach Jahren des wirtschaftlichen Niedergangs neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnen. So waren die einst so stolzen und in Südamerika ökonomisch dominierenden Argentinier infolge peronistischer Günstlingswirtschaft zu Almosenempfängern verkommen. 40 Prozent der Bevölkerung lebte in den letzten Jahren der Herrschaft von Cristina Kirchner auf Staatskosten. Armutsstatistiken wurden von der launischen Regentin nicht mehr veröffentlicht. Angeblich, um die Betroffenen nicht zu demütigen, in Wahrheit wären sie zu Zahlen gewordenen Abrechnungen mit der konfusen Wirtschafts- und Sozialpolitik einer sprunghaften Staatschefin und ihrer korrupten Entourage geworden.
In einigen Punkten unterscheidet sich Macri jedoch fundamental von seinem Gast Obama. Während gebürtige Hawaiianer den Wandel vor allem schön beschrieben hat, handelt der Ex-Manager des Maradona-Clubs Boca Juniors. In den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit brachte er beispielweise mehr Reformprojekte an den Start, als eine durchschnittliche deutsche Regierung in einer ganzen Legislatur: Der Zugang zu Devisen ist wieder frei, den Wert des argentinische Peso taxiert wieder der Markt, die absurden Importrestriktionen, die vielen Firmen und der einst so mächtigen Agrarwirtschaft den Garaus gemacht haben, wurden gecancelt, ebenso die umstrittenen Exportsteuern auf landwirtschaftliche Produkte. Das Statistikinstitut Indec, das Wirtschaftsdaten im Sinne der Ex-Präsidentin aufhübschte, wird umgebaut. Auch das umstrittene Mediengesetz, mit dem Kirchner die Kritik der mächtigen Clarín-Mediengruppe verstummen lassen wollte, hat Macri teilweise aufgehoben. All das ohne eigene Mehrheit im Parlament und mit einer mächtigen peronistischen Opposition sowie einer rachsüchtigen Volkstribunin Kirchner im Nacken.
Balanceakt im Parlament
Selbst einen Deal mit den Hedgefonds, bei denen Argentinien dick in der Kreide steht, konnte der einstige Bürgermeister von Buenos Aires erreichen. Auf 25 Prozent ihrer Forderungen wollen die „Geier-Fonds“ („fondos buitres“), wie Kirchner diese einst beschimpfte, verzichten. Das Andenland hätte endlich wieder freien Zugang zu den Kapitalmärkten, in die brachliegende Industrie könnte groß investiert werden. Unternehmen in- und außerhalb Argentiniens träumen schon von der Bonanza am Rio de la Plata, der geschrumpfte Mittelstand hofft auf seine Wiederauferstehung.
Doch Macri pokert hoch in einem Spiel mit vielen Unbekannten. Zum einen muss er die Inflation im Griff behalten. Zwar verbilligen sich nach der Freigabe des Pesos die Exporte, und argentinische Waren werden für die Welt attraktiver. Doch gerade kriseln Staaten wie China, die einst an den Rohstoff- und Nahrungsmittelmärkten groß einkaufen konnten. Die Gleichung „Billigere Exporte führen zu mehr Produktion, mehr Produktion führt zu mehr Beschäftigung und mehr Beschäftigung führt zu mehr Wohlstand“, sie muss in diesem Umfeld nicht unbedingt aufgehen.
Damoklesschwert Inflation
Gleichzeitig verteuert ein schwacher Peso die Einfuhren. Und wenn mehr argentinische Waren ins Ausland gehen, dann wird der Rest, der im Land bleibt, für die Argentinier teurer. Die klassische Ausgangsbasis für Inflation. Im Normalfall reagieren Gewerkschaften auf steigende Preise mit höheren Lohnforderungen. In Argentinien allemal, wo die Gewerkschaften den Peronisten der Kirchners bedenklich nahe stehen und zudem tief in der Bevölkerung verankert sind. Steigen die Löhne zu stark, könnte der Exportvorteil einer Weichwährung schnell zu Nichte gemacht sein.
Macri muss die Balance finden, zwischen angemessenen Löhnen, die das soziale Gleichgewicht nicht gefährden und einer für die Exportwirtschaft auskömmlichen Kostenstruktur. Der Grat dabei könnte sehr schmal sein. Der Staatschef tanzt auf dem Hochseil. Aber immerhin er tanzt – und das ohne Netz und doppelten Boden. Was für ein kultureller Wandel in einem Land, in dem Politik Jahrzehnte lang vor allem darin bestand, allen alles zu versprechen und dem Volk schrille Inszenierungen zu bieten. Dabei wurden ständig Wechsel auf die Zukunft ausgeschrieben oder die Kosten in Form von galoppierender Inflation gerade an die Armen und den Mittelstand weitergereicht. Ob Bewegungsgründer Juan Domingo Peron, der neoliberale Carlos Menem in den 80er Jahren oder zuletzt die Kirchners: Die Show peronistischer Präsidenten war stets um ein Vielfaches besser als ihre Regierungsbilanz.
Macherqualitäten als Bürgermeister bewiesen
Als Redner indes liegt Macri weit hinter anderen südamerikanischen Politikern – und auch hinter Obama – zurück. Die südamerikanische Floskel „Gebt mir einen Balkon und das Land gehört mir“, auf den Argentinier trifft sie definitiv nicht zu. Er wurde gewählt, weil er sich einen Namen als ideologiefreier Macher erwerben konnte. Als Hauptstadtbürgermeister ebenso wie als Sportfunktionär.
Aus den hochverschuldeten Boca Juniors machte er einen rentablen Verein, der sportlich reüssiert ohne seinen Nimbus als Kultclub der Armen aus dem Hafenviertel über Bord zu werfen. Und im Moloch Buenos Aires hat Macri dafür gesorgt, dass Millionen Menschen eine bessere Wasserversorgung, eine effizientere Abfallentsorgung und einen besseren Anschluss an den Nahverkehr haben. Auch deshalb war der verstoßene Sohn eines der reichsten Männer der Metropole sogar den Ärmsten der Armen vermittelbar. Während Cristina Kircher ihnen vor allem Gefühl und große Sprüche gab, verschaffte Macri ihnen sauberes Wasser und kürzere Anfahrten zur Arbeit.
Präsident als Brückenbauer
Kirchners Monologe mögen kurze Zeit für Ekstase sorgen, Macris Taten sind nachhaltiger. Und das wissen auch die peronistischen Parlamentarier, die der Staatschef für seine Reformen ins Boot holen muss. Und so setzt dieser darauf, mit frischem Geld große Infrastrukturprojekte in den Provinzen anzustoßen, die lokale Abgeordnete nur schwer ablehnen können. Als Gegenleistung wird er wohl das eine oder andere Ja zu einem Gesetzesprojekt einfordern. Und wie man Kompromisse und Parteien übergreifende Mehrheiten schmieden kann, das hat der Macher der kleinen Dinge in der Hauptstadt zur Genüge bewiesen. So weihte er Denkmäler für Juan Peron ebenso ein, wie Straßenneubauten in den Hochburgen der Peronisten. Bei Macri ist die Wahrheit konkret, sie verschwindet nicht in den Wolken populistischer Volksreden.
So war es ein kluges Signal von Obama, Macri gerade jetzt den Rücken zu stärken. Südamerika ist ein Kontinent im Umbruch, eine Region auf der Suche nach neuen Wegen. Die linkspopulistische Regierung in Venezuela, die lange Zeit den Diskurs auf dem Subkontinent prägte, ist ökonomisch ruiniert und moralisch diskreditiert. Nicht einmal gefälschte Wahlen konnte die sozialistische Partei des früheren Präsidenten Hugo Chávez noch gewinnen. Unter dessen Nachfolger Nicolas Maduro, dem jedes Charisma und jedes Fortune fehlt, ist das ölreiche Land zum Armenhaus und Gewaltlabor verkommen. Nur politische Taschenspielertricks, Drohungen des regimetreuen Militärs und eine willfährige Justiz verhindern bisher, dass die Opposition, die jetzt über eine parlamentarische Mehrheit verfügt, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Maduro starten kann. Als Modell für die Region fällt das chavistische Venezuela aus.
Wiedergeburt Argentiniens?
Auch der andere Machtfaktor in Südamerika, das sozialdemokratische Brasilien, durchlebt derzeit eine schwierige Phase. Im Gegensatz zu den venezolanischen Chavisten kann die Arbeiterpartei von Präsidentin Roussef auf eine erfolgreiche Bilanz verweisen. Jahre lang kannte das Wachstum in Brasilien nur eine Richtung: nach oben. Zudem zeigten die Sozialreformen von Roussefs Vorgänger Lula da Silva Wirkung. Millionen von Brasilianer steigen von der Armut in den Mittelstand auf. Zudem gelangen Lulas Regierung enorme Fortschritte bei der Industrialisierung. Ganz Südamerika fährt Autos made in Brasil, die Bank Itau zählt zu den mächtigsten Instituten des Kontinents und Flugzeuge der Marke Embraer finden sich auch in der Flotte der Lufthansa. Selbstbewusst bestimmte Brasilien in der BRICS-Gruppe mit Russland, China, Indien und Südafrika sogar Teile der Weltpolitik mit. Doch nach rund 15 Jahren an der Macht zeigen sich bei der Arbeiterpartei Begleiterscheinungen, die auch in älteren Demokratien nicht unüblich sind: Konjunktureinbrüche, Arroganz der Macht und schleichende Korruption. Allerdings stehen nicht nur irgendwelche Minister oder Funktionäre im Fadenkreuz der Korruptionsvorwürfe, sondern die Präsidentin und ihr Vorgänger im Amt persönlich. Auch das einstige Powerhaus Brasilien ist daher momentan nicht in der Lage, die Führung auf dem Subkontinent wahrzunehmen. Alle Augen richten sich auf Macri und die sich abzeichnende Wiedergeburt Argentiniens.
Bewunderung und Respekt für den Macher gehen so weit, dass selbst den Peronisten nahestehende Argentinier stolz sind auf den Mann, der wie ein Orkan ihr Land verändern will. Vorbei die Zeit der Demütigungen, als die einst als Bauern oder Chaoten herabgewürdigten Nachbarn aus Chile oder Brasilien den Ton in Wirtschaft und Politik angaben. Gegen die ständig an Glanz und Rückhalt verlierende chilenische Präsidentin Michelle Bachelet oder die unter Korruptionsverdacht stehende Brasilianerin Dilma Roussef wirkt Macri tatsächlich wie Mr. Cool persönlich. Erstmals beneiden Chilenen und Brasilianer die Argentinier um einen Präsidenten. Das will wirklich viel heißen.
Pragmatismus statt Ideologie
Nach 100 Tagen allerdings war auch Obama noch ein Hoffnungsträger. Viel hat er seitdem an Strahlkraft verloren. Wird es Macri ähnlich ergehen? Manche Probleme teilt er in der Tat mit dem US-Amerikaner: Ein schwieriges wirtschaftliches Erbe, eine gespaltene Nation und eine ihm feindselig gesonnene parlamentarische Mehrheit. Es gibt jedoch auch Unterschiede: Macri hat es bisher verstanden, zu versöhnen statt zu spalten. Auch beim gemeinsamen Gedenken an die Opfer der Militärdiktatur mit Obama fand er, der Patriziersohn, die richtigen Worte. Zudem tritt er nicht missionarisch, besserwisserisch oder visionär auf. Sein Kalkül ist eher: Es gibt keine peronistischen Straßen und keine liberalen Buslinien. Entscheidend ist, dass die Menschen sie wollen und nutzen. Eine solche Einstellung sollte nicht nur in Argentinien Konsens sein.
Macri und wie er die Welt sieht: Ganz Südamerika täte in der Tat gut daran, etwas von diesem Modell zu adaptieren. Und Obama tut gut daran, dem Pragmatiker weiter den Rücken zu stärken. Versöhnen statt spalten, für die Außenwirkung der USA in Südamerika wäre das nicht das schlechteste.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
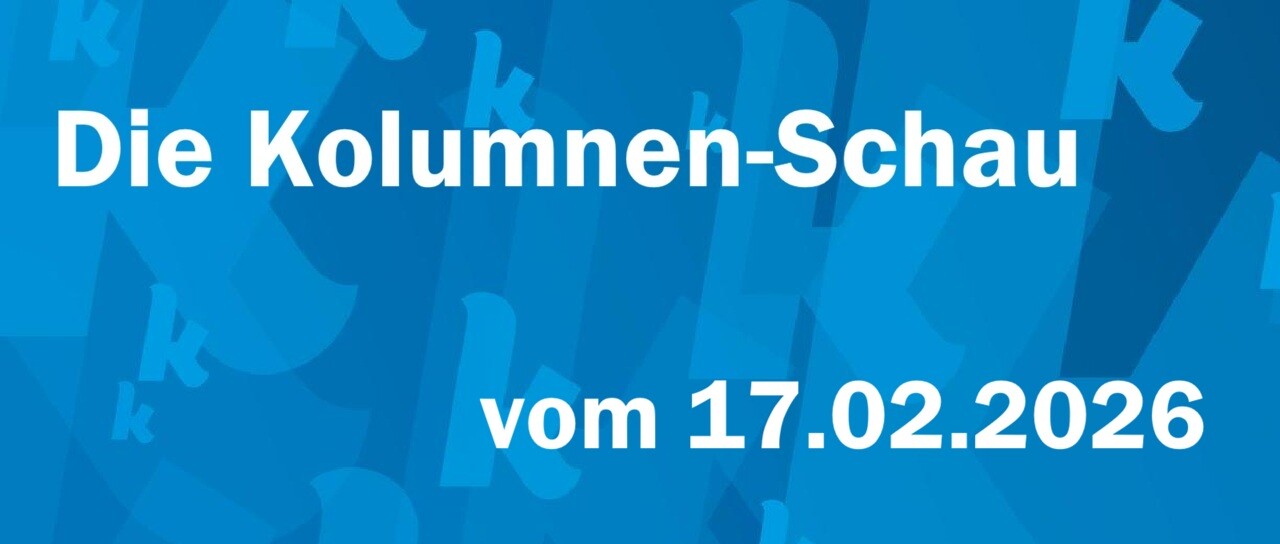


Ihr Kommentar