Wenn man die Entwicklung des Zarenreiches im ausgehenden 19. Jahrhundert mit derjenigen des postsowjetischen Russland vergleicht, könnte man der Versuchung erliegen, der russischen Geschichte einen zyklischen Charakter zuzuschreiben. In beiden Fällen erlebte Russland Tauwetterperioden, ja Revolutionen von oben, die das Land bis zur Unkenntlichkeit veränderten. Diese Erneuerungen des bestehenden Systems bzw. der Systemwechsel gingen aber in beiden Fällen für die herrschende Bürokratie zu weit. Und so erlebte Russland nach der Ermordung des reformgesinnten Zaren Alexander II. durch die Terroristen der Narodnaja Wolja (Volkswille bzw. Volksfreiheit) am 1. März 1881 ebenso wie nach dem freiwilligen Rücktritt Boris Jelzins vom Amt des russischen Staatspräsidenten am 31. Dezember 1999 eine autoritäre Wende, einen Versuch, den in der Reformperiode partiell demontierten Obrigkeitsstaat in vollem Umfang zu restaurieren.
Konstantin Pobedonoszews Kampf gegen die Moderne
Im Zarenreich der Jahrhundertwende verkörperte diesen Versuch des herrschenden Establishments, die unbotmäßig gewordene Gesellschaft erneut zu disziplinieren, der einflussreiche Berater der beiden letzten russischen Zaren Konstantin Pobedonoszew, der zugleich Oberprokuror des Heiligen Synod – des obersten Organs der Russisch-Orthodoxen Kirche –in den Jahren 1880-1905 war. Da das politische Programm Pobedonoszews erstaunliche Ähnlichkeiten mit manchen Ideologemen der Putinschen „gelenkten Demokratie“ aufweist, möchte ich auf einige programmatische Vorstellungen des Oberprokurors eingehen.
Pobedonoszew hielt Reformen und Zugeständnisse der Autokratie an die Gesellschaft für völlig überflüssig, da sie nur von einer verschwindenden Minderheit der russischen Bevölkerung gefordert würden. Die absolute Mehrheit der Russen hingegen wolle mit fester Hand regiert werden, so Pobedonoszew. Im Gegensatz zu den liberal gesinnten Teilen der russischen Bildungsschicht sei das einfache russische Volk absolut zarentreu. Es wolle, so Pobedonoszew, nichts von einer Verfassung wissen und könne sich eine Einschränkung der zarischen Macht nicht vorstellen. Damit dies aber so bleibe, müsse das Land von den „gefährlichen“ westlichen Ideen abgeschirmt werden.
Die oppositionell gesinnten Kreise der Bildungsschicht (die Intelligenzija) gab Pobedonoszew verloren. Die einzige Methode der Auseinandersetzung mit ihnen war für ihn Härte und Repression. Mit dem einfachen Volk glaubte er indes eine gemeinsame Sprache finden zu können. Wichtig war nur, das Volk vom Weg der Intelligenzija abzuhalten. Dies war nur durch die Erhaltung der überlieferten Anschauungen der Unterschichten möglich. Autokratie und Kirche sollten gemeinsam erzieherisch auf das Volk einwirken, um sein ursprüngliches Weltbild vor den Einflüssen der Moderne zu schützen. Im Ergebnis bedeutete diese Konzeption aber eine dauernde Bevormundung der Unterschichten durch die weltliche und kirchliche Obrigkeit.
In seinem aussichtslosen Versuch, die in Bewegung geratene Welt künstlich aufzuhalten, erinnert Pobedonoszew in gewisser Weise an Metternich. Beide sahen die immer stärker werdenden Kräfte der Moderne auf sich zukommen und wurden deshalb immer pessimistischer. Sie waren sich über die Chancenlosigkeit ihres Unternehmens wohl im Klaren. Der englische Historiker Matthew S. Anderson nannte Metternich einen quasi „Fortschrittsgläubigen“, da dieser gespürt habe, dass sein System infolge des weiteren Fortschritts unvermeidlich zusammenbrechen würde. Die These Andersons lässt sich auch auf Pobedonoszew übertragen.
Sergej Wittes Modernisierungsvisionen
Aber es waren nicht nur die Kräfte der Moderne an sich, die der Verwirklichung des Programms des Oberprokurors im Wege standen. Er hatte auch mächtige Kontrahenten innerhalb des Petersburger Kabinetts selbst. Zu den bedeutendsten von ihnen gehörte der damalige Finanzminister Sergej Witte (1892-1903). Im Gegensatz zu Pobedonoszew hatte Witte keine Angst vor der Zukunft. Er hielt Russland für ein Land mit unerschöpflichen Möglichkeiten, das jedoch einer grundlegenden Modernisierung bedürfe. Nur so könne es seinen Status als Großmacht bewahren und dringende soziale Probleme lösen.
1891 kam es in Russland zu einer Hungerkatastrophe, die die wirtschaftliche Rückständigkeit des Landes besonders deutlich offenbarte. Katastrophen dieser Art gehörten im hochentwickelten Westen längst der Vergangenheit an. Nun wurde es vielen Entscheidungsträgern in Petersburg, nicht zuletzt auch dem Zaren Alexander III. (1881-1894) klar, dass Russland seine wirtschaftlichen Strukturen so schnell wie möglich modernisieren müsse. Diese Erkenntnis stellte auch für Witte, dessen administrative Talente dem Zaren seit Jahren bekannt waren, eine Chance dar. 1892 wurde er zum Finanzminister ernannt und nahm sofort sein großangelegtes Programm zur Industrialisierung Russlands in Angriff. Die Quintessenz des Konzepts Wittes lässt sich aus seiner Aussage, die er einige Jahre später, nämlich 1899 machte, herauslesen: Russland werde sich entweder modernisieren oder es werde sich allmählich in eine wirtschaftliche Kolonie des Westens verwandeln.
Wittes Vision von einem modernen, wirtschaftlich unabhängigen Russland begann den Zaren Alexander III. immer stärker zu beeinflussen. Die wachsende Bedeutung Wittes im Staatsapparat führte umgekehrt zur Abnahme des Einflusses von Pobedonoszew. Witte berichtet in seiner Erinnerungen von einem Gespräch, das er mit Alexander III. führte, in dem sich der Zar recht negativ über Pobedonoszew äußerte. Dieser könne nur kritisieren, er sei aber nicht in der Lage, konstruktive Vorschläge zu machen. Von der Kritik allein könne man aber nicht leben.
Die Isolierung des Landes von der Außenwelt, die Pobedonoszew anstrebte, war mit dem Programm Wittes unvereinbar. Nur eine Zusammenarbeit mit den hochentwickelten westlichen Staaten war geeignet, die Industrialisierung Russlands zu ermöglichen. Der Finanzminister brauchte westliche Spezialisten, vor allem aber das westliche Kapital, um seine ehrgeizigen Projekte, wie etwa den Ausbau des Eisenbahnnetzes oder die Erschließung Sibiriens, in Gang zu bringen. Witte war davon überzeugt, dass die von Pobedonoszew propagierte Fremdenfeindlichkeit den Interessen Russlands nur schaden könne.
Auch in der Frage der Behandlung nichtrussischer bzw. nichtorthodoxer Völker im Zarenreich vertraten Witte und Pobedonoszew verschiedene Positionen. Pobedonoszew, für den die Bewahrung der Harmonie zwischen Selbstherrschaft, Orthodoxie und Volk im Vordergrund stand, hielt es für undenkbar, die nichtrussischen Völker bzw. die nichtortodoxen Religionen und Konfessionen der Zarenmonarchie auf die gleiche Stufe mit den Russen bzw. der Orthodoxen Kirche zu stellen, weil deren Einstellung zum Zarenideal sich grundlegend von derjenigen der orthodoxen Russen unterschied. Daher betrachtete Pobedonoszew diese Völker bzw. Konfessionen, also mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Reiches, als Bedrohung für das bestehende System. Witte hingegen hielt eine ungleiche Behandlung der Untertanen des Zaren für unangebracht. Eine große Zahl der Unternehmer, die Witte bei seinem Modernisierungsvorhaben unterstützten, war nichtrussischer Herkunft. Witte fühlte sich ihnen gegenüber verpflichtet und lehnte insoweit nationale Vorurteile oder restriktive fremdenfeindliche Maßnahmen ab. Auch die Gesetzgebung zur Beschränkung der Rechte der Juden bekämpfte er, was im damaligen herrschenden Establishment Russlands keineswegs selbstverständlich war
Wittes Bildungsideal unterschied sich ebenfalls grundlegend von demjenigen Pobedonoszews. Um das Land zu modernisieren, brauchte die Selbstherrschaft aufgeklärte, dynamische, keineswegs aber traditionellen Weltbildern verhaftete Untertanen. 1898 wies er den Zaren Nikolaus II. auf die Notwendigkeit hin, das Bildungsniveau der Unterschichten zu heben. Zwar würden sie dabei ihre ursprüngliche Naivität verlieren, dies sei jedoch unumgänglich. Das Volk müsse lernen selbst zu laufen, sogar auf die Gefahr hin, dass es dabei hin und wieder hinfalle. Nur eine aufgeklärte Bevölkerung werde den Willen entwickeln, ihren eigenen Wohlstand und damit auch den Wohlstand des Staates zu heben.
Witte legte im Gegensatz zu Pobedonoszew keinerlei Wert auf die Bewahrung der Eigenart Russlands. Ähnlich wie andere Befürworter der Modernisierung des Landes seit Peter dem Großen hielt er Russland nicht für einen eigenartigen, vom Westen grundlegend verschiedenen Staat. Die Eigenart Russlands bestand für ihn ausschließlich in seiner Rückständigkeit. Sobald es diese überwunden habe, werde es sich von den anderen europäischen Staaten in nichts unterscheiden. Auf ein spezifisches Merkmal des russischen Staatswesens wollte Witte jedoch zunächst nicht verzichten und dies war die uneingeschränkte Macht des Zaren. Er hielt die Selbstherrschaft für ein System, das sich für großangelegte Modernisierungsvorhaben besonders gut eigne. Da sie ohne Parlament regiere, könne sie ihre Entscheidungen unverzüglich in die Tat umsetzen und sich dabei eines gewaltigen bürokratischen Apparates bedienen. Es entstünden hier keine Verzögerungen, zu denen z. B. Parlamentsdebatten bzw. die parlamentarische Kontrolle der Exekutive führten.
Wittes Einsamkeit
Die größte Schwäche der Vision Wittes vom modernen und wirtschaftlich mächtigen Russland lag allerdings darin, dass er keine bedeutende gesellschaftliche Schicht für sie gewinnen, konnte. Die liberalen Gruppierungen, die ebenso wie Witte die Überwindung der russischen Rückständigkeit anstrebten, konnte Witte für seinen Plan nicht gewinnen, da zwischen den beiden zunächst das Dogma von einer uneingeschränkten Macht des Zaren stand. Die Arbeiterschaft z.B., deren Zahl erst infolge der Reformen Wittes in die Höhe geschossen war, entwickelte sich sofort zu einem der militantesten Gegner des Regimes. Auch die Bauern wollten vom Industrialisierungsprogramm nichts wissen. Nicht die Größe Russlands, sondern die ungelöste Agrarfrage stand im Zentrum ihres Interesses. Witte unterschätze aber zunächst die Schärfe dieses Konflikts. So war er der Meinung, der Schwerpunkt der Agrarfrage liege nicht auf wirtschaftlichem, sondern auf rechtlichem Gebiet. Sobald die Bauern die gleichen Rechte genießen würden wie andere Schichten der Gesellschaft, wäre das russische Agrarproblem gelöst. So sollten die Bauern das Recht auf freie Verfügung über ihr Eigentum erhalten. Das Prinzip der Unantastbarkeit des Privateigentums, das für die Bauern in der Dorfgemeinschaft (obschtschina) nicht existierte, wollte Witte auf den bäuerlichen Grundbesitz übertragen. Witte unterschätze allerdings den Umstand, dass die Bauern nicht mehr Rechte, sondern mehr Land haben wollten. Auch das Prinzip der Unantastbarkeit des Privateigentums genoss keine uneingeschränkte Zustimmung bei der russischen Landbevölkerung. Im Gegenteil, sie träumte von einer gänzlichen Enteignung der Gutsbesitzer, von der sogenannten „schwarzen Umverteilung“. Dieser Traum war aber ohne eine massive Verletzung des Eigentumsrechts der wohlhabenden Schichten nicht zu verwirklichen.
Da Witte seine Aufmerksamkeit vor allem auf die Industrialisierung des Landes und nicht auf die Lösung der Agrarfrage richtete, entzog er seinem Vorhaben in gewisser Weise selbst den Boden. Denn statt einer Lösung der Agrarfrage, verschärfte er sie nur. Die Industrialisierung trug nämlich zu ihrer Lösung zunächst nichts bei. Im Gegenteil, sie setzte eine gewisse Durststrecke voraus, da sie ohne eine erhöhte Besteuerung breiter Bevölkerungsschichten nicht zu finanzieren war. Die Bauern sahen indes nicht den Sinn hinter den Opfern, die sie bringen mussten. Sie wollten eine weitere Senkung ihres Lebensstandards nicht hinnehmen. 1901 und 1902 fanden heftige Bauernunruhen statt, die von den konservativen Gegnern Wittes zum Anlass genommen wurden, das ehrgeizige Programm des Finanzministers anzugreifen. Witte geriet nun innerhalb des herrschenden Establishments in eine weitgehende Isolation.
Wittes Glaube an die Vorzüge eines autokratischen Herrschaftssystems erwies sich also als unbegründet. In dem Zustand, in dem sich die russische Autokratie um die Jahrhundertwende befand, war sie ungeeignet, grundlegende Modernisierungsvorhaben durchzuführen. Wittes Kurs verschärfte nur die innenpolitischen Probleme des Landes statt sie zu lösen. Der amerikanische Historiker Theodore von Laue bemerkte in diesem Zusammenhang: Russland habe sich nicht schnell genug industrialisiert, um sich im Konkurrenzkampf mit den hochentwickelten Nationen zu behaupten. Vom innenpolitischen Standpunkt aus sei hingegen die Modernisierung zu heftig gewesen. Sie habe die überlieferten Strukturen in Frage gestellt und die sozialen Konflikte nur verschärft.
1903 musste Witte sein Amt als Finanzminister abgeben. Sein Programm zur Modernisierung des Landes war somit gescheitert.
Pobedonoszews Scheitern
Nicht anders erging es aber im Ergebnis auch dem Programm Pobedonoszews. Mit einer fünfzigjährigen Verspätung begannen die russischen Unterschichten um die Jahrhundertwende an die Entwicklung der Intelligenzija anzuknüpfen. Der Zarenglaube und die traditionellen religiösen Vorstellungen der Volksschichten begannen zu bröckeln. Der lange Kampf zwischen der Opposition und der Autokratie um die „Seele des Volkes“ sollte sich nun zugunsten der ersteren entscheiden. Die Abschaffung der Leibeigenschaft in der Epoche der Reformen Alexanders II. (1861) trug ihre Früchte. Eine ganze Generation von Bauern war nun in der neuen, freieren Atmosphäre herangewachsen. Sie ließ sich nicht mehr so leicht bevormunden, wie noch ihre Väter. Das Programm Pobedonoszews setzte indes ihre Unmündigkeit voraus: ihr Streben nach Emanzipation musste es zwangsläufig zu Fall bringen.
So spitzten sich in Russland gleichzeitig drei Konflikte zu, die im Westen bereits weitgehend gelöst worden waren: die Verfassungs-, die Arbeiter- und die Agrarfrage. Dies entzog der Selbstherrschaft ihre soziale Verwurzelung, und die erschreckende Leere, die sie nun umgab, offenbarte sich während des Russisch-Japanischen Krieges (1904-05). Das militärische Debakel des zarischen Heeres wurde von der Gesellschaft im Großen und Ganzen mit Gleichgültigkeit aufgenommen, von Teilen der Intelligenzija sogar begrüßt.
Angesichts ihrer zunehmenden Isolierung im Lande konnte die russische Autokratie in ihrer bisherigen Form nicht aufrechterhalten werden. Sie musste während der Revolution von 1905 auf einen Kompromiss mit der Gesellschaft eingehen. So kam es auf den Rat Wittes am 17. Oktober 1905 zu einem Manifest des Zaren, in dem er seinen Untertanen Grundrechte und die Einberufung eines Parlaments versprach. Dies war das Ende der uneingeschränkten Selbstherrschaft.
Die Putinsche „gelenkte Demokratie und das Law-and-Order-Prinzip
Für die Verfechter der nach dem Machtantritt Wladimir Putins in Russland errichteten „gelenkten Demokratie“ verkörperte die Regierung seines Vorgängers, Boris Jelzin, Chaos und weitgehendes Staatsversagen. Ein ähnlich harsches Urteil hatten seinerzeit die russischen Reformgegner über die Herrschaftsperiode des Zaren Alexander II. gefällt. Durch die Lockerung der staatlichen Kontrollmechanismen habe der Zar zur politischen Radikalisierung und sogar zum Aufkommen des revolutionären Terrors im Lande beigetragen, meinten seine Kritiker. Dies war, wie bereits gesagt, die Stunde Pobedonoszews, der dem Nachfolger Alexanders II. riet, das Land erneut mit starker Hand zu regieren. Auch Wladimir Putin wurde von seinen Anhängern dazu animiert, Härte zu zeigen.
Obwohl es Boris Jelzin selbst war, der Putin zu seinem Nachfolger auserkor, unterschied sich der Herrschaftsstil des neuen Präsidenten von Anfang an von demjenigen seines Vorgängers. Im Zentrum der Aufmerksamkeit Putins stand, anders als bei Jelzin, nicht die Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Erbe Russlands, sondern das Bemühen um die Stärkung der „Machtvertikale“ auf Kosten der autonomen und zentrifugalen Kräfte im Lande. In seinem „Offenen Brief an die Wähler Russlands“ vom Februar 2000 bezeichnete Putin den Rechtsstaat als ein Gemeinwesen, in dem die „Diktatur der Gesetze“ vorherrsche. Diese paradoxe Verbindung von zwei entgegengesetzten Begriffen veranlasste den Kölner Politikwissenschaftler Assen Ignatow zum folgenden Kommentar:
Wo es Gesetze gibt, gibt es keine Diktatur, und die Wortverbindung ´Diktatur des Gesetzes´ bedeutet, dass Diktatur und Gesetz nur das gemein haben, dass sie zwingende Kraft besitzen, die aber in entgegengesetzte Richtungen wirkt.
Man muss allerdings sagen, dass Putins Parolen Teile der russischen Öffentlichkeit durchaus beeindruckten. Man verstand sie als Kampfansage an die Korruption und das organisierte Verbrechen, die im damaligen Russland bereits erschreckende Ausmaße angenommen hatten. Auch das Vorgehen Putins gegen manche Finanzmagnaten („Oligarchen“), die seit Beginn der 1990er Jahre märchenhaften Reichtum angehäuft hatten, stieß bei vielen Russen auf Verständnis. Eines wurde aber dabei zu wenig beachtet. Die Strafaktionen des Regimes richteten sich in erster Linie gegen diejenigen Finanzmagnaten, die sich besonders aktiv im demokratischen Spektrum des Landes engagierten. Beispielhaft hierfür war das Schicksal Michail Chodorkowskis. Die regimetreuen Oligarchen hingegen wurden kaum behelligt.
Die skandalumwitterte Übernahme des regierungskritischen Fernsehsenders NTW durch den Staatskonzern Gazprom im Frühjahr 2001 zeigte deutlich, in welche Richtung sich die Putinsche „gelenkte Demokratie“ bewegte. Sie zielte auf eine weitgehende Demontage der zivilgesellschaftlichen Strukturen hin, die Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre in Russland entstanden waren.
Dessen ungeachtet handelte es sich beim Putinschen System in der ersten Amtsperiode des neuen Präsidenten um ein durchaus widersprüchliches Gebilde. Die autoritäre Wende in der Innenpolitik wirkte sich zunächst nur begrenzt auf die Außenpolitik Moskaus aus. Nach den Terrorakten vom 11. September 2001 in den USA wurde Russland zum Mitglied der Anti-Terror-Allianz, mehrere russische Politiker plädierten nun für eine Erneuerung der russisch-westlichen Allianz, wie sie bereits während des deutsch-sowjetischen Krieges bestanden hatte. Auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit Russlands mit dem Westen wurde immer intensiver. Als am 1. Mai 2004 vier ehemalige Mitglieder des Warschauer Paktes und drei ehemalige Sowjetrepubliken der EU beitraten, rief dies keine Panik in Moskau hervor. Putin bewertete diesen Beitritt damals sogar als einen Vorgang, der Russland und die EU „nicht nur geografisch, sondern auch wirtschaftlich und geistig“ näherbringen solle.
Die Absage an die Moderne
Erst die „Orangene Revolution“ in der Ukraine (Ende 2004) änderte grundlegend die Einstellung der Verfechter der „gelenkten Demokratie“ zum Westen und zu den mit dem Westen assoziierten Werten. Die Angst vor einer eventuellen „bunten“ Revolution in Russland selbst begann in einem immer stärkeren Ausmaß sowohl die Außen- als auch die Innenpolitik Moskaus zu prägen. Die antiwestliche Rhetorik erreichte einen neuen Höhepunkt. Als wichtigste Verbündete Moskaus galten nun nicht mehr die Westmächte, sondern autoritäre Regime unterschiedlichster Art, und zwar weltweit. Das heutige Bündnis Moskaus mit der syrischen Diktatur stellt ein besonders spektakuläres Beispiel hierfür dar. Auch der Feldzug gegen die „systemkritische“ russische Opposition erreichte, insbesondere nach der Annexion der Krim im März 2014, eine neue Dimension.
Warum lässt die Kreml-Führung die kleinen oppositionellen Gruppierungen im Lande, die zurzeit nur wenig Rückhalt bei der Bevölkerung haben, nicht einfach gewähren? Warum verletzt sie derart eklatant so viele demokratische Spielregeln und riskiert damit einen zusätzlichen Prestigeverlust in den Augen der Weltöffentlichkeit? Dies hat vermutlich damit zu tun, dass die Verfechter der „gelenkten Demokratie“ sich darüber im Klaren sind, wie brüchig das ideologische Fundament ist, auf dem das jetzige System basiert – ungeachtet der patriotischen Euphorie, die das Land nach der Krim-Annexion erfasst hat. Da aber eine Euphorie in der Regel keineswegs von Dauer ist, wird das Land früher oder später mit den politischen und wirtschaftlichen Folgen der abenteuerlichen Ukraine-Politik der Kreml-Führung konfrontiert werden. Dies könnte die Stunde der russischen Demokraten sein, da ihr Streben nach einer authentischen Gewaltenteilung im Lande und nach der Befreiung der Gesellschaft von der staatlichen Bevormundung durchaus dem Zeitgeist entspricht. Um eine solche politische Wende zu verhindern, diffamiert die Kreml-Führung derartige Bestrebungen als ein Zeichen der „westlichen Dekadenz“ und versucht, etwa nach der Manier Pobedonoszews, das Land vor den „schädlichen“ westlichen Einflüssen abzuschirmen. Solche Kampfansagen an die Moderne werden allerdings nur selten durch einen dauerhaften Erfolg gekrönt.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


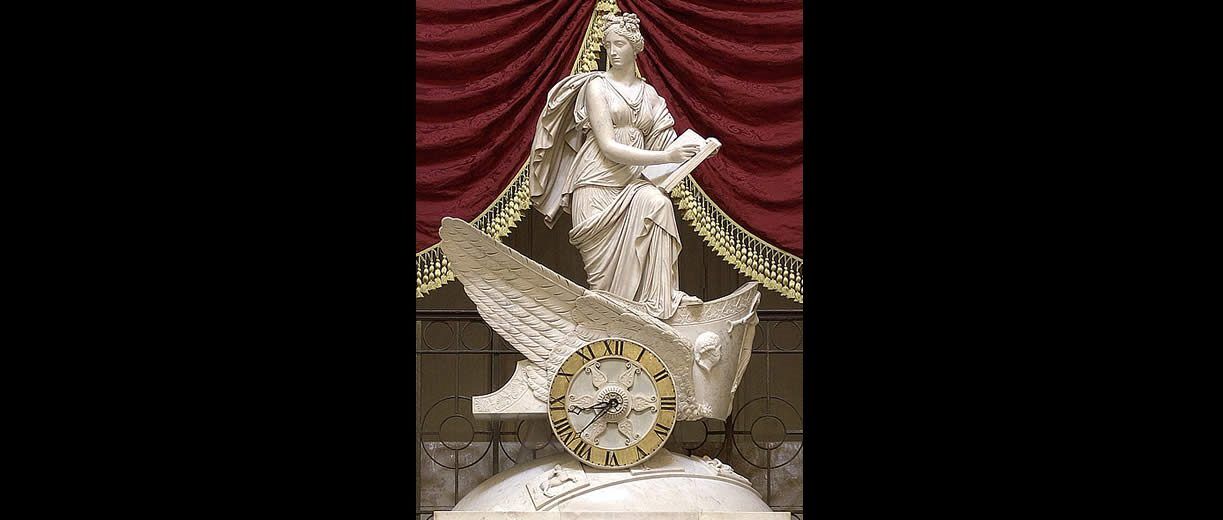

Hilmar Weckert
russland hat die leibeigenschaft überwunden.-wogegen der oligäre westen die menschen mit leibeigenschaft knebelt .-bis zu amonetären zuständen die durch einen chip geregelt werden
wer russland kritisiert der kennt es nicht .-der große bruder russland ist der “ inbrünstige glaube an gott“ den sie zu jederzeit erwarten.die russische demokratie wie putin sie versteht hat nichts mit dem westen gemeinsam .-russland ist eben ein rätselhaftes mysterium innerhalb eines geheimnisses und wird es auch bleiben .-es lebe russia und seine großartigen menschen