Auf der Suche nach dem Gleichgewicht
In der Zeit des Kalten Krieges hing das europäische Gleichgewicht von der Präsenz der USA auf dem „alten“ Kontinent ab. Hat sich dieser Sachverhalt nach der Auflösung des Ostblocks geändert? Zwei europäische Nachkriegsordnungen im Vergleich
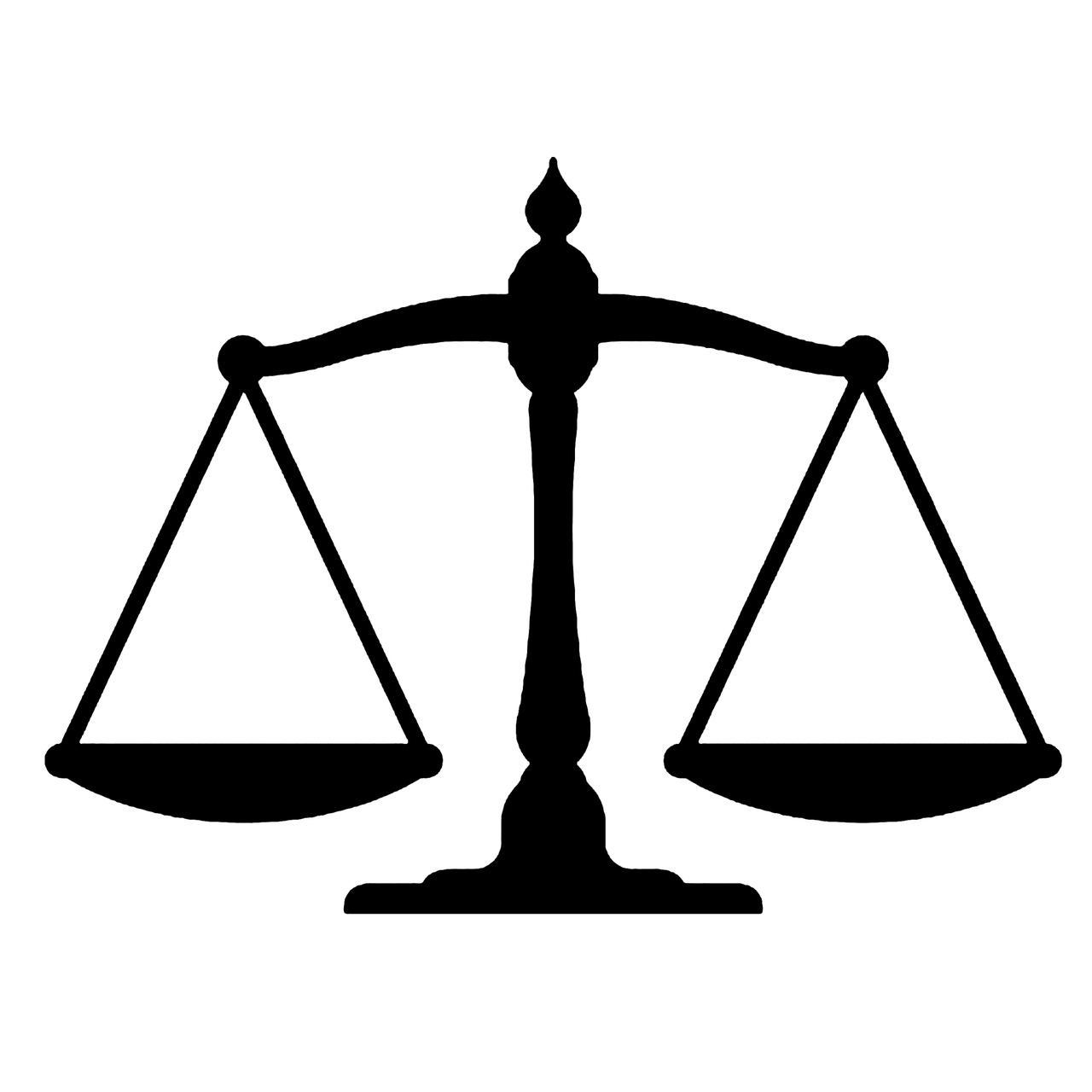
1914 vs. 2014
Die Tatsache, dass die russische Annexion der Krim sich in dem Jahr ereignete, in dem sich der Ausbruch des Ersten Weltkrieges zum hundertsten Mal jährte, veranlasste viele Kommentatoren zu Warnungen und Mahnungen. Die Europäer sollten nun nicht schon wieder wie „Schlafwandler“ unversehens in eine Kriegsfalle tappen. „Ist es Zahlenmagie, dass diese Krise 100 Jahre nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges auftaucht?“, fragte „DIE ZEIT“ den russischen Philosophen Michail Ryklin zu Beginn der Krimkrise (am 6. März 2014). Und Ryklins Antwort lautete: „Es herrscht eine Stimmung, als könne etwas völlig Unerwartetes passieren. Das legt Vergleiche mit 1914 nahe“.
Der Berliner Politologe Herfried Münkler fügte in der gleichen Ausgabe der „ZEIT“ hinzu: „Zweifellos ist Russland im Jahre 2014 von ähnlichen Einkreisungsängsten geplagt wie Deutschland im Jahre 1914“.
Diese Beschwörung einer konkreten Kriegsgefahr stellte eine Art Zäsur in der europäischen Nachkriegsgeschichte dar. Man darf nicht vergessen, dass der „alte“ Kontinent damals, wenn man von dem lokal begrenzten Jugoslawienkrieg absieht, auf eine beinahe 70-jährige Friedenperiode, die wohl längste in seiner Geschichte, zurückblicken konnte. Dadurch unterschied sich die 1945 entstandene Nachkriegsordnung grundlegend von ihrer unmittelbaren Vorgängerin – der Versailler Ordnung –, die bereits nach etwa 20 Jahren gänzlich gescheitert war. Was verlieh dem in Jalta und Potsdam errichteten System seine im Grunde ganz unerwartete Stabilität? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich zunächst auf die Defizite des 1919 entstandenen Versailler Systems eingehen, und dann auf die Lehren, die die Europäer, aber auch die Amerikaner, aus seinem Scheitern zogen.
Der demokratische Triumphalismus des Jahres 1919
Die Versailler Ordnung entstand nach dem bis dahin verheerendsten Krieg der Neuesten Geschichte, den der amerikanische Historiker George F. Kennan später als die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnete. Die Verhinderung von vergleichbaren Katastrophen stellte eine der zentralen Aufgaben der Sieger und des von ihnen gegründeten Völkerbundes dar. Der Eintritt in eine neue Ära der friedlichen Regelungen von internationalen Konflikten schien damals nicht zuletzt deshalb möglich zu sein, weil es sich bei den Siegern bzw. den Gründern des Völkerbundes in ihrer Mehrheit um demokratische Staaten handelte. Man ging davon aus, dass Demokratien friedliebender als autoritäre Regime seien, denn Letztere neigten dazu, mit einer abenteuerlichen Außenpolitik von ihren innenpolitischen Konflikten abzulenken. Die Tatsache, dass es sich bei den Verlierern des Ersten Weltkrieges beinahe ausschließlich um autoritär regierte Staaten und bei den Siegermächten in der Regel um parlamentarische Demokratien handelte, trug stark zu einem europaweiten Siegeszug des demokratischen Gedankens bei. Sowohl in den besiegten Staaten als auch in den Nachfolgestaaten der partiell oder gänzlich zusammengebrochenen multinationalen Reiche Mittel- und Osteuropas wurden in der Regel demokratische Systeme errichtet. Der demokratische Triumphalismus des Jahres 1919 erinnert in gewisser Weise an denjenigen von 1989, als Francis Fukuyama vom „Ende der Geschichte“, d. h. vom endgültigen Sieg der Demokratien über ihre autoritären Widersacher, sprach.
Die Erosion der demokratischen Ideen nach 1919
Euphorisch war 1918/1919 die Stimmung nicht nur im Westen, sondern auch im Osten des Kontinents. Generationenlang hatten viele osteuropäische Völker gegen die Fremdherrschaft gekämpft, und dieser Kampf war nur selten durch Erfolge gekrönt worden. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg wurde aber der Traum vieler Osteuropäer Wirklichkeit. Die Mehrzahl der Völker der Region wurde nun frei. Diese politische Revolution wurde jedoch durch keine entsprechenden wirtschaftlichen oder sozialen Umwälzungen begleitet. Die Herrschaftsstrukturen hatten sich kaum verändert. Die feudal-bürokratischen und militärischen Eliten, die in Ostmitteleuropa oder in Südosteuropa seit Generationen tonangebend gewesen waren, büßten ihren Einfluss auch nach 1918 kaum ein. Die Industrialisierungs- und Modernisierungsprozesse berührten die Region, wenn man von Tschechien absieht, nur am Rande. Die patriarchalischen Herrschaftsstrukturen der Länder Ost- und Südosteuropas wirkten sich verständlicherweise auch auf die politischen Verhältnisse aus. Die demokratischen Verfassungen, die in den Ländern der Region nach 1918 eingeführt worden waren, wurden beinahe überall bald wieder abgeschafft und durch mehr oder weniger autoritäre Systeme abgelöst. Auch hier stellte die Tschechoslowakei eine Ausnahme dar.
Negative Auswirkungen auf die Geschichte der Region sollte auch die Tatsache haben, dass die neuen souveränen Staaten, die infolge der Auflehnung gegen multinationale Imperien entstanden waren, selbst in der Regel multinationale Reiche im Kleinformat darstellten. An der ungelösten nationalen Frage sollten manche von ihnen auch zerbrechen. Aber nicht nur im östlichen Europa, sondern europaweit erreichten nationale Emotionen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg einen neuen Höhepunkt. Der Hass gegen das Fremde sei nun weit wichtiger als die Liebe zur eigenen Nation geworden, schrieb 1931 in diesem Zusammenhang der russische Exilhistoriker Georgij Fedotow. Einige Jahre später fügte er hinzu: Nietzsche sei der eigentliche Prophet des 20. Jahrhunderts gewesen, als er sagte, dass nicht der Kampf ums Dasein, sondern vielmehr der Wille zur Macht diese Welt bestimme. Bei einer solchen Einstellung erschrecke auch die Vision des eigenen Untergangs nicht. Eine Welt, in der das eigene Land nicht die vorherrschende Stellung einnehmen könne, solle lieber untergehen.
Der amerikanische Isolationismus und die westliche Appeasementpolitik
Als Achillesferse der 1919 entstandenen Nachkriegsordnung lässt sich der Umstand betrachten, dass die Vereinigten Staaten – die damals bereits mächtigste Demokratie der Welt –, sich weigerten, dem Völkerbund, der diese Ordnung garantieren sollte, beizutreten. Dies ungeachtet der Tatsache, dass das Versailler System im Wesentlichen auf den Ideen des amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson basierte, so auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und auf den demokratischen Prinzipien.
Als zu Beginn der 1930er Jahre die europäische Nachkriegsordnung infolge der Weltwirtschaftskrise und des Aufstiegs des Nationalsozialismus zu erodieren begann, konnten die westeuropäischen Demokratien, nicht zuletzt aufgrund ihrer begrenzten Machtressourcen, nicht adäquat auf die neuen Herausforderungen reagieren. Eine dieser inadäquaten Reaktionen stellte ihre Appeasementpolitik dem NS-Regime gegenüber dar, die es Hitler erlaubte, beinahe alle Restriktionen des Versailler Vertrages innerhalb von fünf Jahren zu annullieren und die deutsche Militärmaschinerie wiederherzustellen. Die Aggressivität Hitlers wurde durch die Nachgiebigkeit der westlichen Kabinette nur noch mehr angestachelt. Auch seine Verachtung gegenüber seinen westlichen Kontrahenten stieg ins Unermessliche: „Unsere Gegner sind kleine Würmchen. Ich habe sie in München gesehen“, sagte Hitler kurz vor dem Überfall auf Polen.
So stand die Versailler Nachkriegsordnung 20 Jahre nach ihrer Entstehung am Rande eines gänzlichen Scheiterns.
Die europäischen Integrationsprozesse nach 1945 unter dem amerikanischen Schutzschild
Die europäische Ordnung, die nach 1945 entstand, zeichnete sich durch ganz andere Wesensmerkmale als das Versailler System aus. Dies nicht zuletzt deshalb, weil ihr nun das gesamte machtpolitische und wirtschaftliche Potential der Vereinigten Staaten zur Verfügung stand. Zumindest in Europa, genauer gesagt, im frei gebliebenen Teil des alten Kontinents, war diese Ordnung wesentlich stabiler als in der Zwischenkriegszeit. Die europäischen Integrationsprozesse, die die politische Kultur Europas grundlegend veränderten, konnten sich nicht zuletzt deshalb recht ungehindert entwickeln, weil sie sich im Schatten der amerikanischen Schutzmacht vollzogen. Die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion zugänglich gewordenen Dokumente weisen unmissverständlich darauf hin, dass Stalin von einer Ausdehnung des sowjetischen Machtbereichs bis zum Atlantik träumte. Die amerikanische Präsenz in Europa stellte indes das größte Hindernis für die Verwirklichung dieser Träume dar.
Die „Spielregeln“ des Kalten Krieges
Neben der amerikanischen Präsenz in Europa trug zur Stabilität der Jalta-Ordnung auch die Tatsache bei, dass Washington und Moskau – die Hauptkontrahenten in dem bereits 1945 begonnenen Kalten Krieg – bestimmte Spielregeln bei der Austragung ihrer Konflikte beachteten und eine totale Konfrontation zu vermeiden suchten. Das atomare Gleichgewicht mag dabei eine große Rolle gespielt haben. Nicht weniger wichtig war hier allerdings auch die Tatsache, dass weder die sowjetische noch die amerikanische Führung dazu neigten, Vabanque zu spielen, so wie Hitler dies seinerzeit getan hatte. Anders als der deutsche Diktator handelten sie nicht nach der Alternative „Alles oder Nicht“.
Die extreme Ungeduld Hitlers, die ihn zu einer permanenten Radikalisierung seines außenpolitischen Vorgehens getrieben hatte, wird von manchen NS-Forschern dadurch erklärt, dass der deutsche Diktator seine politischen Endziele, die die bestehende europäische Ordnung gänzlich aus den Angeln heben sollten, unbedingt zu seinen Lebzeiten erreichen wollte. Im Oktober 1937 bei einem Treffen mit Propagandaleitern der NSDAP erklärte er: Es sei notwendig, die Probleme, die gelöst werden müssten, möglichst bald zu lösen, damit dies noch zu seinen Lebzeiten geschehe. Spätere Generationen würden dies nicht mehr können. Nur seine Person sei dazu noch in der Lage.
So stand Hitler unter permanentem Zeitdruck. Bei den Kommunisten hingegen verhielten sich die Dinge anders. Als geschichtliche Deterministen waren sie davon überzeugt, dass der Sieg des Kommunismus im weltweiten Maßstab ohnehin unvermeidlich sei. Um ihn herbeizuführen, mussten sie, anders als Hitler, nicht alles auf eine Karte setzen.
Was das atomare Gleichgewicht anbetrifft, so darf man in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass auch in der Periode, in der die Vereinigten Staaten noch über das atomare Monopol verfügten (1945-49), die „Spielregeln“ des Kalten Krieges beachtet wurden. So hatten z. B. die sowjetischen Streitkräfte während der ersten Berliner Krise (1948/49) kaum etwas gegen die Luftbrücke der Westalliierten unternommen, die die Versorgung der isolierten Westsektoren der Stadt sicherte. Die Westmächte wiederum reagierten auf die massiven Verletzungen der demokratischen Spielregeln im Ostblock, die gegen die Jalta-Erklärung über das befreite Europa eklatant verstießen, nur mit verbalen Protesten. Die jeweiligen Einflusssphären, die die Sieger des Zweiten Weltkrieges in Jalta und in Potsdam festgelegt hatten, wurden also von den jeweiligen Kontrahenten im Ost-West-Konflikt im Wesentlichen respektiert.
Transatlantische Bindungen und das europäische Gleichgewicht nach der Auflösung des Ostblocks
Nach der Beendigung der Ost-West-Konfrontation und dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ Ende der 1980er/Anfang der 1990er Jahre schien der amerikanische Schutzschild nicht mehr erforderlich zu sein, um die europäischen Sicherheitsstrukturen zu stabilisieren. Die zum neuen Selbstbewusstsein gelangten Europäer begannen sich in einem immer stärkeren Ausmaß mit sich selbst zu beschäftigen – so etwa mit der Vertiefung der europäischen Integration – bis der 1991 ausgebrochene Krieg in Jugoslawien zeigte, wie stark die Sicherheitsarchitektur des Kontinents von der Aufrechterhaltung der transatlantischen Bindungen abhing. Zunächst war in den europäischen Hauptstädten durchaus die Tendenz vorherrschend gewesen, den jugoslawischen Konflikt als eine ausschließlich innereuropäische Angelegenheit zu betrachten. Dieser Plan scheiterte jedoch. Der jugoslawische Bürgerkrieg eskalierte unentwegt, vor allem in Bosnien und Herzegowina. So begann man in Europa hoffnungsvoll in Richtung Washington zu blicken und ein amerikanisches Eingreifen in Jugoslawien herbeizusehnen. Dieses Eingreifen trug dann in der Tat dazu bei, dass der Bosnien-Krieg mit dem Friedensvertrag von Dayton im Dezember 1995 sein Ende fand.
Das Scheitern des „Neurussland“-Projekts
Etwa 20 Jahre später stellte es sich nun erneut heraus, dass die transatlantische Solidarität eine unentbehrliche Voraussetzung für die Wahrung des europäischen Gleichgewichts darstellte. Ohne diese Solidarität wäre die Verwirklichung des „Neurussland-Projekts“, das imperial gesinnte Kreise in Russland während des sogenannten „russischen Frühlings“ (2014) verfolgten, kaum zu verhindern gewesen. Der für die Moskauer Führung völlig unerwartete europäisch-amerikanische Schulterschluss trug sicherlich dazu bei, dass der Einfluss Moskaus sich, abgesehen von der Krim, nur auf zwei ostukrainische Provinzen und nicht auf den gesamten Südosten der Ukraine ausdehnte.
Für den radikalen Flügel des national-patriotischen Lagers im heutigen Russland stellt der Verzicht der Moskauer Führung auf die sofortige Realisierung des „Neurussland-Projekts“ einen schmerzlichen Rückschlag dar. Noch im April 2014 schwadronierte Alexander Dugin, der zu den einflussreichsten Ideologen dieses Lagers zählt und der von manchen Analytikern sogar als „Putin´s Brain“ bezeichnet wird: „Entweder der Südosten (der Ukraine) oder der Tod“.
Putin nahm indes vom Neurussland-Projekt (zumindest vorübergehend) Abstand. Er wollte nicht den Westen zusätzlich provozieren. Trotz seines abenteuerlichen Krim-Coups ist ihm das Endzeitdenken Dugins eher fremd. Im Gegensatz zu den Extremisten im national-patriotischen Lager ist er sich wohl auch darüber im Klaren, dass Russland nicht imstande ist, den Westen in die Knie zu zwingen. So versucht er, den nach der Krim-Annexion entstandenen Schaden, zumindest in Grenzen zu halten. Sein Syrien-Coup dient nicht zuletzt diesem Zweck. Dadurch will er seinen westlichen Kontrahenten zeigen, wie wichtig Russlands Beitrag bei der Lösung der dringendsten internationalen Probleme ist. Mit dieser Strategie erzielte er auch in einigen westlichen Hauptstädten schon einen partiellen Erfolg – dies nicht zuletzt wegen der recht planlosen Rückzugsstrategie der Obama-Administration, die in einigen Regionen der Welt ein gefährliches Machtvakuum hinterlässt. Moskau scheint von dieser Führungsschwäche der USA besonders stark zu profitieren. Ob es Putin aber gelingen wird, die westlichen Partner in der sich nun anbahnenden Anti-Terror-Koalition dazu zu bewegen, die Krim und die Ostukraine zu vergessen, ist indes sehr fraglich.
Lesen Sie auch die letzte Kolumne von Leonid Luks zu Russland als „schwierigem“ Partner des Westens.
Zur Person
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.
Schreibe einen Kommentar