In die Natur
„Lass uns hinaus in die Natur fahren!“ hatte Bob am Morgen vorgeschlagen. Alice war skeptisch: „Wo soll denn das sein?“ fragte sie. Bob, der auf schwierige Fragen beim Frühstück noch keine Lust hatte, antwortete einfach: „Lass dich überraschen!“
Nun radelten sie über schmale Straßen durch Felder und Wälder, Bob genoss die Luft und den Anblick der Bäume und Pflanzen. An einer Bank, die am Wegesrand stand, machten sie Rast.
Bob wollte wissen, wie Alice die Landschaft gefiel. „Ganz schön“ antwortete diese, dann fragte sie mit spöttischem Lächeln: „… und wann kommt die Natur?“
Bob hoffte noch, der philosophischen Diskussion entgehen zu können: „Schau dich um, die Wälder, die Bäume, das alles ist doch Natur!“
Natürlich ließ Alice nicht locker: „Natur? Das ist doch alles künstlich angelegt, der Wald ist ein Forst, die Bäume sind gezüchtet, die Felder sind auf hohen Ertrag optimiert. Daran ist nichts natürliches!“
„Was ist denn für dich ‚Natur‘?“ wollte Bob wissen, der natürlich schon beim Frühstück geahnt hatte, dass er um diese Diskussion nicht herumkommen würde.
„Natur, das ist all das, was unabhängig vom Menschen gewachsen ist. Wilde Pflanzen und Tiere, Urwälder! Alles andere ist Kultur, eine künstlich vom Menschen geschaffene Welt.“ dozierte Alice.
„Hm, du meinst die unberührte Natur, die Wildnis?“
„Ja natürlich!“ Alice war sich sicher. „Natur ist das Natürliche, das unbearbeitete, ursprünglich Gewachsene und Entstandene.“
„Aber warum“ sinnierte Bob, „brauchen wir dann noch den Begriff der Wildnis?“
„Wildnis oder Natur, das ist doch das selbe!“ erwiderte Alice schnell. „Das Wort Wildnis verwenden wir nur, um die Natur zu kennzeichnen, die uns unbekannt ist und vor der wir uns zu recht fürchten.“
„Also ist Natur die bekannte, verstandene Wildnis?“
„Genau!“
„Hm. Aber es gibt nichts, was wir kennen, was wir verstanden haben, und was wir sozusagen beim Kennenlernen nicht umgestaltet hätten. Also könnte es Natur gar nicht geben, weil wir ja beim Kennenlernen die Wildnis schon verändern. Schon dadurch, dass wir einen Weg durch die Wildnis schlagen, machen wir sie – nach deiner Vorstellung – zur Kulturlandschaft!“
Alice dachte nach: „Vielleicht hast du recht. Wir könnten den Begriff der Natur auch anders von der Wildnis trennen. Das Wort stammt ja von einem lateinischen Wort ab, das „geboren werden“ und „wachsen“ bedeutet. Das entsprechende altgriechische Wort φυσιζ (physis) bedeutet „das Gewachsene“ oder „Gewordene“. Natur – damit könnten wir z.B. eine Pflanze bezeichnen, die sozusagen entsprechend ihrer eigenen Anlagen gewachsen ist, ob sie nun vom Menschen angebaut wurde, oder nicht. Ein Baum im Wald und sogar das Korn auf dem Feld wachsen ziemlich natürlich. Ein Baum im Garten, der jedes Jahr beschnitten wird, ist eher Kultur…“
„Aber das hieße, dass auch eine ganz künstliche Züchtung Natur ist…“
„Wenn sie ohne menschliche Unterstützung wachsen kann, warum nicht? Aber wenn sie nur im Glashaus gedeihen kann, und unter freiem Himmel sofort eingehen würde, dann würde ich sie nicht zur Natur rechnen…“
Bob sah nachdenklich zum Himmel – und sprang plötzlich auf: „Schau nur, da braut sich ein Regenschauer zusammen. Lass uns schnell nach Hause fahren! Ich bin nicht so ein Naturbursche, wenn ich nass werde, erkälte ich mich!“
Im Nebel
Alice und Bob joggten am Strand entlang und Bob sann noch ihrem letzten Gespräch über die Natur nach. Er sagte sich, dass dieser Strand und das Meer, wie sie waren, ganz sicher zur Natur zählten, denn auch sie waren ja im Laufe der Zeit so geworden, wie sie jetzt waren, ganz ohne (oder wenigstens fast ohne) Zutun der Menschen.
Plötzlich wurde es neblig, der Nebel war wohl unmerklich vom Wasser aufgestiegen und waberte nun über das Land.
Bob griff nach Alices Hand: „Ich sehe nichts!“. Spöttisch zog Alice ihre Hand zurück: „Du siehst noch den Sand zu deinen Füßen, und da, die Wellen siehst du auch noch. Sand und Wellen sind nicht Nichts.“
Bob ahnte schon, was kommen würde, trotzdem wandte er ein: „Ja, ich sehe noch ein bisschen vom Strand und vom Wasser, aber wenn ich weiter schaue, dann sehe ich sonst – Nichts!“
Alice lachte: „So so, du siehst also das Nichts. Wie sieht es denn aus, das Nichts?“
Bob hatte keine Lust auf philosophische Spitzfindigkeiten: „Ich rede nicht von ‚dem Nichts‘ – ich sage, ich sehe nichts!“
Alice ließ natürlich nicht locker: „Also du sagst, du siehst – nichts. Du kannst es sogar sehen!“
„Das Nichts kann man nicht sehen! Weil es das Nichts nämlich nicht gibt!“
Plötzlich blieb er stehen: „Guck mal da, da war was! Ich habe einen Schatten im Nebel gesehen!“
Alice schaute in die Richtung, in die Bob gezeigt hatte: Sie konnte aber nur milchig-trübes Einerlei entdecken, wie in allen anderen Richtungen auch: „Da ist nichts“ sagte sie „ich sehe jedenfalls nichts“. Sie stutzte kurz und lachte: „Ich habe das Nichts entdeckt, da ist es!“
Bob ließ sich nicht beirren: „Klar war da was, ich habe deutlich einen Schatten gesehen!“
„Hm… wie bekommen wir nun raus, ob du recht hast? Gehen wir hin, und schauen wir nach?“
„Selbst wenn wir da nichts finden, heißt das nicht, dass da nichts war!“ erwiderte Bob.
„Schon wieder ein neues Problem, das heben wir uns für die nächste Gelegenheit auf. Bleiben wir mal beim Nichts. Du sagst, dass es das Nichts nicht gibt. Aber warum redest du dann immer so, als ob es da ist? Du sagst: Da ist Nichts. Du sagst: Du siehst Nichts. Du sagst: Ich finde Nichts. Du sagst: Vielleicht war da Nichts! Immerzu redest du vom Nichts, als ob es existiert, und doch sagst du, es gäbe kein Nichts!“
Bob grübelte: „Neulich hab ich durch ein Fernrohr in den Sternenhimmel geschaut. Meistens waren Sterne zu sehen, aber dazwischen war es wirklich dunkel. Da war dann, dachte ich, wirklich nichts! Aber vielleicht stimmt das ja auch nicht. Schließlich sind diese ganzen elektromagnetischen Felder ja auch irgendwie da. Dass es das Nichts nicht gibt, bedeutet vielleicht, dass immer und überall irgendwas ist, auch wenn wir nichts erkennen. So wie her jetzt im Nebel. Schließlich ist wenigstens der Nebel da.“
Alice meinte: „Aber dann wäre es völlig sinnlos, vom Nichts zu reden. Wir müssten das Wort aus unserem Wortschatz streichen, weil es nichts bedeutet.“
Bob lachte: „Nichts bedeutet nichts! Was für ein philosophischer Satz!“
Alice blieb ernst: „Und wie vieldeutig dieser kleine Satz ist. Denk mal drüber nach!“
In diesem Moment lichtete sich der Nebel, und alles, was gerade verschwunden war (oder verschwunden zu sein schien), tauchte wieder auf: Die Schiffe auf dem Wasser genauso wie die Dünen dort, wo der Strand aufhörte.
„Ich kann auf das Wort ‚nichts‘ nicht verzichten. Es sagt etwas über mich und meine Fähigkeit, die Welt zu verstehen, aus. ‚Da ist nichts‘ bedeutet, ich kann dem, was ich wahrnehme, keinen Sinn geben, weil ich nichts erkenne.“ – Wer das gesagt hat, Alice oder Bob? Was täte es zu Sache, das zu wissen? Nichts!
Eine Notiz
Beim Aufräumen fand Bob einen Zettel, auf dem eine 3 notiert war. Nichts weiter als eine Drei. Alice musste sie bei ihrem letzten Besuch da draufgeschrieben haben und das Blatt dann wohl vergessen haben. Sogleich rief er sie an, denn es konnte ja sein, dass die Drei auf diesem Zettel eine wichtige Bedeutung hatte.
Alice allerdings war verwundert: „Ich habe keine Drei auf einen Zettel bei dir geschrieben, ganz sicher! Warum sollte ich das tun?“
„Das weiß ich doch nicht,“ antwortete Bob, „wahrscheinlich wolltest du dir etwas wichtiges merken. Vielleicht, dass du noch drei Äpfel kaufen wolltest…“
Plötzlich lachte Alice: „Dreh das Blatt mal um. Das ist keine Drei. Das ist ein E! Mir war plötzlich eingefallen, dass ich meiner Freundin Eva noch ein Geschenk machen muss!“
„Für mich ist das kein E. Das ist eine Drei,“ gab Bob zurück.
„Hör mal, das ist Unsinn, Bob. Für dich ist das gar nichts. Du hast dir nur eingebildet, dass es eine Drei sei. Ich hab es ja aufgeschrieben, ich weiß, was es ist: ein E!“
„Du meinst, für mich ist das, was du geschrieben hast, nichts, nur weil du es geschrieben hast?“
„Genau, für dich hat das keine Bedeutung, ich habe die Bedeutung festgelegt, als ich den Stift aufs Papier gesetzt habe.“
Bob überlegte: „Aber es ist auch für mich nicht nichts, ich sehe, dass es eine Notiz ist, ich habe dich angerufen, weil ich dachte, dass es wichtig sein könnte. Es hatte Bedeutung für mich, weil ich wusste, dass es Bedeutung für dich hat!“
Alice lachte, und wieder einmal kam dieser spöttische Tonfall in ihre Stimme: „Nein, das hast du nur vermutet. Es hätte auch sein können, dass ich diese Linie nur aus Langweile aufs Papier gemalt habe, weil du so lange im Keller warst, um Wein zu holen.“
„Du malst aus Langweile eine Drei aufs Papier?“
„Es ist ein E! Aber es könnte auch sein, dass ich einfach mit dem Stift gekritzelt habe! Du konntest nicht einmal wissen, dass es ein Symbol für irgendwas ist. Für dich war es nichts. Du hast nur eine Bedeutung da hineingedichtet…“
Bob widersprach: „Ich hatte aber Recht mit meiner Vermutung, dass es sich eben nicht um irgendein Gekritzel handelt, sondern um ein Symbol, das eine Bedeutung hat. Und wenn es ein A gewesen wäre, oder eine 7, dann hätte ich auch recht gehabt, wenn ich gesagt hätte ‚Da steht ein A, oder eben eine 7, auf dem Papier.“
Alice schwieg, und Bob fuhr fort: „Du kannst eben nicht allein festlegen, was von dem Bedeutung hat, was du machst, und was nicht. Schließlich weiß ich auch, wie Buchstaben und Zahlen aussehen, und wie es aussieht, wenn du kritzelst!“
„Aber du kannst dich auch irren, du hast dich geirrt. Ich hatte ein E aufgeschrieben, und du hast es für eine Drei gehalten!“
„Ich hab mich vielleicht darin geirrt, was es genau für ein Symbol ist, aber das es ein Symbol ist, dass es etwas bedeutet, darin habe ich Recht gehabt. Also war es auch für mich nicht ‚Nichts‘.“
Alice schwieg wieder. Bob hatte ein Argument auf seiner Seite, und das mochte sie nicht. Ich muss mich endlich um das Geschenk für Eva kümmern, dachte sie, und verabschiedete sich schnell von Bob. Natürlich nicht, ohne sich bei ihm dafür zu bedanken, dass er sie wegen dieses E, oder wegen der Drei, angerufen hatte.
Ein gutes Messer
Wieder einmal war Bob bei Alice zu Besuch, und wieder einmal war sie mit dem Essen, das sie vorbereiten wollte, noch nicht fertig. Bob dachte „Eigentlich ist Alice keine gute Gastgeberin“ bevor er sich – wie immer – daran machte, ihr zu helfen. Ganz selbstverständlich griff er in die Schublade mit den Messern und begann, Salat zu schneiden. Gutes Werkzeug hat Alice, das musste man ihr lassen. Gerade wollte er das aussprechen, als Alice sagte: „Du bist wirklich ein guter Freund, du beschwerst dich nicht, dass ich noch nicht fertig bin, sondern hilfst einfach mit!“
Bob ließ das Messer sinken und erwiderte „Gerade wollte ich sagen, dass du gute Messer hast, denn dieses Messer schneidet wirklich wunderbar. Aber nun frage ich mich, ob ich als Freund genauso gut bin wie dieses Ding hier als Messer gut ist…“
Alice musste lachen und goss Wein in die Gläser: „Schneid ruhig weiter Salatblätter, ich erkläre dir inzwischen, was es mit dem Gut-Sein auf sich hat: Gut – das bedeutet eigentlich nichts anderes als: es entspricht der Idee von dem Begriff, den man verwendet, ideal. Ein Messer ist ein Schneide-Ding, und ein gutes Messer schneidet eben so, wie man es sich vom Messer nur wünschen kann. Übrigens bist du kein guter Koch, sonst würdest du den Salat gar nicht schneiden, sondern zupfen, schau…“ sagte sie und riss ein bisschen am Salat herum. Bob fand die geschnittenen Blätter schöner, außerdem ging es mit dem Schneiden schneller, aber er antwortete nur „Und ein Freund ist so ein Helfer-Ding und wer immer hilft, ist ein guter Freund?“
„Genau so ist es!“ rief Alice.
„Und wenn ich dir jetzt nicht geholfen hätte, wäre ich kein guter Freund? Was, wenn ich dir nur helfe, damit wir schneller fertig werden, weil du, als nicht ganz so gute Gastgeberin, nie mit dem Essen fertig bist, wenn ich komme – obwohl du weißt, dass ich Hunger habe!“
„Du findest, ich sei keine gute Gastgeberin, nur, weil das Essen noch nicht fertig ist?“ Alice war nun doch ein bisschen empört.
„Nein nein,“ versuchte Bob sie zu beruhigen, „Aber mit Begriffen wie ‚Freund‘ oder ‚Gastgeber‘ scheint mir die Sache mit dem ‚Gut-sein‘ eben nicht so einfach zu sein, wie mit dem Messer. Vielleicht bedeutet ‚Gut‘ ja bei Menschen was ganz anderes, als bei Gegenständen?“
„Nein, das glaube ich nicht. ‚Gut‘ – das ist immer: der Ideal-Vorstellung von dem Begriff entsprechen. Nur sind die Ideale, was Menschen betrifft, eben komplexer als die von Gegenständen. Bei Werkzeugen ist es ja ganz einfach, die sollen einen Nutzen haben, und was diesen Nutzen hat, ist gut, Nutzen und Ideal sind da dasselbe.“
„Stimmt, aber wenn du sagst, ich bin ein guter Freund, weil ich dir helfe, und weil Freund-Sein so ein Helfer-Ding ist, dann bestimmst du mein Gut-Sein eben doch über meinen Nutzen!“
„Ach Bob, du bist mein Freund, weil ich dich mag, und weil wir zusammen streiten und lachen, egal ob es Nutzen hat. Weil du mich anrufst, wenn ich bei dir eine Notiz vergessen habe. Klar, auch weil ich dir vertraue und dir manches anvertrauen kann – und da kann man natürlich wieder sagen, dass das für mich nützlich ist… Es ist kompliziert.“
So saßen sie wieder lange zusammen, der Salat war gut, der Wein war gut, die Stimmung war gut – es war überhaupt ein guter Abend.
Die Gartenlaube
Letzten Samstag besuchte Bob Alice in ihrem Garten. Die war gerade dabei, ihre Gartenlaube neu zu streichen.
„Du werkelst ja schon wieder an deinem Schuppen herum“ rief er.
„Das ist schon lange kein Schuppen mehr, das ist eine Gartenlaube“ erwiderte Alice mit gespielter Empörung.
„Du hast recht. Ich glaube, in den letzten Jahren hast du alle Wände erneuert und auch der Fußboden und das Dach sind neu. Wahrscheinlich ist kein Brett von dem Schuppen übrig geblieben, der da früher stand!“
„Das stimmt. Und das Häuschen ist geräumiger geworden, die Fenster größer, die Tür breiter!“
„Wenn ich das richtig sehe“ meinte Bob, „hast du im Laufe der Zeit sogar das ganze Haus ein Stück zur Seite gerückt?“
„Gut erkannt!“ Alice lachte. „Ich hab erst an der einen Seite einen Meter angebaut und später, als ich die andere Seite erneuern wollte, hab ich mich entschlossen, das Häuschen doch wieder etwas schmaler zu machen. So ist es ein bisschen gewandert.“
„Genau genommen ist es gar nicht mehr das gleiche Haus,“ sinnierte Bob, indem er sich auf der Terrasse in die Sonne setzte. „Es steht nicht am selben Fleck, kein einziges Brett ist vom alten Haus übrig, und es ist auch kein Schuppen mehr,“ setzte er spöttisch hinzu „sondern eine Gartenlaube!“
„Was für ein Unsinn!“ Alice schien ärgerlich zu werden: „Natürlich ist es das selbe Haus! Ich bin jedes Jahr in dieses Haus hineingegangen und aus ihm herausgekommen. Es ist dasselbe Haus geblieben, es hat sich nur verändert!“
„Wie kann eine Gartenlaube mit großem Fenster und breiter Tür, sauber verarbeitetem dickem Holz, glattem Boden und regendichtem Dach das selbe Haus sein wie der windschiefe Schuppen, der vor Jahren hier stand?“ fragte Bob.
Alice erklärte: „Es kommt für die Identität gar nicht darauf an, dass alle Eigenschaften übereinstimmen. Es kommt auf die Kontinuität in der Veränderung an. Ich habe jedes Jahr an diesem Schuppen irgendetwas verändert, aber es war immer mein Gartenhäuschen, an dem ich gearbeitet habe. Und weil es immer das selbe Häuschen war, ist es auch noch dasselbe wie am ersten Tag.“
„Aber wenn wir Identität überprüfen, dann prüfen wir das an den Merkmalen, die wir jetzt feststellen. Wenn der Beamte an der Grenze in meinen Ausweis schaut, dann muss ich darin so aussehen, wie ich eben jetzt aussehe, deshalb brauche ich ja auch alle paar Jahre einen neuen Ausweis! Und wenn du jemandem ein Foto von dem Schuppen zeigst, der hier vor Jahren stand, dann wird der dir nie glauben, dass das der selbe ist wie der, der jetzt da steht. Wir können die Identität eines Dings nur an den Eigenschaften prüfen, die es jetzt hat!“
„Das Problem ist, dass wir das so sehen, ja.“ Antwortete Alice „Wir könnten ja auch die Geschichte des Dings erzählen, um seine Identität mit sich selbst zu belegen.“
Bob schwieg, schloss die Augen und genoss die Frühlingssonne. Er dachte, dass er früher, als Kind, nicht einfach so daliegen mochte, da wäre er durch den Garten getobt, hätte mit Alice gerauft… er hatte sich ganz schön verändert.
Alice hantierte mit ihrem Werkzeug, sie schlug schon wieder irgendwo einen Nagel ein: „Du bist auch nicht mehr derselbe wie früher! Früher hättest du mich gefragt, ob du mir helfen kannst!“
Die Warteschlange
Fast wäre Bob zu seiner letzten Verabredung mit Alice zu spät gekommen, denn er hatte wirklich lange an der Supermarktkasse anstehen müssen. Dennoch, so berichtete er Alice gleich nach der Begrüßung, hatte er eigentlich eine müde alte Dame noch vorlassen wollen, die er ganz am Ende der Warteschlange erspäht hatte als er gerade dabei war, seine eigenen Einkäufe aufs Band zu legen. Freundlich hatte er ihr zugerufen, sie solle doch nach vorn kommen und sich vor ihm selbst einreihen, dann wäre sie direkt als nächste Kundin an der Kasse gewesen.
Alice lächelte wissend, denn sie ahnte schon, was dann passiert war: „Das haben sich die anderen Kunden natürlich nicht gefallen lassen, stimmt’s?“
„So ist es,“ antwortete Bob aufgeregt, „manche Leute haben sich so empört, dass die arme Frau ganz eingeschüchtert in der Reihe stehen geblieben ist. Sie hat sich fast entschuldigt für meinen Vorschlag!“
„Du weißt natürlich nicht, wie es den Leuten ging, die selbst in der Schlange standen. Vielleicht war jemand krank, hatte Fieber und musste aber dringend was einkaufen? Vielleicht war eine alleinstehende Mutter dabei, deren Kinder zu Hause warteten? Vielleicht kam jemand von einer anstrengenden Schicht und brauchte noch etwas zum Abendbrot…“
Bob war unzufrieden: „Gut gut gut, mag alles sein. Aber wenn man so denkt, kann man nie einem Menschen gegenüber was Gutes tun! Es kann ja immer sein, dass man irgendwem anderes damit ein Leid zufügt, ohne es zu wissen.“
Alice überlegte: „Na, es gibt schon Situationen, in denen klar ist, dass du jemandem helfen kannst, ohne dass jemand anders betroffen ist. Wenn die Frau direkt hinter dir in der Schlange gewesen wäre, hättest du sie natürlich vorlassen können, das hätte niemanden gestört.“
„Aber selbst dann könnte man sagen, dass ich die Zeit, die ich selbst dabei verloren hätte, eher für jemanden anders hätte einsetzen sollen…“ antwortete Bob „auf jeden Fall aber bleiben nur wenige und sehr unbedeutende Momente übrig, in denen ich etwas Gutes tun könnte, wenn ich ständig über die Konsequenzen für andere nachdenke, bevor ich überhaupt etwas tue. Das kann nicht richtig sein.“
„Da hast du recht“ musste Alice zugeben. „Außerdem klingt das auch nach einer Ausrede, man überlegt so lange, ob es richtig wäre, zu handeln, bis die Situation vorbei ist. Irgendwie habe ich ja auch das Gefühl, dass es richtig war, dass du die alte Frau nach vorn durchlassen wolltest.“
Bobs Gesicht hellte sich auf: „Vielleicht liegt unser Denkfehler ganz woanders. Natürlich war es richtig, die Frau nach vorn zu bitten. Meine moralische Intuition hat es mir gesagt, und alle rationalen Erwägungen verwässern das nur. Aber es war falsch, über die anderen zu richten, die sich aufgeregt haben. Denn vielleicht waren sie auch im Recht, ich kannte ja ihre Gründe nicht.“
„Das hieße,“ antwortete Alice, „dass man eigentlich immer im Dilemma ist, wenn man moralisch handeln will. Man kann nicht alles richtig machen, und man hat nicht genug Zeit, alle Informationen zu beschaffen und alles zu erwägen. Man muss eben seiner Intuition, seinem Gewissen folgen. Aber man sollte auch nachsichtig mit denen sein, die meinen, dass diese Handlung falsch war.“
Buridans Bergsteiger
In diesem Sommer verbrachten Alice und Bob eine Woche gemeinsam in den Bergen. Nach einer langen und anstrengenden Tour durch unwegsames Gelände und mit einiger Kletterei sagte Alice Abends lachend zu Bob: „Du hast mich heute manchmal an Buridans Esel erinnert, der vor zwei gleich großen Heuhaufen stand, sich nicht entscheiden konnte, von welchem er fressen sollte und schließlich verhungert ist. So hast du manchmal fast ewig vor schwierigen Kletterstellen gestanden und konntest dich nicht entscheiden, ob du hier- oder dorthin trittst.“
„So eine Entscheidung ist ja auch schwierig,“ erwiderte Bob, „hier ist der Griff besser zu erreichen, dort kann man besser Tritt fassen. Da ist der Stein feucht und rutschig, dort ist das Gestein locker und bietet keinen sicheren Halt. Wie soll man da die beste Entscheidung für den richtigen Weg treffen?“
„Wichtig ist, dass du dich überhaupt entscheidest, sonst kommst du nie ans Ziel!“ lachte Alice.
Bob überlegte: „Und überhaupt, was heißt denn ‚Entscheidung‘? Die meiste Zeit bin ich ja einfach geklettert und gestiegen und getreten ohne zu überlegen. Ohne Abwägung und Überlegung gibt es gar keine Entscheidung!“
„Da gebe ich dir mal Recht.“ Alice wurde ernst. „Entscheidung bedeutet, dass man abwägt und Gründe für den einen oder den anderen Weg angeben und bewerten kann. Auch, dass man über Konsequenzen der einen oder anderen Variante nachdenkt – und dann die auswählt, die einem als beste Lösung erscheint.“
„Das würde aber heißen,“ meinte Bob, „dass ich zumeist gar keine Entscheidungen treffe, wenn ich etwas tue. Die meisten Dinge mache ich ohne darüber nachzudenken: gehen, essen, an der Kreuzung bei Rot stehen bleiben… und auch beim Bergsteigen greife ich doch meistens automatisch nach dem richtigen Felsvorsprung. Ich handle intuitiv, nicht überlegend!“
„Jede Erfahrung, die du machst, trägt dazu bei, dass du später weniger entscheiden musst, du hast sozusagen mit jeder guten Entscheidung schon für viele spätere Situationen, die ähnlich sind, mit entschieden.“ Alice liebte es, wenn sie Bob etwas erklären konnte.
„Gut, das klingt plausibel. Das erklärt auch, warum ich früher viel länger überlegt habe und viel unsicherer war, wenn ich in den Bergen unterwegs war – und warum du viel sicherer und schneller entscheidest, wo du lang gehst, denn du hast mehr Erfahrung.“
Alice lächelte zustimmend, sie liebte es auch, wenn Bob ihr Komplimente machte.
Bob fuhr fort: „Aber wenn ich es mir recht überlege, hat die Sache einen Haken: meistens könnte ich dir nämlich nicht sagen, warum ich mich gerade so und nicht für einen anderen Weg entschieden habe. Ich schaue hier hin und dort hin, sehe diese Möglichkeit und jenes Risiko, und am Ende handle ich dann einfach irgendwie.“
Alice überlegte. „Ist das wirklich so? Vielleicht kannst du dich im Nachhinein nur nicht erinnern, warum du dich so und nicht anders entschieden hast…“. Aber Bob unterbrach sie: „Vielleicht haben ja doch diejenigen recht, die sagen, dass es gar keine Entscheidungsfreiheit und keinen freien Willen gibt! Ich bilde mir nur ein, dass es meine Entscheidung wäre, wie ich handle, aber in Wirklichkeit bin ich ein Automat, der aus Erfahrungen lernt und sich einfach nach Programmen bewegt! Und meine Entscheidungsfreiheit ist vielleicht nur Einbildung!“
„Beruhige dich!“ Alice lächelte wieder. „Es wird wohl eher so sein, dass deine Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten ergeben hat, dass beide Wege möglich sind und dass du nicht genug Informationen hast, um eine besser zu bewerten als die andere. Und dann entscheidest du dich, den Zufall entscheiden zu lassen: Da, wo du gerade hinschaust, trittst du auch hin. Trotzdem basiert also deine Handlung auf einer echten Entscheidung. Und deine Entscheidungsfreiheit ist davon nicht beeinträchtigt. Würdest du nicht Gründe haben, die dich vermuten lassen, dass beide Wege gangbar sind, dann würdest du keinen von beiden nehmen.“
„Das stimmt.“ Bob war zufrieden. „Manchmal stehe ich da und überlege hin und her. Und dann sage ich mir plötzlich: Ist doch egal, ob links oder rechts, Hauptsache ich gehe endlich weiter. Weil du ja nie wartest!“
„Meine Ungeduld ist eben auch ein Umstand, der deine Entscheidung beeinflusst. Sie sorgt dafür, dass du dich entscheidest, etwas zu tun, auch wenn du noch nicht ganz sicher bist, den besten Weg gefunden zu haben. Aber bei unserer nächsten Tour schau bitte einfach, wo ich langgehe. Du weißt ja, ich hab mehr Erfahrung als du.“
Wann ist ein Berg ein Berg?
Wenn die Wanderung nicht ganz so anstrengend war, sprang Bob gern von einer kleinen Anhöhe zur nächsten und stieg auf jeden Stein am Wegesrand. Jedes Mal rief er „Schon wieder bin ich auf einen Berg gestiegen“ oder „Ich habe schon wieder einen Gipfel erklommen!“ Alice lächelte nachsichtig und sagte: „Das sind weder Berge noch Gipfel. Du kannst nicht jede kleine Erhebung als Gipfel oder gar als Berg bezeichnen!“
„Aber warum nicht? Gibt es eine allgemeine Definition, die ich anerkennen müsste?“
Am Abend recherchierte Alice im Internet und kam zu dem Schluss: „Eine allgemeine Definition gibt es wohl nicht. Aber man versucht schon, festzulegen, wann eine Erhebung als Berg oder als Gipfel zählt.“
„Das ist doch aber merkwürdig, findest du nicht?“ fragte Bob. „Ich meine, wir reden so sicher davon, dass der Watzmann z.B. ein Berg ist, der drei Gipfel hat. Man weiß sogar ganz genau, wie viele 8.000er es gibt, obwohl da bestimmt mehr einzelne Felsspitzen stehen. Aber es gibt keine genaue Definition?“
„Selbst wenn es eine gäbe,“ erwiderte Alice, „warum solltest du sie für dich anerkennen? Wer soll uns beiden vorschreiben, wann wir etwas als Berg anerkennen? Schließlich gibt es kein objektives Kriterium, so etwas ist immer Verabredung. Denk an die Sache mit den Planeten, da wurde entschieden, dass Pluto kein Planet mehr ist, nur, weil er ein bisschen zu klein ist!“
„Aber wenn in den Zeitungen steht, dass eine Bergsteigerin alle 8.000er bestiegen hat, dann muss es doch eine allgemeine Bestimmung geben, nach der man festlegen kann, dass genau diese Gipfel als 8.000er gelten!“
„Na klar, das wird festgelegt, und wenn alle sich an die Festlegung halten, dann ist es eben so. Da wird dann eben gesagt, dass im Himalaja alle Erhebungen mit einer Schartenhöhe von mindestens 500 m eigenständige Berge sind, und schon kannst du durchzählen, wie viele davon über 8.000 m hoch sind.“
„Vorausgesetzt, man einigt sich auch noch darüber, wo genau die Null-Höhe ist, von der aus man misst…“
Beide schwiegen. Dann sagte Bob: „Meistens ist es also bloße Verabredung, eine Festlegung von irgendeiner Autorität, wenn wir in der Natur ein einzelnes Ding als Individuum ansehen und von anderen abgrenzen. Und man benötigt das nur, weil man irgendwas bewerten oder vergleichen will. Das würde bedeuten, dass die Natur gar nicht aus Einzeldingen besteht! Es gibt gar keine Berge, auch keine Ozeane oder Kontinente, was genau dazu gehört oder ob nicht alles fließend ineinander übergeht, ist irgendwie nur willkürlich festgelegt. Und nur, weil wir das in der Praxis akzeptieren, wird es ‚real‘. Was für eine merkwürdige Realität!“
Alice sinnierte: „Ganz so kann es auch nicht sein. Schau, wir standen gestern vor einem Berg, auf den wir steigen wollten, wir konnten darauf zeigen, und waren einig, dass das ein Berg ist. Und als wir oben waren, waren wir auch sicher, dass wir auf einen richtigen Berg gestiegen waren.“
„Stimmt,“ antwortete Bob, „wir können uns sozusagen an sicheren Beispielen sicher darauf einigen, dass das wirklich so ein Ding von der Sorte ist, wie unser Begriff es sagt. Aber es hängt dann doch immer noch von unserer Sprache und unserer Verständigung ab. Als ob das Ding dadurch zum Berg würde, dass wir es so nennen!“
„Und dadurch, dass wir draufsteigen und übers Land schauen und uns über die Aussicht freuen, denn man von dieser Höhe aus hat. Das ist es ja auch, was den Berg zum Berg macht: Die Möglichkeit, hochzusteigen, sich dabei anzustrengen und dann die Aussicht zu genießen.“
„Und stolz darauf zu sein, was man gemacht hat! Was scheren uns die Definitionen der Autoritäten? Ein Berg ist die Anstrengung beim Hochsteigen und die Freude beim weiten Blick übers Land und der stolz auf das, was man da getan hat.“
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


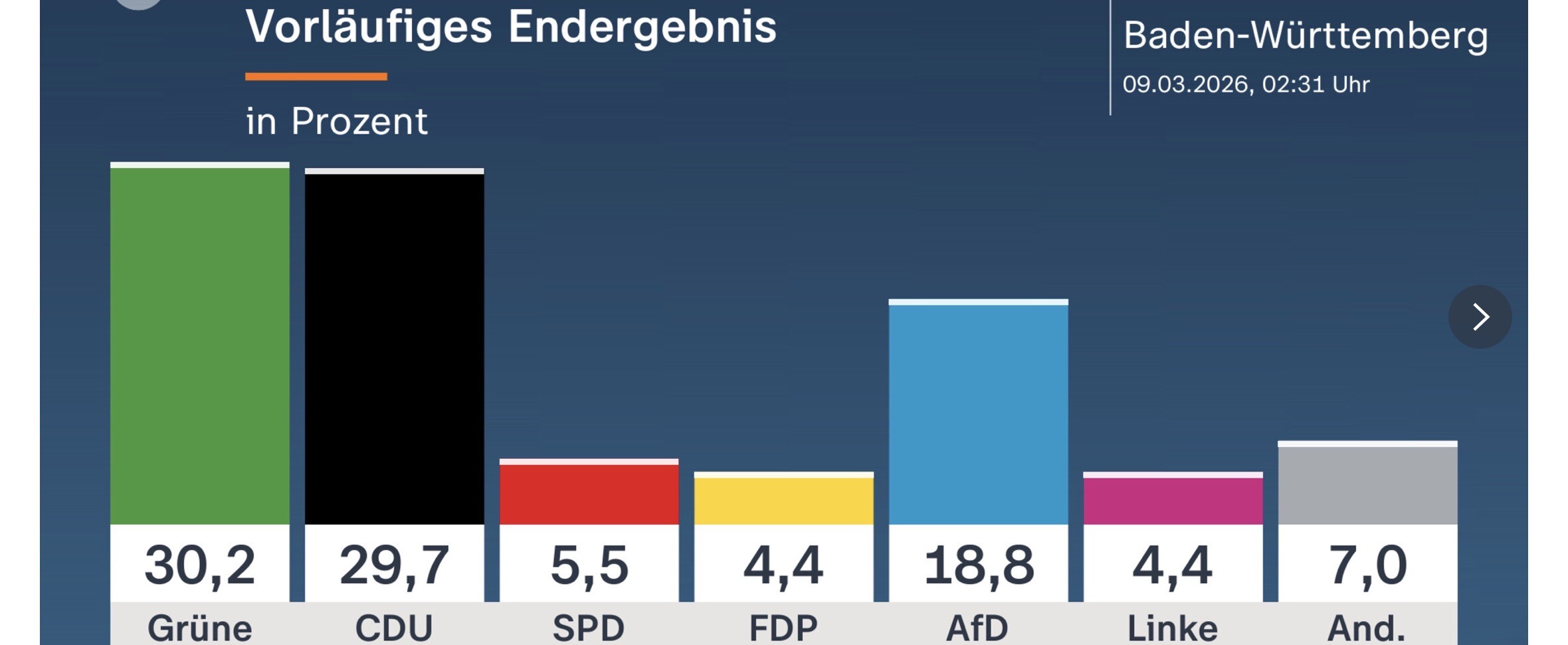

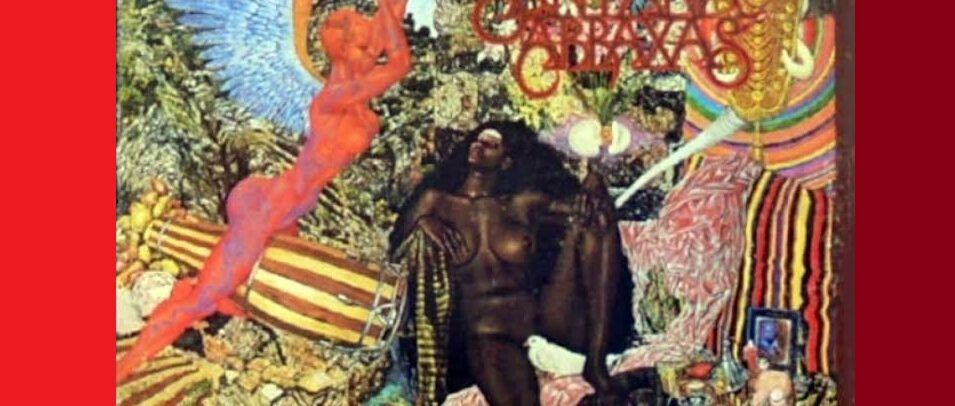
Ihr Kommentar