Manchmal lauscht man einem Vortrag und fühlt sich mehr und mehr unwohl. So ging es mir heute beim Vortrag von Christoph Türcke beim Philosophicum Lech, den er unter dem Titel „Wir kommen nicht von Gott los, solange wir mit Geld hantieren“ hielt. Ich hatte den Eindruck, da reiht einer eine unbegründete These an die andere, ich wollte bei jedem zweiten Satz aufbegehren, widersprechen, nach Belegen fragen, Ungereimtheiten aufzeigen. Das Publikum um mich herum aber war begeistert, beifälliges Gelächter und Zwischenapplaus zeigten, dass Türcke rhetorisch gekonnt und inhaltlich erwartbar die Meinungen der Zuhörer über den Gegenstand seines Vortrags bestätigte.
Aber was war eigentlich der Gegenstand? Christoph Türcke erzählte eine Geschichte des Geldes, genauer, seine Geschichte des Geldes. Klug ist es immer, das habe ich inzwischen gelernt, wenn man zu diesem Zweck eine Behauptung über die bisherigen Vorstellungen von dieser Geschichte in die Welt setzt, um diese sodann als Märchen abzutun und die eigenen Geschichte als den neuen, plausiblen, nachweisbaren tatsächlichen Verlauf des Geschehens hinzustellen.
Märchen und Gegenmärchen
Das Märchen ist nach Türcke, dass das Geld aus dem Tausch entstanden sei, dass es sozusagen aus allen Tauschgegenständen wegen seiner besonderen Fähigkeit, bloßer Tauschgegenstand sein zu können, hervorgegangen sei.
Es ist natürlich für das freie Denken ertragreich, einer bekannten und weitgehend akzeptierten Geschichte eine andere, wenigstens ebenso plausible Geschichte entgegenzusetzen. Wenn man die eine aber als Märchen, die eigene jedoch als Tatsache hinstellt, dann muss mehr kommen, Belege, die die eine verwerfen und die eigene stützen.
Türckes Geschichte ist, dass das Geld aus der Schuld stammt. Das ist nun noch nicht so spektakulär. Dass das Wort Geld auch nicht von Gold kommt, sondern von Gilt, was irgendwie eben Schuld bedeutet, ist auch keine große Sache, schließlich steckt ein solcher Wortstamm auch noch im „Vergelten“ der Schuld.
Der große Wurf, den Christoph Türcke machen will, ist, dass es nicht um eine Schuld gegenüber jemanden anders, etwa für eine erhaltene Leistung oder Wäre, geht, sondern um eine Schuld gegenüber Göttern, und dass die Schuldzahlung das Opfer an diese Gottheiten ist. Wobei Türcke, rhetorisch geschickt gespickt mit launigen Bemerkungen und Anspielungen, eine für mich ziemlich krude Geschichte darüber erzählt, dass die Menschen irgendwie mit der Gewalt beim Schlachten klarkommen wollten, indem sie sie immer wieder erneut wiederholten, und dann im Verlaufe der Jahrtausende durch Opferungen von immer kleineren Tieren und schließlich nur noch Abbildungen von Tieren (goldenes Kalb) ersetzten. Ich gebe zu, dass das jetzt deshalb unverständlich ist, weil ich es wirklich nicht verstanden habe.
Metaphorisches Argumentieren
Aber durch diese Umstellung der Opferung auf Metallgegenstände kommt es eben zur ersten Kapitalakkumulation, und zwar in den Tempeln, und die Priester konnten, gegen Gebühr, die Opfer erneut herausgeben, damit sie wieder geopfert werden konnten. Damit kann Christoph Türcke dann geschickt einen metaphorischen Bogen spannen zu den heutigen Geldtempeln (Zentralbanken) und den heutigen Priestern, deren Oberpriester der Zentralbankchef Draghi ist.
Wozu eine plausibel nachvollziehbare Erklärung liefern, wo die Metapher doch so schön ist und beim Publikum auf freudige Begeisterung stößt? Da macht es dann auch nichts, dass Christoph Türcke für seine Initialerzählung keinen Beleg beibringt, was er natürlich auch nicht kann, weil man eine so anspruchsvolle Erzählung über Geschehnisse, die viele Jahrtausende zurückliegen und Jahrtausende gedauert haben sollen, nicht wirklich aus ein paar prähistorischen Funden herausdeuten kann. In der Diskussion vertritt Türke die These, es gäbe keine frühe Kultur, in der es keine Opfer gäbe. Zutreffend wäre vielleicht, dass Christoph Türcke keine Kultur kennt, in deren Überreste er nicht irgendwie irgendetwas wie ein Opfer hineindeuten könnte.
Technik als Selbstzweck
Auch Käte Meyer-Drawe setzte sich in ihrem Vortrag „Im Anfang war Technik“ mit einer bekannten und weit akzeptierten Deutung auseinander, der sie eine eigene Deutung entgegensetzte. Sie zeigte aber, dass das auch anders geht, weniger rhetorisch brillant, weniger spektakulär, dafür mit Belegen und plausiblen Rekonstruktionen.
Die These, gegen die Meyer-Drawe sich wendet, ist die, dass Technik immer etwas Instrumentelles ist, dass sie Mittel zum Zweck sei. Vielmehr, so könnte man sagen, ist Technik immer selbst Zweck, ist Selbstzweck.
Dazu zeigt sie zunächst, dass schon in den ersten Schöpfungsgeschichten immer Technik im Spiel war. Gott schuf den Menschen, ebenso wie es Prometheus tat, aus Erde, er war quasi ein töpfernder Gott. Hier könnte man mit einem Augenzwinkern einwenden, dass Technik im Sinne einer regelgeleiteten beherrschten Herstellungsprozesses etwas ist, was Übung und Erfahrung, in jedem Falle Wiederholung verlangt. Das wievielte Exemplar in der Töpferei Gottes mag der Mensch gewesen sein? Beherrschte er die Technik des Menschenmachens bereits? Oder ist der Mensch sein erster Versuch? Das würde manches erklären.
Zwecklose Maschinen
Doch Spaß beiseite. Das zentrale Argument Meyer-Drawes ist, dass der Mensch immer Maschinen gebaut hat, die keinen Zweck erfüllen, oder die einen Zweck erfüllen, den man mit geringerem Aufwand auch ohne diese Technik erfüllen kann. Dafür bringt sie eine Vielzahl von Beispielen aus verschiedenen Jahrhunderten, vom Bratenwender im Mittelalter bis zum Raketenauto. Jeder im Publikum hätte danach aus eigenem Erleben weitere Beispiele nennen können.
Meyer-Drawe zeigt Bilder von Höllenmaschinen und verweist darauf, dass diese weit vielfältiger und spannender waren als die Himmelsmaschinen. Man ist mit ihr fasziniert von der Phantasie, welche die Menschen darauf verwendet haben, solche Maschinen auszudenken.
All das macht plausibel, dass Technik eben zunächst nicht ein Mittel zur Erreichung bestimmter Zwecke ist, sondern dass Technik oft, vielleicht sogar in erster Linie, um ihrer selbst Willen erdacht und realisiert wird. Die instrumentelle Bestimmung der Technik kann weit weniger erklären, als es zunächst scheint. Vielmehr scheint Technik tatsächlich einem kreativen Spieltrieb des Menschen zu entspringen. Eine These, die, wenn man genau darüber nachdenkt, eigentlich gar nicht so umwerfend ist. Eigentlich, so denkt man am Ende, habe ich das doch schon zuvor gewusst, es war von der herrschenden Deutung nur verdeckt.
Was würde Heidegger antworten?
Für mich ist diese Idee die plausibelste Technikdeutung seit Heideggers Gestell, und es wäre reizvoll, diese beiden Deutungen einmal miteinander ins Gespräch zu bringen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ihnen hat dieser Artikel gefallen? Sie möchten die Arbeit der Kolumnisten unterstützen? Dann freuen wir uns über Ihre Spende:
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



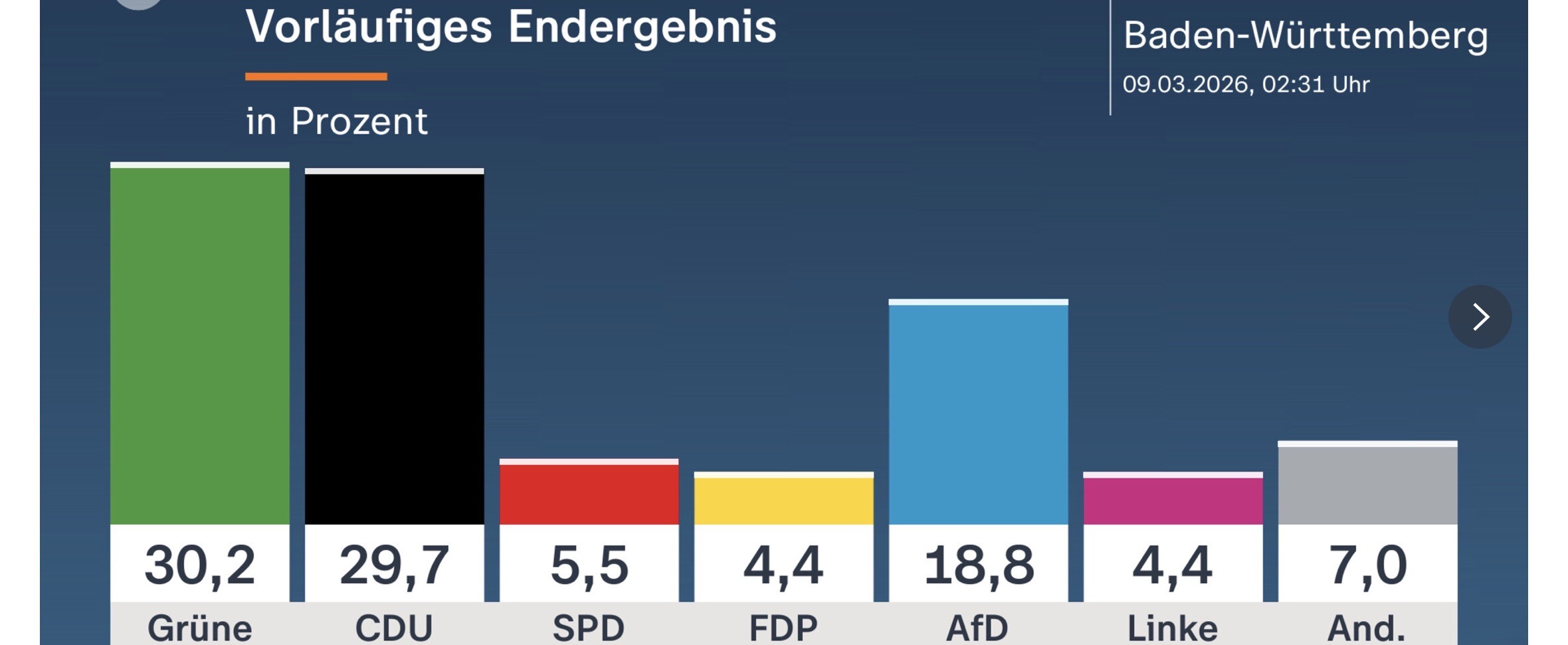

Ihr Kommentar