„Hast du dir die letzte Staffel von Stranger Things angesehen?“, will die alte Schulfreundin wissen, als wir am (späten) Morgen des 1. Januar telefonieren, um uns gegenseitig ein vor allem gesundes Neues Jahr zu wünschen.
„Die ersten 3 Episoden haben mich nicht vom Hocker gehauen“, sage ich.
„Schau dir ALLE Folgen an, und im Anschluss setzt du dich an eine Kolumne. Das machst du doch gerne.“
„Okay.“
Und so habe ich den Neujahrsabend damit verbracht, mir den Rest von Stranger Things (und zwei Packungen gesalzene Chips) reinzuziehen.
Eine Pause, die jede emotionale Bindung gekappt hat
Es ist kein gutes Zeichen, wenn man das Staffelfinale einer Serie einschaltet und sich dabei ertappt, wie man sich fragt: Moment, worum ging es hier eigentlich noch mal genau? Wer ist tot, wer nicht, wer steckt im anderen Paralleluniversum fest – und warum überhaupt? Die Pause zwischen Staffel vier und fünf von Stranger Things war nicht einfach nur lang, sie war dramaturgisch tödlich. Zu viel Zeit, um sich emotional zu entkoppeln, zu viel Raum für andere Serien, andere Geschichten, andere Obsessionen.
So beginnt das große Finale nicht mit Gänsehaut, sondern mit Rekapitulation. Mit innerem Nachschlagen. Mit dem unguten Gefühl, dass man eigentlich erst mal ein Previously-on bräuchte, das länger dauert als eine Episode.
Wenn Nostalgie zur Dekoration verkommt
Dabei war Stranger Things einmal genau das Gegenteil davon: eine Serie, die einen sofort hineinzieht, die nicht alles ausbuchstabiert, sondern andeutet, die Atmosphäre über Logik stellt. Das 80er-Jahre-Flair war dabei nie bloß Kulisse, sondern emotionale Abkürzung.
In Staffel fünf wirkt diese Nostalgie jedoch zunehmend erschöpft. Fahrräder, Walkie-Talkies, Synthesizer, Neonfarben – alles schon gesehen, alles schon zitiert, alles schon bis zur Selbstparodie ausgereizt. Was früher liebevolle Referenz war, fühlt sich nun an wie ein Pflichtprogramm: Ach ja, wir sind ja immer noch in den Achtzigern. Das Stilmittel trägt nichts Neues mehr bei, es erinnert eher daran, wie frisch sich das alles einmal angefühlt hat.
Vom Flüstern zum Dauerfeuer
Und genau hier beginnt das eigentliche Problem dieser Staffel. Stranger Things hat sich von seiner eigenen Zurückhaltung verabschiedet. Wo früher das Unheimliche im Verborgenen lauerte, regiert nun die Dauerbeschallung aus Actionsequenzen, CGI-Monstern und dramatischen Kamerafahrten.
Das Upside Down ist kein albtraumhafter Ort mehr, sondern ein digital aufpolierter Abenteuerspielplatz. Beeindruckend? Ohne Frage. Aber Spannung entsteht nicht durch Lautstärke. Sie entsteht durch Erwartung, durch Leere, durch das, was man nicht sieht. All das geht im Effektrausch verloren.
Warum erklärtes Böses kein gutes Böses ist
Der grundlegendste Fehler von Staffel fünf liegt jedoch tiefer – er ist konzeptionell. Das Böse, das über Jahre hinweg bewusst diffus blieb, wird nun greifbar gemacht, historisiert, motiviert. Ursprünge werden offengelegt, Zusammenhänge ausformuliert, innere Logiken präsentiert.
Was als Mysterium begann, endet als Gegner mit Lebenslauf. Und damit verliert das Böse genau das, was es gefährlich gemacht hat: seine Unberechenbarkeit. Ein erklärter Schrecken ist kein Schrecken mehr, sondern ein Problem, das gelöst werden will. Ein Bosslevel. Kein Albtraum.
Effekte statt Atmosphäre
Man spürt in jeder Folge den Wunsch, noch größer, noch epischer, noch endgültiger zu sein. Doch je mehr gezeigt wird, desto weniger bleibt hängen. Die Serie vertraut nicht mehr auf das Unbehagen, sondern auf die Wucht.
Das ist ein altes Serienproblem: der Glaube, dass ein Finale alles toppen muss, was zuvor war. Dabei hätte Stranger Things gerade am Ende von Reduktion profitiert. Von Dunkelheit. Von Stille. Von dem Mut, Dinge offen zu lassen.
Dialoge, die mehr sagen – und weniger bedeuten
Hinzu kommen Dialoge, die erschreckend oft wirken, als seien sie nicht geschrieben, sondern aus vorgefertigten Textbausteinen zusammengesetzt worden. Viel Pathos, viele bedeutungsschwere Pausen, viele Sätze, die offensichtlich dafür gedacht sind, zitiert zu werden – und genau deshalb leer bleiben.
Emotion wird behauptet, nicht erzeugt. Figuren sagen, was sie fühlen, statt es zu zeigen. Man hört zu und merkt, wie einem langsam die Augenlider schwer werden. Das ist bequemes Erzählen. Und es ist langweilig.
Will weint, der Zuschauer gähnt
Am deutlichsten zeigt sich diese erzählerische Ermüdung im Coming-out von Will. Was eigentlich ein leiser, berührender Moment hätte sein können, wird zu einer überdehnten, künstlich aufgeladenen Tränendrüsen-Nummer. Jede Subtilität wird vermieden, jede Emotion mehrfach ausgestellt.
Repräsentation ist wichtig – aber sie funktioniert nicht über Länge und Nachdruck, sondern über Wahrhaftigkeit. Über kleine Gesten, über Unsicherheit, über Vertrauen ins Publikum. All das fehlt hier. Stattdessen spürt man vor allem den Willen der Serie, etwas Bedeutendes zu tun. Und genau das macht den Moment so unecht.
Ein Ende ohne Nachhall
So bleibt vom großen Staffelfinale vor allem Ernüchterung. Nicht, weil Stranger Things plötzlich schlecht wäre – sondern weil es sich selbst nicht mehr traut. Es traut dem Geheimnis nicht, der Stille nicht, dem Unausgesprochenen nicht.
Alles muss größer, lauter, eindeutiger werden. Und verliert dabei genau das, was diese Serie einst ausgezeichnet hat. Stranger Things verabschiedet sich mit viel Lärm – und erstaunlich wenig Nachhall.
Und man bleibt zurück mit dem Gefühl, nicht nur eine Serie verloren zu haben. Sondern ein Geheimnis.
+++
„Und – wie fandst du das Finale?“, erkundigt sich die alte Schulfreundin gestern Abend per WhatsApp.
„Lies morgen meine Kolumne. Da steht alles drin.“
„Vorher drüber reden willst du nicht?“
„Nein.“
Lesen Sie auch: Del Toros schönster Leichnam
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.




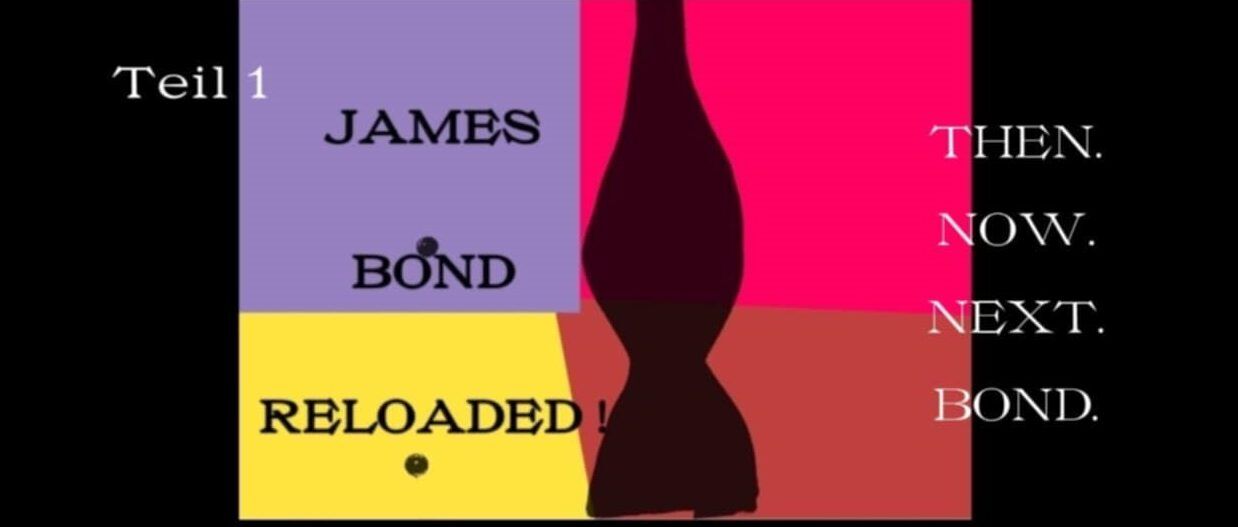

Ihr Kommentar