This ain′t no upwardly mobile freewayOh no, this is the road to Hell.“(Christopher Anton Rea – „The Road to Hell‘, 1989)
England kurz nach dem Millenium: Chris Rea ist mit einiger Berechtigung total bedient. Seine Karriere? Tja, nett. Und kommerziell durchaus beeindruckend. Der Preis des Erfolges? Mangelnde künstlerische Anerkennung durch Charisma hindernde Schlagerrock- und Schmalz- Produktionen vonseiten des knebelnden Labels. Auf der marginalisierten Strecke blieb dabei der Blues, seine musikalische Urantriebsfeder.
Der Blues?
Davon kann er wahrlich (s)ein Lied singen.
Mehr als ein halbes Jahr im Hospital verbracht, bis es sich als Hospiz anfühlt. Vor der ersten Krebsoperation gab man ihm knapp 30% Überlebenschance. Vier auszehrende weitere sollten folgen.
Tja, das kann einem als Ausgangslage schon mal den Tag eintrüben. „Looking for the Summer“ fällt da nicht durchgängig leicht.
Weil …
Sensenmann auf der Schulter.
steiniger Weg zur Hölle.
Ach klar, doch wie sagte bereits der große Philosoph Judd Crandall in Stephen Kings „Pet Semetary“?
„Der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger.“,
zumindest dieses Mannes.
Rea überlebt.
Erfindet sich neu.
Oder präziser: Er ist höchstselbst samt seiner Musik erstmalig präsent und letztere das einzige Maß aller Dinge.
In Ausdruck, Arrangement & Sound.
Das Ergebnis heißt – wie soll es anders sein – „Stoney Road“ (2002)
Ein Album getragen von sarkastisch galletropfender Bitternis wie simultan selbstironisch milder Lebensweisheit. Alles gekleidet in einem prachtvollen Klangmantel aus erdig abbluesendem Stoff in rauchigem Timbre.
So ganz bei sich definiert er mithin seine eigene Nische als höchst archetypische Kreatur zwischen Blues-Teufeln wie Tom Waits oder Dr. John hie & Ry gecooderten Steely Dan/Dire Straits dort.
Künstlerisch sicher ein super Comeback. Doch in finanzieller Hinsicht muss er nunmehr deutliche Abstriche machen. Natürlich ist sein Major Label nicht bereit, diesen Weg mitzubeschreiten. Selbstverständlich kommt es zum unschönen Bruch.
Das schöne: Rea ist dieser Umstand bereits komplett egal. Längst geht es ihm darum, künstlerisch einfach genau dorthin zu gelangen, wo sein Talent liegt und zwar bevor es dort begraben liegt.
So wurden die Hallen kleiner.
Die ultimativ kreative Explosion stand jedoch noch bevor.
Und diese zu verstehen, muss man vor allem einen Blick auf die Vergangenheit Reas werfen.
Kurz zusammengefasst: Chris Rea stammt von einer irischen Mutter und einem italienischen Vater ab.Von frühster Jugend an ist er absolut Gastro- und Service erfahren durch den Betrieb seiner Eltern. Die Kunst jedoch überfällt ihn erst mit ca 20 Jahren. Hier nimmt er zum ersten Mal eine Gitarre in die Hand und bringt sich das Spielen autodidaktisch bei. Eine vollkommen neue Definition des Spätzünders. Reicht derlei doch normalerweise höchstens für Partykellerkombos. Doch Rea macht aus sich mehr oder weniger nebenbei einen der besten Slide-Gitarristen des Planeten.
Das Label sieht das alles null und dengelt seine toll geschriebenen Songs albumweise zunächst als eine Art Billy Joel Radioformat-Rock um, bloß etwas britischer gedacht.
Es verkaufte sich selbstredend genauso mittelmäßig wie die schlecht gealterten Tracks klingen.
Segen und Fluch folgte dann auf „Shamrock Diaries“ (1985) mit „Josephine“, etwas später mit „Julia“ (1987), beide oft als romantische Liebespaar Songs missverstanden, obgleich für seine Töchter komponiert, oder dem unentrinnbaren „Driving Home for Christmas“ kurz darauf.
Segen, weil Bekanntheit und kommerzieller Erfolg damit offenkundig zementiert wurden.
Fluch, weil das Label bewusst eine seichte Produktion durchsetzte, um bitte auch – so analog Roy Black – Schwiegermütter und goldene Hochzeiten sowie alle Elton John Fans abzuräumen. Man färbte sogar sein rabenschwarzes Haar gen beachblond, auf das der vollkommen unpassende Look ein „Everybody’s Darling“-Image kultiviere.
Als Resultat dieser Taktik hört man im Radio flächendeckend Reas kirmesgniedelnde Gummigitarrentracks wie etwa „Let’s Dance“ oder „Auberge“, die jede schicke Grundidee dermaßen zuckerummantelt. Man wird vom bloßen Hören entweder fast Diabetiker oder ist selbst Phil Collins.
Letzten Endes ruinierten die Producer damit das gesamte Oeuvre Reas bis zur Jahrtausende.
Das lief im Grunde ähnlich schlimm, wie etwa in Deutschland Rio Reisers große Songs ab 1985 in unselig „Codo“-fizierten Plastiksounds vom Annette Humpe und George Glück ersoffen.
Rea zu dem Elend 2002 in einem Talk mit Rebecca Fletcher: „Ich kann es nicht mehr ertragen, meine alten Aufnahmen zu hören.“.
Demgegenüber stehen in seiner Prämileniumsphase jedoch ebenfalls große Nummern wie „On the beach“ (1986) mit seiner Hook für die Ewigkeit, „Looking for the Summer“ (1991) oder „The Road to Hell‘ (1989).
Link: „Road to hell – live“
Nachtblaue Musik voll schwelgender Grooves, sehr laid back angelegt und gelegentlich verziert mit angedeuteten Implosionen, hervorragenden Melodic Rocks.
Neben den obig erwähnten Beispielen empfehle ich für blaue Stunden unbedingt noch „Nothing to fear“ (1992), „Espresso Logic“ (1993) und „The Blue Café“ (1997). Letzteres extra als Soundtrack erdacht für „Schimanski – Blutsbrüder“ (1997 mit Götz George und Christoph Waltz).
Mit anderen Worten: Reas Alben klangen wie Pralinenschachteln. Du weißt nie, was dich erwartet, nur die Hälfte taugt. Um die zu finden, muss man sich auch alles andere reinwürgen.
Bereits auftauchende gesundheitliche Probleme taten ihr übriges.
Als dann der Schmerz zum Bleiben kam, der Kampf um alles, umarmte er diesen Dämon strangulierend, statt ihn lediglich zu verdrängen.
Befreit von letzterem wie auch vom Mordor der Majors schrumpfen zwar die Hallen. Doch die Kunst wächst. Sogar das renommierte, traditionell breit aufgestellte Montreux Jazz Festival ehrt ihn nachfolgend mit einer Einladung.
Das obig genannte „Stony Road“ bildet mithin nur den Auftakt zum Grande Finale.
Jetzt erst kommt die berstende Entfesselung.
„The Blue Jukebox“ (2004) und „Blue Guitars“ (2005) nehmen dimensional in Reas Kosmos etwa jenen essentiellen wie breiten Raum ein, welcher dem „Der dunkle Turm-Zyklus“ in Stephen Kings Katalog zukommt.
Sage und schreibe in jener Zeit 150 selbst komponierte Blues Nummern, die auf insgesamt 12 CDs verschiedenste Facetten des Genres erkunden. Es gibt natürlich den Chicago Blues, Louisiana, Texas, Latin, jazzy knisternden Balladenstoff für die Nachtbar und sogar eine irisch-keltische Variante, die Rea selbstverständlich ganz besonders im Blute liegt.
Ergebnis: All Killer, No Filler, Baby. Die Qualitätsdichte ist dermaßen berückend. Es fällt schwer, einzelne Tracks heraus zu heben. Gleichwohl verschreibe ich jedem – Skeptiker wie Fan – unverzüglich den Genuss mindestens von:
„Immigrant Song“, ein sexy tangoesk angehauchtes Groovemonster, das sicherlich auch Onkel Astor nicht von der akustischen Piazza geworfen hätte.
oder „Hey Gringo“, welches sich als naher Verwandter ZZ Tops präsentiert und auch im „Titty Twister“ Verwendung fände.
Hier der „Immigration Blues“:
Den Rest des Pfades müsst ihr allein erkunden.
Fehlt noch was?
Ja.
„Wie klingt so jemand begnadetes live?“
Genau damit machen wir den Sack nun zu.
Es gibt ein grandioses Live-Dokument namens “ The Road to Hell and Back“ aus Birmingham anno 2006.
Konzerte wurden mittlerweile rar, da Rea bis zu seinem Tod stets aufs Neue mit gravierenden Gesundheitsproblemen zu kämpfen hat.
Wenn er spielt, geraten die Gigs bis zum Ende hervorragend. Dieser ist das ultimative Einsteiger Modul für Newbies.
Aus folgendem Grund:
Alte Perlen wie „On the beach“ oder „Road to hell“ erhalten eine intensive, sehr warme Klangfarbe,
Balsam in sanften Momenten („Where the Blues comes from“), Sandpapier in raueren Gefilden („Work Gang“).
Man hört ihm hier ganz besonders das erdende, in sich ruhende Grundgefühl eines Mannes an, der keinen Tag bereute, sich statt Flitter und Tand hin zu geben, auf Familie, Liebe und kompromisslose Kunst setzte. Sogar „Josefine“ und „Julia“ erstrahlen in würdigen Versionen.
Als letzter Tipp mithin mein Favorit des Abends, der puristische „Easy Rider“:
Nun hat der alte Kämpfer und Sympath Chris Rea die Lichtung am Ende des Pfades erreicht.
Zu früh – ja.
Zu quälend über weite Strecken – ja.
Doch durch richtige Prioritäten schlussendlich glücklich geworden und musikästhetisch einen eigenen Kosmos erschaffen.
Ich vermisse ihn schon jetzt.
Mach’s gut, lieber Chris.
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.


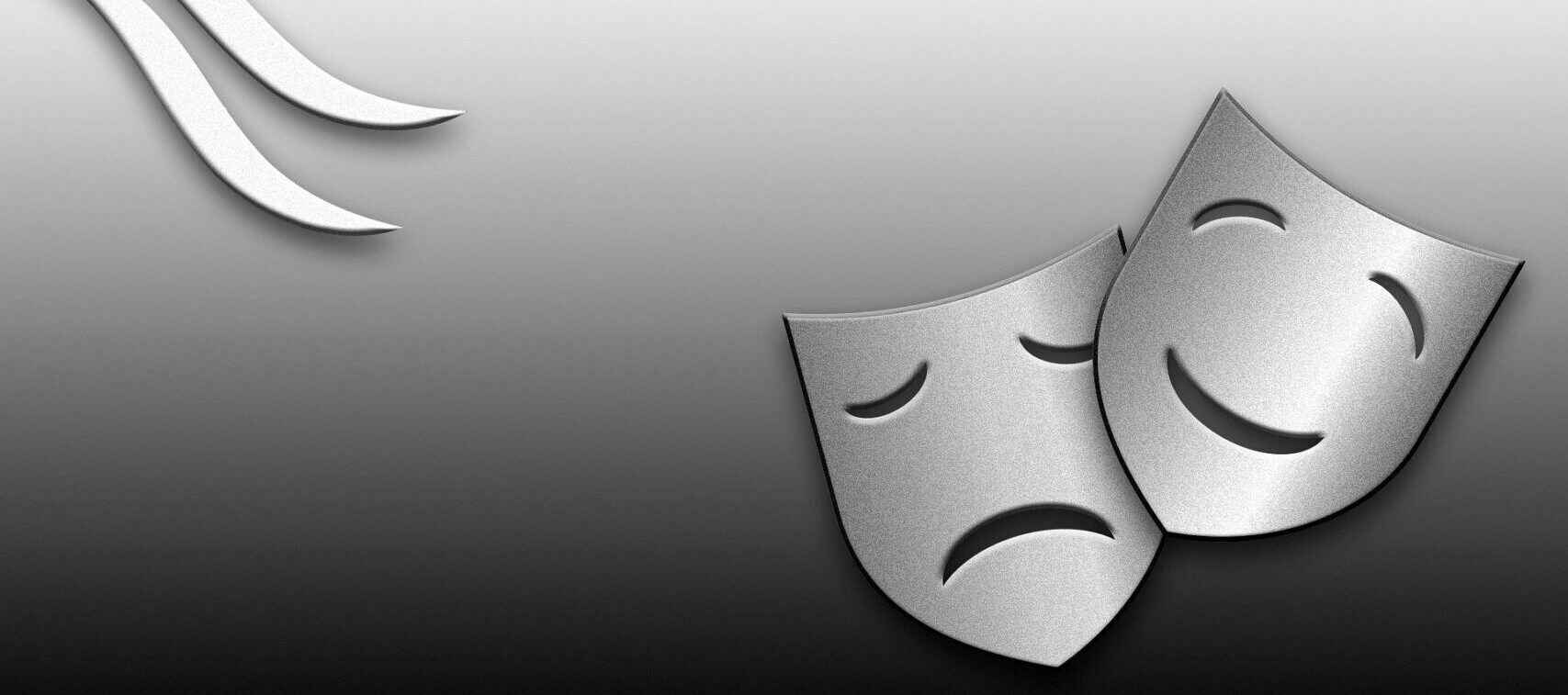


Ihr Kommentar