aus der Serie: Gesoffen wird immer
Ein besonders trauriges Kapitel im Säuferleben stellen die Aufenthalte auf der Intensivstation dar. In die wird man immer dann gelegt, sobald der gemessene Promillegehalt die magische Zahl 4 überschreitet. Und zwar aus dem Grund heraus, weil für 80% der Menschen ab diesem Level akute Lebensgefahr – z.B. Organversagen – besteht. Für den geübten Trinker zwar nicht; aber das ist den Ärzten egal. Sie verfrachten uns trotzdem dorthin. Vermutlich auch aus einem erzieherischen Aspekt heraus, weil sie glauben, wer einmal eine Nacht fixiert auf der Intensiv verbracht hat, wird danach für immer dem Alkohol abschwören. Da irren sie sich allerdings gewaltig. Davon aber später. Erstmal will ich eine kleine Geschichte erzählen:
Mal wieder auf der Intensiv
Schläuche, überall Schläuche. Ich weiß, wo ich bin. Zwar nicht Ort und Zeit; aber den Raum erkenne ich sofort: eine verschissene Intensivstation. Stockdunkel, zweihundert LED-Lämpchen blinken nervös, ein Dutzend Apparate fiepen entsetzlich. Vermutlich mitten in der Nacht.
Mein Schädel dröhnt, das Herz rast wie bei einem nicht enden wollenden 400-Meter-Lauf. Ich würde mich am liebsten übergeben. Den ganzen Dreck in einem Schwall auskotzen, mich sofort besser fühlen, aufstehen und nach Hause gehen. Das klappt nicht. Ich spüre noch nicht einmal das allergeringste Würgegefühl. Mann, ist mir elend zumute. Wie lange habe ich durchgesoffen: eine Woche, vierzehn Tage? Am Anfang war es Bier, danach Wodka und Doppelkorn. Zwischendurch mal ein Joint mit Tina. Süßer Qualm, der mich zum Husten reizt und Durchfall verursacht. Wo ist Tina überhaupt abgeblieben: liegt sie im Bett neben mir? Ich kann meinen Kopf nicht bewegen, um nachzuschauen. Alles dreht sich, wirbelt bunt durcheinander. Völlig egal. Tina ist ein zähes Mädchen. Die wird’s schon selbst packen; braucht keinen Aufpasser. Wir saufen manchmal zusammen, knutschen und fummeln ein bisschen und dann geht jeder von uns seiner Wege. Ist völlig autark, die Gute. Entwickelt sich nie zur nervenden Klette. Deshalb mag ich sie. Den Rest hat mir der Jägermeister gegeben. Widerliches Zeug. Die vierzig Kräuter sind es, die einen umhauen.
Wie mag ich hierher gekommen sein: liegend oder zu Fuß? Hin und wieder schaffe ich es ja, mich bis ins nächste Krankenhaus zu schleppen. Ich kann mich an nichts erinnern. Kompletter Filmriss. Jetzt erstmal alles wurscht: Ich habe Durst, entsetzlichen Durst. Wo ist die gottverdammte Krankenschwester? Wollen sie mich hier heute Nacht einsam sterben lassen? Irgendwo muss der Alarmknopf sein. Normalerweise hinter mir. Ob ich es packe, Kopf und Arm in die Höhe zu hieven? Ich bin so platt, als ob mich ein Zehntonner überfahren hätte. Links schwillt irgendwas an. Die blöde Blutdruckmanschette. Ich hasse dieses Teil. Warntöne erklingen. Das ist gut, brauche ich nicht mehr nach dem dämlichen Schalter zu suchen. Ein Pfleger hastet herein, schaut auf das Messgerät: »170 zu 100. Puls 160 … Sind Sie endlich wach?«
»Ja.«
»Wie geht es Ihnen?«
»Scheiße.«
»Kann ich mir vorstellen.«
»Kriege ich was?«
»Was denn?«
»Pillen.«
»Nein, noch nicht.«
»Was soll das heißen: noch nicht?«
»Sie haben zu viele Promille. Frühestens in acht Stunden.«
»Wollen Sie mich verarschen? Dann bringen Sie mir eine Pulle Wodka.«
»Sie scheinen ein Spaßvogel zu sein. Das mag ich an euch Alkoholikern: Ihr seid immer zum Scherzen aufgelegt.«
»Sehe ich aus, wie jemand, der einen Clown spielen will? Ich krepiere gleich, wenn Sie mir kein Valium bringen.«
»So schnell sterben Sie nicht. Keine Sorge. Sind ja mit über fünf Promille zu Fuß hier reinmarschiert.«
»Und dann?«
»Haben Sie sich vor der Rezeption auf den Teppich gelegt.«
»Oh weh.«
»Ist Ihnen das peinlich?«
»Nein. Völlig scheißegal. Ich will nur Tabletten gegen den Entzug haben. Alles andere interessiert mich nicht.«
»Hat der Arzt nicht verordnet. Tut mir leid.«
»Dann rufen Sie ihn. Schnell!«
»Der schläft und will sicher nicht wegen zwei Pillen geweckt werden. Gedulden Sie sich ein paar Stunden und trinken Sie in der Zwischenzeit viel Wasser. Das reinigt den Körper.«
»Ja ja. Schon gut. Hab’s verstanden.«
Der bullige Kerl verschwindet im Dunkel des Korridors und lässt mich alleine zurück.
Ich fühle mich entsetzlich. Der Schweiß bricht mir aus und läuft in dicken Bahnen vom Hals über die Brust bis zum Bauchnabel. Das Herz pumpt wie bei einem Triathlon. Mein Nervensystem ist derart gereizt, dass ich ein Wasserglas in der Hand zerspringen lassen würde. So ähnlich muss es sich anfühlen, wenn man in die Hölle einfährt. Haben sie mich fixiert? Ich bewege vorsichtig Hände und Füße. Nein. Das ist sehr erfreulich. Im Zeitlupentempo stemme ich meinen Kopf nach oben. Ich habe noch Jeans und T-Shirt an. Und trage nicht das entwürdigende blaue Hemdchen. Sehr gut. Weiß der Himmel, weshalb sie mich nicht umgezogen haben. Mir soll es recht sein. Irgendjemand schnarcht im Nachbarbett. Ob das Tina ist? Nein, das Grunzen klingt männlich. Sie wartet wahrscheinlich draußen auf mich. Ich beginne, mich zu entstöpseln und die Schläuche rauszureißen. Kleine Blutfontänen spritzen. Alles halb so wild. Wird in einigen Minuten wieder aufhören. Mache ich ja schließlich nicht zum ersten Mal. Gleich werden Alarmglocken schrillen. Dann will ich aber schon auf dem Fußboden stehen und nicht mehr auf der Matratze liegen. Meine rechte Seite schmerzt höllisch. Ob ich da drauf gefallen bin? Fühlt sich an wie eine Mischung aus Schlag mit einem Baseballknüppel und Mega-Hexenschuss. Egal, ich muss raus aus diesem Bett.
Die Sirenen heulen auf. Der Pfleger kommt erneut herein gespurtet.
»Was tun Sie da, um Gottes Willen?«
»Seh’n Sie doch. Ich verabschiede mich.«
»Das können Sie nicht tun.«
»Aber sicher doch. Mir geht’s schon wieder ausgezeichnet.«
»Ohne Arzt lasse ich Sie nicht raus.«
»Ich denke, der pennt. … Dann wecken Sie ihn. Sonst bin ich durch die Tür.«
»Warten Sie bitte.«
Er sprintet nach links. Ich zähle bis zehn und wanke nach rechts. Die Türen sind alle geöffnet. Glück gehabt: kein Hochsicherheitstrakt. So schlimm kann es nicht gewesen sein. Sonst hätten sie mich angebunden. Ich kenne das Spiel zur Genüge. In diesem Krankenhaus war ich schon mal. Eine Treppe runter, dann geradeaus, nach links und nun ohne Aufsehen durchs Foyer. Irgendjemand schreit, ich schaue nicht nach hinten. Ich bin im Freien. Niemand hat mich angehalten. Sehr gut! Jetzt rasch weg vom Gelände. Die rufen sofort die Polizei, wenn einer stiften geht. Ich stehe in verdreckter Jeans und kurzärmligen Shirt auf dem Parkplatz. Über und über mit Blut besudelt. Barfuß. Mist, habe die Schuhe in der Eile vergessen. Nicht mehr zu ändern. Stecken Kanülen im Handrücken? Daran erkennen sie einen nämlich schnell. Nein, alles oben schon abgerissen. Was für ein Glück, dass sie keinen Harnkatheter gesetzt hatten. Den hätte ich selber nicht entfernen können. Ich humpele fort in Richtung Fluss. Vom Ufer aus kann ich mich schlafwandlerisch orientieren.
In meiner Hosentasche entdecke ich einen zerknüllten Zwanziger. Was für ein unglaubliches Schwein ich habe. Das sind locker fünf Bier und drei Flachmänner an der Nachttanke. Der Abend ist gerettet. Die Vorfreude auf den Alkohol vertreibt die schlimmsten Schmerzen. Mich fröstelt. Mitte Januar wird es abends ohne Jacke und Schuhe verdammt kalt. Besser frei und frieren als warm in Gefangenschaft. Ich beschleunige meine Schritte. Ich schiebe den Schein in den Schlitz und der Kassierer legt im Gegenzug Hansa-Pils und Billigfusel in die Metallklappe. Den ersten Nullzweier leere ich neben Zapfsäule 4. Binnen Sekunden durchströmt ein wohliges Wärmegefühl meinen Körper. Ausgehend vom Magen flutet es in die Adern und erreicht meine überreizten Synapsen im Gehirn. Das Zittern stoppt. Die Finger gehorchen wieder meinem Willen. Ich kippe zwei Dosen hinterher und spare mir den Rest für den langen Weg auf. Sind schätzungsweise drei Kilometer bis zu Tinas Wohnung quer durch den dunklen Park. Ob sie sich freut, mich wiederzusehen? Ich werde ihr einen Flachmann als Geschenk mitbringen. Und morgen: Wie soll es dann weitergehen? Egal, morgen ist morgen. Was soll ich mir jetzt den Kopf über die Zukunft zerbrechen? In einer Stunde werde ich auf Tinas Sofa liegen, zusammen mit ihr saufen und eine Runde vögeln.
Ich werde auf einmal müde und setze mich auf eine Bank. Die Lider klappen runter. Bloß nicht im Freien einpennen, schwirrt es durch meinen Schädel: »Du wirst bei diesen Temperaturen erfrieren.« Letztlich alles egal. Irgendwann geht es eben zu Ende. Keine Party dauert ewig. Ich kippe seitlich weg ins feuchte Gras. In fünf Sekunden schlafe ich ein. Scheiße, nicht mehr bis zu Tina geschafft. Ob sie mich suchen und rechtzeitig finden werden? Mir wird schwarz vor Augen.
…
Der Säufer gewöhnt sich im Verlauf seiner Trinkerkarriere an vieles, so auch an die Intensiv. Rund ein Drittel meiner klinischen Entzüge begann ich mit dem Umweg über diese Station. Die Aufenthaltsdauer dort schwankte zwischen einer Nacht, 24 Stunden bis hin zu drei Tagen. Festgebunden ans Bettgestell, Notdurftpfanne unter dem Hintern, gefüttert werden wie ein 100jähriger: Es gibt schönere Plätze als den Vorhof ins Jenseits. Und trotzdem schreckte mich die Aussicht auf diesen schauderhaften Ort nicht davon ab, weiter zu konsumieren und beim nächsten Absturz eventuell ein weiteres Mal hier aufzuwachen. Ich kam erst dann ins Grübeln, als mir die Ärzte glaubhaft versicherten, dass …*
* davon berichte ich in der nächsten Kolumne (ja ja, ist ein fieser Cliffhanger)
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.



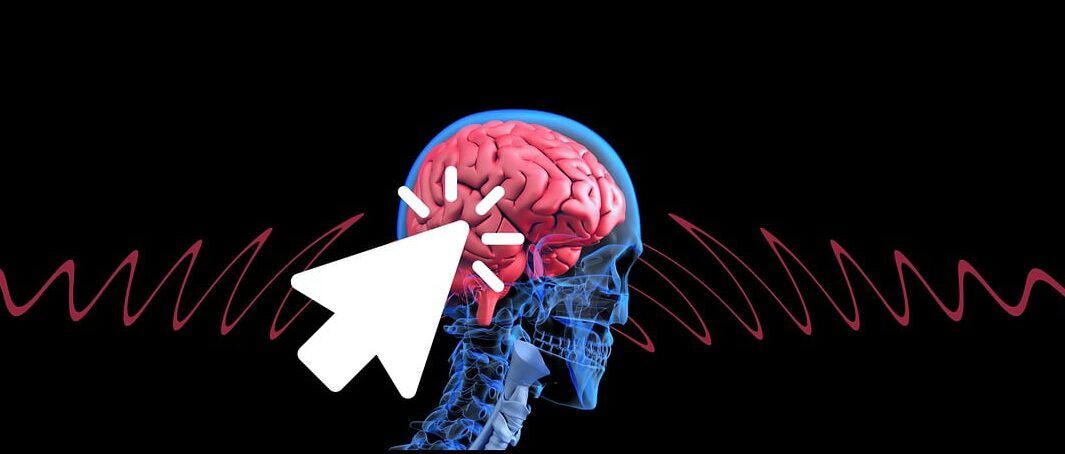

Ihr Kommentar