Von Matthias Matussek
Mordstimmung im sächsischen Hoyerswerda, die triste Siedlung in der Müntzerstraße feiert. Es ist das erste Fest, seit es die Siedlung gibt.
Frauen in wattierten Bademänteln stehen auf der braunen Grasnarbe. Sie halten ihre Säuglinge im Arm und feixen. Teenager in stone-washed Jeans kreischen, Radios dudeln, Hunde pinkeln. Aus den Fenstern lehnen Männer in Unterhemden auf Kissen. Die Müntzerstraße feiert den Sieg des Mobs.
Alle starren auf den Hauseingang, aus dem dunkelhäutige Menschen mit verstörten Gesichtern ihre Habseligkeiten schleppen, Säcke, Koffer, Kisten. „Guck mal, was die alles haben“, ruft eine magere Frau mit schütterer Dauerwelle.
Die 16jährige Dana, die das mit glänzenden Augen verfolgt und dabei nervös auf ihrer Unterlippe kaut, stößt hervor: „Geschieht denen recht. Die haben Frauen vergewaltigt.“ Ihre Freundin setzt hinzu: „Und Schafe geschlachtet.“ Und ein Mann in fleckiger Hose: „Die haben sich doch nie gewaschen.“
In Hoyerswerda hat der häßliche Deutsche sein Coming-out. Fünf Terror-Nächte lang haben Halbwüchsige mit Flaschengeschossen, Leuchtspurmunition und Steinen die Asylantenunterkünfte sturmreif geschossen. Nun können die Behörden, die lange tatenlos zugeschaut haben, „die Sicherheit der ausländischen Mitbürger“ nicht mehr länger garantieren und lassen evakuieren.
Und die Männer in den Unterhemden? Die Mütter, die braven Bürger Hoyerswerdas? Sie haben sich gefreut. Erst heimlich, dann zunehmend mutiger, schließlich haben sie applaudiert. Jahrelang mußten sie schweigen. Jetzt fließt ihnen der braune Dreck in Strömen heraus. Die letzten Bißsperren sind beseitigt. „Ausländerfotze“ brüllt einer.
Unter dem nachlässigen Schutz schmunzelnder Polizisten besteigen rund 150 Rumänen und Vietnamesen die bereitstehenden Verkehrsbusse. Mit Blaulicht setzt sich der Konvoi in Bewegung. Die Menge grölt. Und dann fliegen die Steine.
Tam Le Thanh, ein 21jähriger Junge aus Hanoi, hat einen Fensterplatz. Er hatte in die zähnebleckende Menge hinausgewinkt, krampfhaft grinsend, um seine Angst zu verbergen. Plötzlich verschwindet sein Gesicht hinter einem Netz aus Glassprüngen. In der Scheibe klafft ein häßliches Loch. Tam bricht blutüberströmt im Polster zusammen. „Treffer“, brüllt einer aus der Menge. Die anderen applaudieren. Thai Binh, Tams Freund, ruft um Hilfe. Der Fahrer startet durch. Nur weg hier.
Exodus. Eine armselige Karawane, die da an düsteren Blocks vorbei in die Nacht hinausfährt: drei Busse und zehn Schrottautos, die sich die rumänischen Asylbewerber zusammengeflickt haben. Da ist Jovan aus Bukarest in seinem klappernden Scirocco, Capo und seine Roma-Familie in einem Kleinbus der „Behinderten-Hilfe Offenbach“. Und all die anderen in den Bussen, die Frauen, die Mütter mit ihren Kindern, George aus Ghana und der blutende Tam.
Ihre Vertreibung ist die erste Schlacht, die deutsche Lumpenproleten gegen die noch Ärmeren gewonnen haben. Kaum einer der Vertriebenen paßt in das Klischee verfolgter politischer Aktivisten. Sie reden nicht über politischen Terror, sondern über das Elend in ihrer Heimat. Es ist eine bunt zusammengewürfelte Truppe: Verfolgte, junge Abenteurer, verzweifelte Familienväter, kleine Gauner, arme Schweine. Sie kamen in der Hoffnung auf das große Los im Land der Mercedes-Sterne. Und sie landeten in Hoyerswerda.
In dieser Nacht ist Hoyerswerda überall. Wo immer ein später Kneipenbesucher in den verschlafenen Dörfern am Straßenrand steht, grüßt er die Busse mit dem Mittelfinger. Und überall wird jetzt Randale gemeldet. Hoyerswerda war ein Anfang.
Jovan kaut an seinem Bart. Er möchte nur eines: endlich Ruhe. Er erzählt vom rumänischen Steinzeit-Diktator Nicolae Ceausescu. „Wenn den einer vor zehn Jahren abgeknallt hätte“, sagt er und stiert auf die Landstraße, „dann würde ich jetzt nicht diesen Bussen hinterherfahren.“
Immer wieder gerät die Karawane ins Stocken. Panik bricht bei den Asylanten aus, als das Gerücht die Runde macht, sie würden über die nahe Grenze abgeschoben. Ein Rumäne droht sich und seine fünf Kinder umzubringen. Ist es denn drüben tatsächlich schlimmer?
Nach zwei Stunden Fahrt in den Süden, kurz vor Pirna, hält der Konvoi. Endlich wird ein Rettungswagen herbeigerufen, der den verletzten Tam zu einer Augenärztin bringt.
„Das sieht schlimm aus“, murmelt sie und telefoniert mit dem Klinikum Dresden. Dort weigert sich das Personal, den Vietnamesen aufzunehmen. Da müsse erst eine ordentliche schriftliche Genehmigung her. Wer überhaupt ist der Kostenträger? „Das Auge ist perforiert“, stöhnt die Ärztin, „da stecken Glassplitter drin.“ Nach längeren Verhandlungen gibt Dresden grünes Licht.
Doch für die anderen hält der Horror an. Fliehen zermürbt. Und in dieser Nacht besonders, einer historischen Nacht, in der deutscher fremdenhassender Mob nach langer Zeit wieder einmal siegte. Während die Vietnamesen in ein geheimes Lager in den Bergen gebracht werden, soll ein Teil der Rumänen in einem nahen Ausländerheim Quartier machen.
Müde, mit steifen Gliedern steigen sie aus ihren Fahrzeugen. Doch die Hölle ist überall: Die Barackentür fliegt auf, ein Mann mit blutenden Unterarmen steht dort und brüllt. Raschid, der Marokkaner, hat Krach mit einer Zigeunergang. Es geht um Jina, die für 300 Mark verkauft werden sollte. Vendetta um Mitternacht. „Mein Gott“, stöhnt der Rumäne Szabo, „da lasse ich meine Kinder nicht hinein.“
Nun fahren sie zu den anderen in eine ehemalige Jugendherberge, die jetzt aus den Nähten platzt. Matratzen werden auf dem Boden verteilt. Und in der Herbergsküche steht Frau Goll und verteilt Brot und Wurst. Früher war Renate Goll einmal CDU-Bürgermeisterin. Jetzt kümmert sie sich um Asylanten. Immerhin hat sie nun einen Job. Die Wende, sagt sie, war für sie nicht nur Sekt.
In dieser Nacht ist sie wie ein Fels in der Brandung. Sie schlichtet Streit, kocht Milch für die Säuglinge, verteilt die Betten. Ihr Rassismus ist von der gemütvollen Art. Den Inder hält sie für einen „Schleicher“ und den Rumänen für „undurchsichtig“. Der Neger tanzt gern, „das liegt bei dem im Blut“, und der Algerier feiert Orgien. Abdullah war so einer. Sie kichert. „Ich dachte immer, der lädt mich mal ein.“
Daß der Treck der Verzweifelten aus Hoyerswerda nun bei ihr gelandet ist, das hält sie für „ganz entsetzlich“. „Haben die Unsrigen eigentlich vergessen, daß sie selbst mal Asylanten waren, vor zwei Jahren, als sie nach Ungarn türmten?“
Gegen zwei Uhr nachts erscheint die Kommunalpolitik, erscheint Landrat Hans-Jürgen Ebers mit grauem Trenchcoat und grauem Gesicht. Noch mehr Asylanten in der Stadt – ein Sprengsatz. Es sind bereits die ersten Morddrohungen gekommen. Sein Parteikollege, der sächsische Innenminister Rudolf Krause, hat vorgeschlagen, die Heime mit Zäunen zu sichern. „So ein Zaun kostet 12 000 Mark, wenn er was taugen soll. Und wer genehmigt mir die Ausgaben?“ Ausländerpolitik hat viele unerwartete Facetten in Sachsen.
Und sie greift weit über Pirna hinaus. Der Ausländerbeauftragte des Kreises ist ein Mann, der globale Zusammenhänge zu erkennen versteht: „Wir hatten mal einen Mauretanier hier“, sagt er. „Das liegt daran, daß die Sahara vorrückt. Deshalb fliehen die nach Norden.“
Die Wüste droht von Süden, die Armut droht von Osten, und Sachsen ist so klein. Doch dieser Tag, der erst ein paar Stunden alt ist, ist ein guter Tag für den Ausländerbeauftragten. Zwei junge Rumänen aus dem anderen Lager wollen zurück in ihre Heimat. In einer kleinen Feierstunde im Büro erklärt er, daß er „den Wunsch der beiden rumänischen Mitbürger nach Rückverbringung selbstverständlich respektiere“, und er bekämpft die aufsteigende Rührung mit Verwaltungsdeutsch. Die beiden Rückkehrer können gleich ein drittes Problem für ihn mitlösen: Sie sollen den 14jährigen Aurel wieder nach Hause bringen. Den hatte sich nämlich „ein homosexueller ostdeutscher Mitbürger“ in einem rumänischen Dorf gekauft und über die Grenze zu schmuggeln versucht – das Geschäft mit dem Elend blüht.
Und die Vertriebenen aus Hoyerswerda? „Die wollen nach Chemnitz weiter“, sagt der Ausländerbeauftragte, „und ich werde auch diesen Wunsch selbstverständlich respektieren.“ Er klingt erleichtert. Natürlich hat sich herumgesprochen, wo die Flüchtlinge untergebracht wurden. Jagdzeiten in Sachsen.
Das Jagdrevier Hoyerswerda, dieser steingewordene Reißbrett-Traum realsozialistischer Kaninchenzüchter, eine vor 30 Jahren erbaute Kunststadt für die Arbeiter des Energiekombinats „Schwarze Pumpe“, grüßt seine Besucher auch am Tage danach mit einem braunen Holzschild am Ortseingang: „Willkommen in Hoyerswerda“.
Willkommen in den Neubauslums, willkommen in den zehn Wohnkomplexen mit ihren drei Kneipen und Schließfächern für 70 000 Menschen, wo die Kriminalitätsrate und die der Selbstmorde einsame deutsche Spitze sind. Willkommen in einem bösartigen, häßlichen, dumpfen Alltag, der bösartige, häßliche, dumpfe Menschen stanzt.
Im Rathaus bemüht man sich, nach den düsteren Bacchanalen der vergangenen Nächte, wieder zu diesem Alltag überzugehen. Die Lokalpolitiker bedauern nicht die Vertreibung von 230 Ausländern, sondern die „negativen Schlagzeilen“. Schuld trägt die „Sensationspresse“. Alle Fraktionen haben diese Peinlichkeit unterschrieben, auch die SPD, auch die Grünen.
Gleich hinter der umkämpften Müntzerstraße im Wohnkomplex 9 liegt die Pablo-Neruda-Schule. Man kennt sie hier nur als „die Achtzehn“, es ist die 18. Schule, die errichtet wurde. „Die Achtzehn“ – das klingt wesentlich angemessener in Hoyerswerda als Pablo Neruda.
In der zehnten Klasse sitzen Dana und ihre Freunde und haben Gesellschaftskunde. Sportlehrer Pedro Liebsch, 26, hat das Fach übernommen, weil sich sonst keiner traut. Und er braucht ohnehin ein Zweitfach, um im neuen Schulsystem unterzukommen. Thema an diesem Tag: „Friedenssicherung“, Aussprache über die „verschiedenen Formen der Gewalt“.
Auf die Reporterfrage, wer denn stolz darauf sei, daß die Asylanten nun aus der Stadt vertrieben worden seien, fliegen alle Hände in die Höhe. Für sie ist das Problem „bereinigt“. Friedenssicherung a la Hoyerswerda.
Allerdings hat sich in den Milchgesichtern, die in der Nacht zuvor noch so eifrig strahlten, eine merkwürdige Verdrossenheit eingegraben. Und als Dana ein paar Stunden später auf einer Matratze in der Zwei-Raum-Wabe hockt, in der sie mit ihrer Mutter lebt, wirkt sie wie eine Gefangene. Die letzten Tage waren ein Fest – und jetzt ist wieder nichts los. Da war dumpfe Gemeinschaft. Nun ist sie allein, und Hoyerswerda stürzt auf sie zurück.
Das Zimmer ist mit Ausländern tapeziert. Mit Rockstars auf Bravo-Postern – sie hat eine Schwäche für mediterrane Typen. Ihre Mutter sitzt vor dem Fernseher und büffelt Soziallehre – sie will sich zur Einzelhandelskauffrau umschulen lassen. Die Beihilfe dafür liegt über den Sozialhilfe-Sätzen. „Wäre ja blöde, wenn ich das nicht mitnehmen würde“, sagt sie. Auch sie ist erleichert, daß die Ausländer nun weg sind: „Die haben doch nur auf unsere Kosten gelebt.“
Über dem Dürer-Bild aus dem Kaufhaus, das zur Auslegeware paßt, schummert eine rote Stofflampe. Danas Mutter sieht müde aus, lethargisch. „Soziale Schichten“, liest sie aus einer Kladde. „Es gibt: Oberschicht, obere Unterschicht, mittlere Mittelschicht, untere Mittelschicht, obere Unterschicht, untere Unterschicht, sozial Verachtete.“
Sie paukt diesen sinnlosen Quatsch so wie früher „Solidarität“ und „Völkerfreundschaft“. Allerdings war das mit den Schichten früher weniger kompliziert. Da gab es nur zwei: die Bonzen und den Rest.
In welche Schicht sie sich selber einordnen würde? „Na, ganz unten, in die sozial Verachteten“, entfährt es ihr spontan. Dann schwankt sie: „Nee, das sind wohl mehr die Ausländer.“ Irgendwie sind die Unterschiede minimal. Aber deutsch ist sie auf alle Fälle. Und das macht einen Riesen-Unterschied.
Sie hat Dana allein aufgezogen. Früher ging das ja noch, mit all den Kindergärten. Morgens um fünf hat sie ihre Tochter abgeliefert und nach der Arbeit abends wieder abgeholt. Und jetzt ist sie fast erwachsen.
Plötzlich ruft Dana, die sich vor den Fernseher gekauert hat: „Mama, das bin ja ich.“ In der Teenagersendung „elf 99“ läuft ein Bericht vom Vorabend. Die verschreckten Gesichter, die Pfiffe, die Polizisten, die ungerührten Sprüche über „stinkende Ausländer“ – Bilder einer auch seelischen Katastrophe. Und die Mutter sagt stolz: „Na, jetzt wirst du vielleicht für den Film entdeckt.“
Nun springt Dana auf. Es könnte doch noch ein guter Abend werden. Sie will noch ins HBE, ins „Haus der Berg- und Energiearbeiter“, wo sie ihre Freunde treffen kann. Manja und Tschabo und Ramona – exotische Namen waren beliebt in der abgeriegelten, eingemauerten, ausländerhassenden DDR.
Früher war das HBE ein Bonzenhaus. Nun ist das Restaurant geschlossen. Ab und zu erlebt der Festsaal noch dünne Veranstaltungen. Der Jazzer Peter Herbolzheimer hatte sich hierher verirrt. Von den 800 Plätzen waren 50 belegt.
Nun wird die Halle für einen Benefiz-Abend hergerichtet. Für die Kinder von Tschernobyl soll das HBE-Ballett „Aschenputtel“ tanzen, und im Hoyerswerdaer Wochenspiegel, dem Anzeigenblatt, wird für die gute Sache geworben: „Da das Leben in der radioaktiven Zone nicht ungefährlich ist, wird angestrebt, daß sich die Kinder jährlich zwei bis drei Monate im Ausland aufhalten können.“
Zunächst aber treffen sich die verstrahlten Kinder von Hoyerswerda, denen der Fremdenhaß das Blut vergiftet hat und denen jährlich zwei bis drei Monate Ausland guttun würden, im Jugendklub im Erdgeschoß. Ein gähnender trister Riesensaal mit schwindsüchtigen Drahtstühlen auf Linolparkett.
Ziellos läuft ein zwölfjähriges blasses Mädchen im ledernen Fransenhemd durch die Halle und boxt sich mit ihrer zierlichen Faust in die Handfläche. Das hat sie bei den Großen abgeguckt, die am Tresen stehen und Billigbier in sich hineinschütten.
Sven, der Lederrocker, der fünf Jahre Knast hinter sich hat, unterhält sich mit ein paar „Glatzen“, den Skins in Ballonjacken. Die Bullen haben ihm die Knarre weggenommen. Und dann haben sie ihn im Wald ausgesetzt. Egal: „Wir sind die ersten in Deutschland, die es geschafft haben, das Gesocks zu verjagen.“
Sven ist stolz auf Deutschland. Weswegen? „Na wegen der Dichter und Denker“, kommt die verblüffende Antwort. An welche er dabei denkt? Ihm fällt auf Anhieb keiner ein. Ein Mädchen ruft: „Bert Brecht!“ Allgemeine Heiterkeit. „Den hamwer in der Schule gehabt. War son Kommunist. Wie die anderen.“
„Meine Eltern waren auch in diesem verlogenen Schweinehaufen“, sagt ein schmaler Teenager, über dessen Brust das T-Shirt „Deutschland einig Vaterland“ in Fraktur knittert, „die würde ich dauernd auf die Schnauze hauen, wenn das nicht meine Eltern wären.“ Doch seltsam: All diese Rotzsprüche klingen an diesem Abend lustlos. Wie routinierte Nachhutgefechte – die Kampfstimmung fehlt. Dana macht sich auf den Weg nach Hause.
Eine neue Nacht senkt sich über Hoyerswerda, das nun wieder still ist und nur noch sich selbst zum Feind hat. Schwarze Häuserschluchten, menschenleere Straßen.
Zwischen den Silos schimmert ein Neon-Würfel mit dem Schriftzug „Tropic Sun“, Reklame für ein Bräunungsstudio. Gegenüber, in der Schweitzer Straße, huscht Angelo aus Mosambik mit einem Koffer aus dem Hauseingang. Seit acht Jahren wohnt er hier. Hier, bei den Gastarbeitern der alten DDR-Regierung, begannen die Krawalle.
Angelo traut sich erst nach Einbruch der Dunkelheit zu seiner deutschen Freundin. Er hat Angst. Um sie. Nächste Woche wird er nach Magdeburg ziehen. Dann haben alle Gastarbeiter Hoyerswerda verlassen.
Ein Rentner aus dem Nachbarhaus, der seinen Dackel pinkeln läßt, sieht den schwarzen Angelo und zischt, mit gesenktem Blick: „Diese Preßkohle sollte man erschießen.“ Es ist eine leise, erstickte Verwünschung. Die Krawalltage sind vorbei. Nun wandert die Wut wieder nach innen, in tiefere Schichten – die Wut über ein verpfuschtes Leben und eine Strafkolonie namens Hoyerswerda.
Das einzige Lokal, das hier nach zehn Uhr abends noch geöffnet hat, heißt „Taverne“. Eine Bar mit Nischen aus Cordsamt und dunkelbraunen Rosen auf hellbraunem Grund, ganz im Schick der fünfziger Jahre. An der Bar stehen schmerbäuchige Männer mit Schlüsselbunden, die vom Gürtel baumeln. Drei blonde Verkäuferinnen studieren die Getränkekarte, die „Kiwi Queen“ bietet und „Banana Tonic“. Wer behauptet denn, daß Hoyerswerda keine Schwäche für ferne Länder hat?
Und humanistische Bildung hat es erst recht. Die Getränkekarte, die noch aus den alten Zeiten stammt, hat sich das kulturelle Erbe mit einem Goethe-Zitat angeeignet: „Der Wein erfreut des Menschen Herz, und die Traurigkeit ist die Mutter aller Tugenden.“
An einem Tisch an der Tanzfläche sitzt ein bärtiger Mann und stiert ins Glas. Die Frau neben ihm schaut stumm aufs leere Parkett, das die flackernden roten und grünen Lichter reflektiert. Aus den Boxen dröhnt: „Ich fühl‘ wie du.“
So sehen Sieger aus.
Von Matthias Matussek. Zuerst erschienen im Spiegel 40/1991
Newsletter abonnieren
Sie wollen keine Kolumne mehr verpassen? Dann melden Sie sich zu unserem wöchentlichen Newsletter an und erhalten Sie jeden Freitag einen Überblick über die Kolumnen der Woche.

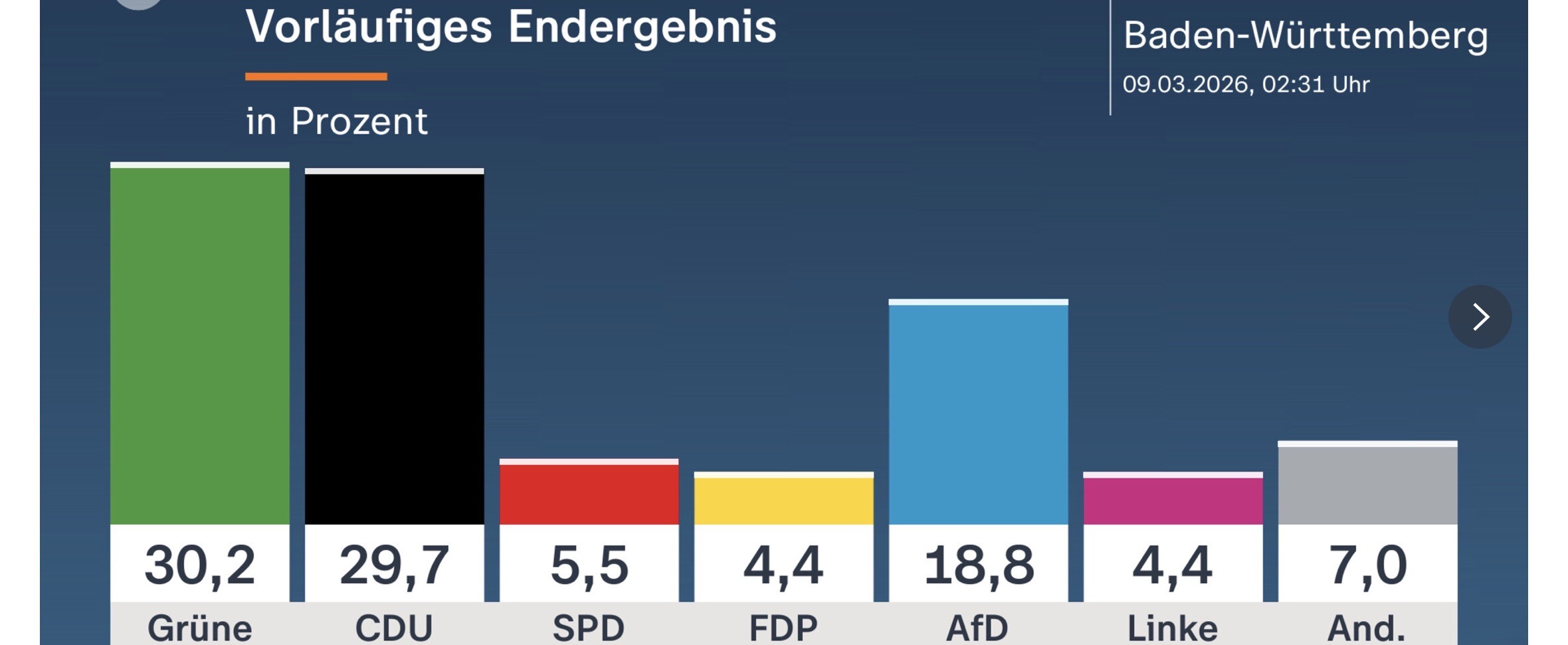

derblondehans
… wirklich erschreckend gut geschrieben, werter Hr. M.M., ‚mit einer Wucht, in einer Klarheit und Präzision‘ … Sie müssen es ja wissen, Sie waren vor Ort.
Ist das ein Schreibfehler oder wie kommen 1991 [sic!] ‚rumänische Asylbewerber‘ nach Deutschland?
In Rostock-Lichtenhagen gab es für 1992 ähnliches zu berichten. Dazu habe ich Bekannte gefragt, die vor Ort waren: http://starke-meinungen.de/blog/2012/08/26/friedensnobelpreis-fur-jens-stoltenberg/comment-page-1/#comment-15769